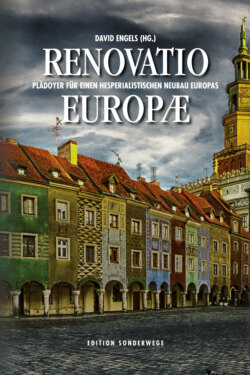Читать книгу Renovatio Europae. - David Engels - Страница 14
5. Wer regiert die EU?
ОглавлениеEs stellt sich in der öffentlichen Debatte verstärkt die Frage »cui bono«: Wer profitiert von jener ideologischen Revolutionierung der Europäischen Union, wer stellt die Kräfte, welche dieses System stützen und von ihm profitieren? Die Antwort ist einfach: Wir sind in der westlichen Welt mit nichts weniger als einem modernen Klassenkampf konfrontiert. Während wir auf der einen Seite jene Menschen haben, die in ihrer jeweiligen Heimat, ihrer Kultur, ihren Bräuchen und ihrer Identität verwurzelt sind und somit in der Kontinuität eines jahrhundertelang zurückgehenden Menschenbildes stehen, haben wir auf der anderen Seite eine neue, globale Elite, für welche jede Form von »Grenze« – sei sie national, kulturell, gesellschaftlich, religiös oder sexuell – ein Hindernis darstellt. Bereits Zygmund Bauman schrieb im Jahr 2000: »In the fluid stage of modernity, the settled majority is ruled by the nomadic and extraterritorial elite«, und es reicht, sich die Lebensläufe jener Bürokraten und Entscheider anzuschauen, welche heute für die EU, morgen für den IWF und übermorgen die UNO arbeiten und sich regelmäßig in Davos oder den Bilderberg-Versammlungen treffen, um zu verstehen, was mit dieser Feststellung gemeint war. Wenn Macron daher von den drei Ambitionen der EU spricht – »Freiheit, Schutz und Fortschritt«, so ist in erster Linie wohl die Freiheit, der Schutz und der Fortschritt jener kleinen Herrschaftselite gemeint, welche in der Tat angesichts der Spannungen mit den Vereinigten Staaten und der inneren Infragestellung dieses Modells durch die sogenannten »Populisten« zunehmend jenes Schutzes bedürftig sind, um weiterhin in Freiheit ihre Interessen zu verfolgen und ihre Macht zu vermehren.
Die Existenz jener soziologischen Klasse wird umso deutlicher, beobachtet man die politische Kultur der verschiedenen EU-Institutionen: Während das Parlament weitgehend »national« aufgebaut ist und trotz seiner unweigerlichen Internationalisierung doch engste Beziehungen zu den verschiedensten Heimatländern und Wahlkreisen seiner Mitglieder aufrechterhält, pflegt die Kommission eine ganz andere politische Kultur, welche mittlerweile kaum noch einen Bezug zu ihrem kulturellen Substrat hat (seien es Brüssel, die Heimatländer oder die abendländische Zivilisation) und nicht ohne Grund eng verbunden ist mit der meist multikulturellen Vita der meisten Mitarbeiter, welche oft genug binationale Elternteile haben und daher in der Identität als »EU-Bürger« eine Möglichkeit finden, sich mit ihrem jeweiligen kulturellen Erbe nicht allzu genau auseinandersetzen zu müssen. Dies färbt mittlerweile auch auf die Selbstdarstellung und Argumentationslogik vieler nationaler Politiker ab, welche – allen voran Deutschland – niemals erklären: »Wir als Deutsche wollen…«, sondern immer: »Wir als Europäer denken…« und somit dem Gegenüber implizit sein eigenes Europäertum streitig machen.
Hierbei wird der spezifische, durch Internationalismus, Multikulturalismus, Elitismus und Globalismus geprägte Lebensstil jener neuen Führungsschicht mittlerweile selbst in Staaten wie Ungarn und Polen auch von lokalen Eliten übernommen, die sich eine Gesellschaft nach ihrem Vorbild schaffen möchten – auch dies eine nicht erstaunliche Entwicklung, hat doch noch jedes Imperium sich bemüht, die lokalen Eliten an den dominanten Lebensstil heranzuführen und diesen auch in die Peripherie zu importieren; man denke hier nur an die in England ausgebildeten indischen Aristokraten, welche sich nach ihrer Rückkehr auf den Subkontinent in ihrer eigenen Heimat nicht mehr zurechtfanden.
Und wenn mir ein solcher Vergleich sonst natürlich fern liegt, kann ich nicht umhin, auch an die Herrschaftsstrukturen des damaligen Ostblocks zu denken, dessen Zentrum zwar in Moskau lag, aber eine Strahlkraft bis weit an die Peripherie besaß und die lokalen Eliten bis in die kleinsten Gemeinden prägte. In dieser Hinsicht ist es vielleicht nicht überflüssig, auf die gegenwärtige inner-ukrainische Debatte zu verweisen, in welcher es eigentlich nur darum geht, nach dem Fall der Sowjetunion, des »Sowjetski Sojus«, nunmehr Teil des neuen, des »Europejski Sojus« zu werden, eine Form der Domination also mit einer neuen, die als materiell erheblich vorteilhafter gesehen wird, zu tauschen – eine Debatte, die in vielen Zügen an die inner-polnischen Diskussionen der 1990er Jahre erinnert.