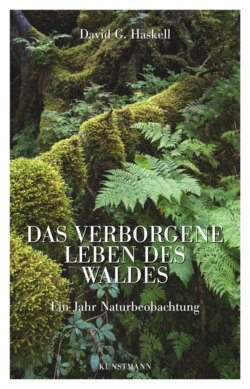Читать книгу Das verborgene Leben des Waldes - David G. Haskell - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16. FEBRUAR Moos
ОглавлениеAM MANDALABODEN HERRSCHT AUFRUHR: Prasselnde Hagelsalven gehen aus tief hängenden Wolken nieder, halten kurz inne, feuern dann erneut. Der Golf von Mexiko hat Regenbataillone herübergeschickt, die den Wald seit einer Woche unter Beschuss nehmen. Die Welt scheint eine einzige flutende, explodierende Wassermasse.
Die Moose frohlocken in der Nässe: Üppig grün wölben sie sich dem Regen entgegen. Ihre Wandlung ist erstaunlich. Letzte Woche noch hingen sie, vom Winter bezwungen, blass und ausgetrocknet über dem Gestein im Mandala. Nun haben sie die Kraft der Wolken angezapft.
Da auch ich, nach monatelangem Winter, nach neuem, frischem Grün dürste, schaue ich genauer hin. Am Rand des Mandalas liegend, beuge ich mich über das Moos. Je näher ich komme, desto stärker riecht das Moos nach Erde und Leben, desto schöner wirkt es. Ich giere nach mehr, ziehe die Lupe hervor, presse sie vors Auge und krieche näher heran.
Auf den Felsen vermengen sich zwei Moosarten. Da ich die Moose nicht genau bestimmen kann, ohne eine Probe ins Labor zu bringen und ihre Zellen unter das Mikroskop zu legen, betrachte ich sie, ohne ihnen Namen zu geben. Die eine Art bildet dicke Stränge, jeder Strang mit eng beieinanderstehenden Blättchen umwickelt. Sie sehen von Weitem aus wie lebendige Dreadlocks. Schaut man näher hin, erkennt man, dass die Blättchen als unzählige anmutige Spiralen angeordnet sind – wie zahllose grüne Blüten. Die andere Moosart wächst aufrecht; ihre Stämmchen verästeln sich wie Tannen en miniature. Die sprießenden Triebe der beiden Arten sind so grün wie junger Blattsalat. Daran schließt sich ein satteres Grün an, das ins Olivgrün reifer Eichenblätter changiert. Ein helles Strahlen herrscht in dieser Welt. Jedes Blättchen besteht nur aus einer Zellschicht: Das Licht tanzt und flutet durch die Moose und erleuchtet sie von innen heraus. Wasser, Licht und Leben haben ihre Kräfte gebündelt und die Macht des Winters gebrochen.
Obwohl die üppigen Moose vor Lebenskraft strotzen, bringt man ihnen gewöhnlich wenig Respekt entgegen. In Lehrbüchern werden sie gern als Ewiggestrige längst vergangener Zeiten beschrieben, als primitive Prototypen, an deren Stelle inzwischen eine entwickeltere Flora mit Farnen und Blütenpflanzen getreten sei. Doch Moose als evolutionäre Überbleibsel zu bezeichnen, trifft die Sache in mehrfacher Hinsicht nicht. Wenn Moose rückwärtsgewandte Hinterwäldler und angesichts einer überlegenen Moderne zum Aussterben verdammt wären, müsste es fossile Zeugnisse ihres einst ruhmreichen Zeitalters und ihres fortschreitenden Niedergangs geben. Doch das Fehlen solch fossiler Belege lässt genau das Gegenteil vermuten. Zudem besitzen die Fossilien der ersten primitiven Landpflanzen nur wenig Ähnlichkeit mit den sorgsam angeordneten Blättchen und ausgefeilten Fruchtstielen heutiger Moose.
Genetische Vergleiche bestätigen, was uns die Fossilien sagen: Der Familienstammbaum der Pflanzen hat sich schon vor knapp fünfhundert Millionen Jahren in vier Hauptzweige unterteilt. Die genaue Reihenfolge ist zwar noch umstritten, doch die Lebermoose, kriechende krokodilhäutige Liebhaber von Bachrändern und feuchten Felsen, könnten die Ersten gewesen sein, die sich abspalteten. Es folgten die Vorfahren der Laubmoose und schließlich die Hornmoose, die engsten Verwandten von Farnen, Blumen und deren Familie. Die Moospflanzen sind ihren eigenen Weg gegangen: Sie waren und sind keine Durchgangsstation auf dem Weg zu einer »höheren« Form.
Ich blicke durch das Glas meiner Lupe und sehe, dass das Moos über und über mit Wasser benetzt ist. In den Winkeln zwischen Stämmchen und Blättchen haben sich silbern schimmernde Seen verfangen, deren Wölbung von der Oberflächenspannung zusammengezwungen wird: Die Wassertropfen fließen nicht, sie kleben und klettern. Scheinbar kann das Moos die Schwerkraft überwinden und flüssige Schlangen beschwören. Es lebt in der Welt der Menisken: jener Wasseroberflächen, deren Rand die Innenfläche von Gläsern hin aufwandert. Moose sind wie das Glas: Sie locken durch ihre Architektur Wasser an und setzen es in ihrem labyrinthischen Innern gefangen.
Die Beziehung zwischen Moos und Wasser ist für uns nur schwer nachvollziehbar. Unser Leitungssystem verläuft in unserem Innern, mit verdeckten Schläuchen und Pumpen. Auch die Leitungen von Bäumen liegen unter der Rinde. Und die unserer Häuser unter Putz. Säugetiere, Bäume, Häuser: Sie alle gehören in die Welt der Riesen. Doch für den Mikrokosmos der Moose gelten andere Regeln. Die elektrische Anziehung zwischen Wasser und pflanzlichen Zelloberflächen kann, über kurze Distanzen, gewaltig sein, und Moose sind so gebaut, dass sie diese Anziehungskraft meisterhaft nutzen: Mit ihren komplex modellierten Oberflächen können sie Wasser transportieren und speichern.
Entlang ihrer Stämmchen verlaufen tiefe Furchen, die das Wasser vom feuchten Moosinneren an die trockenen Moosspitzen weiterleiten – etwa so, wie Küchenpapier einen Fleck aufsaugt. Die Stämmchen sind zu unentwirrbaren, wasserliebenden Dreadlocks verfilzt, und ihre Blättchen schaffen durch reichlich Nietenbesatz eine vergrößerte Oberfläche, auf der Wasser haften bleibt. Die Blättchen umfangen das Stämmchen genau im richtigen Winkel: Die Wassertropfen verfangen sich in der Blattachsel, um sich dann mit Tropfen aus Kraushaar und Runzeln zu verbinden. Moospflanzen sind ein sumpfiges Miniflussdelta, nur senkrecht gedreht. Das Wasser, das vom Sumpf ins Haff und schließlich in ein Rinnsal ausläuft, hüllt die gesamte Umgebung in Feuchtigkeit. Wenn es zu regnen aufhört, hat sich im Moos fünf bis zehn Mal mehr Wasser verfangen, als in den Mooszellen enthalten ist. Die Moospflanzen haben einen grünen Kamelhöcker geschultert, der sie lange Durststrecken überwinden lässt.
Die Moospflanzen haben sich aus einer anderen architektonischen Blaupause entwickelt als Bäume, sind aber im Endergebnis offenbar genauso komplex und, was ihre langfristige evolutionäre Überlebensstrategie betrifft, mit Sicherheit genauso erfolgreich. Doch nicht nur in puncto Wassertransport und -speicherung erweisen sich Moose als außergewöhnlich raffiniert. Als der Regen vor einer Woche eingesetzt hat, löste er eine Reihe physiologischer Veränderungen aus, die das üppige Wachstum von heute erst ermöglichten. Zunächst umhüllte der Regen das ausgetrocknete Moos, sickerte dann in seine dünnen, holzigen Zellwände und benetzte schließlich die Oberflächen der dahinter verborgenen, vertrockneten Rosinen. Die Haut der schrumpeligen Kugeln, schlummernde Zellen, lechzte nur so nach dem Regengeschenk. Die Zellen schwollen an, die Zellhaut drückte gegen die holzige Wand, und das Leben kehrte zurück.
Das Drängen und Drücken Tausender Zellen verlieh der Pflanze eine neue Fülle und erlöste das Moos aus seinem schlaffen Winterdasein. Große, runde Zellen an den Blattachseln pumpten sich voll Wasser und schoben die Blättchen von den Stämmchenachsen weg: Es entstand Stauraum für Wassertropfen, und die Blattoberflächen zeigten wieder himmelwärts. Auf den konkaven Blattinnenflächen haftet das Wasser. Die konvexen Blattaußenflächen verwandeln Licht und Luft in Moosnahrung. Der Regen ließ die Blättchen anschwellen und machte ein jedes zu Wassersammler und Sonnenfänger, zu Wurzel und Ast.
Im Zellinneren dagegen herrschte Verwüstung. Hereinströmendes Wasser wirbelte die Zelleingeweide durcheinander. Durchnässte Membranen lockerten sich so rasch, dass manches Zellinnenleben ausgeschwemmt wurde: Zucker und Mineralstoffe, für immer verloren. Flexibilität kostet. Doch das Drunter und Drüber währte nicht lange. Bevor die Moospflanze im Winter austrocknete, hatte sie vorsichtshalber chemische Reparaturstoffe in ihren Zellen gelagert. Sie sorgen jetzt dafür, dass die geflutete Zellmaschinerie wiederhergestellt und stabilisiert wird. Sobald die angeschwollene Zelle ihr Gleichgewicht dann zurückgewonnen hat, stockt sie den Vorrat an Reparaturstoffen wieder auf. Und sie saugt sich voller Zucker und Proteine, die ihr helfen, die Maschinerie bei Trockenheit erneut einzumotten.
Moospflanzen sind also jederzeit auf Dürre und Überflutung vorbereitet. Andere Pflanzen gehen die Katastrophenvorsorge entspannter an und stellen ihr Erste-Hilfe-Paket erst dann zusammen, wenn der Notfall eingetreten ist. Doch das braucht Zeit: Überraschende Trocken- oder Regenperioden bringen die Bummelanten um, nicht aber die Moose.
Doch Moose überstehen Trockenheit nicht nur durch sorgfältige Vorbereitung. Sie können sich auch gegen extreme Dürren zur Wehr setzen, die die Zellen anderer Pflanzen schrumpeln und sterben lassen. Moose überhäufen ihre Zellen dazu mit Zucker: Er kristallisiert zu Kandis, der ihr Zellinneres glasiert und konserviert. Verdörrtes Moos könnte sehr schmackhaft sein, hätten die kandierten Zellen nicht so einen faserigen Überzug und diese bittere Würze.
Nach fünfhundert Millionen Jahren Landleben sind die Moose erfahrene Choreografen, die Wasser und Chemie vollkommen beherrschen. Das saftige, dichte Moos auf den Mandalafelsen beweist, welche Vorteile es hat, wenn der Körper flexibel und die Physiologie flink ist. Bäume, Büsche und Krautpflanzen der Umgebung liegen noch in Winters Ketten, doch die Moose wachsen frank und frei. Die Bäume können sich das frühe Tauwetter nicht zunutze machen. Später, im Sommer, dreht sich der Spieß dann um: Dann beherrschen die Bäume dank ihrer Wurzeln und inneren Leitungssysteme das Mandala und beschatten die wurzellosen Moose. Doch momentan hat die Bäume ihre ungeschlachte Größe gelähmt.
Doch der spätwinterliche Eifer der Moose ist nicht nur für sie selbst von Nutzen. Auch das Leben unterhalb des Mandalas profitiert vom wasserliebenden Moos. Obwohl der Starkregen den Hang mit seiner kinetischen Energie durchwühlt, ist das aus dem Mandala strömende Wasser glasklar. Es zeigt nicht einen Anflug von dem Schlamm oder Schlick, die aus den Feldern und Städten der Umgebung sickern. Die Moospflanzen und die dicke Laubschicht saugen die Feuchtigkeit auf, verzögern die erodierende Kraft der Regentropfen und verwandeln den Artillerieangriff auf den Waldboden in eine Liebkosung. Wenn das Regenwasser bergab fließt, wird der Boden durch ein kunstvolles Gewebe aus Kraut, Buschwerk und Baumwurzeln am Platz gehalten. Hunderte Arten arbeiten an diesem Webstuhl zusammen, durchdringen sich mit Kette und Schuss und lassen einen robusten, faserreichen Stoff entstehen, der auch bei Regen nicht reißt. Junge Weizenfelder und Vorstadtgärten mit englischem Rasen haben dagegen nur wenige, locker verwobene Wurzeln, die den Boden nicht halten.
Der Beitrag der Moose erschöpft sich aber nicht darin, eine erste Verteidigungslinie gegen die Erosionskraft des Wassers zu bilden. Weil Moose keine Wurzeln besitzen, absorbieren sie Wasser und Nährstoffe aus der Luft. Ihre rauen Oberflächen sind optimale Staubfänger und erhaschen, sobald ein Lüftchen weht, eine gesunde Dosis Mineralstoffe. Wenn der Wind saure Autoabgase oder giftige Metalle aus Kraftwerken herüberträgt, empfangen die Moose den Müll mit offenen Armen und nehmen die Umweltverschmutzung wohlwollend auf. Die Moose im Mandala reinigen den Regen von Industrierückständen: Sie umklammern die Schwermetalle aus Auspuffrohren und halten den Rauch der Kohlekraftwerke fest.
Wenn der Regen weiterzieht, halten die vollgesogenen Moospflanzen das Wasser zurück und geben es nur nach und nach frei. Die Wälder hegen und pflegen die Natur: Sie bewahren die Flüsse vor plötzlich anschwellenden Schlammfluten und sorgen in Trockenzeiten dafür, dass das Wasser weiterhin strömt. Wenn das Wasser der feuchten Wälder verdunstet, entstehen regennasse Wolken, und wenn der Wald groß genug ist, erzeugt er sogar seinen eigenen Regen. Wir nehmen dieses Geschenk des Waldes gewöhnlich hin, ohne auch nur einen Gedanken an unsere Abhängigkeit davon zu verschwenden; nur ab und zu reißen uns wirtschaftliche Überlegungen aus dem Dämmerschlaf. So entschied sich New York dafür, lieber die Catskill Mountains zu schützen, als eine menschengemachte Trinkwasseraufbereitungsanlage zu finanzieren. Millionen moosiger Mandalas in den Catskills waren günstiger als die technische Lösung. Und in Costa Rica gibt es Wassereinzugsgebiete, in denen die Wassernutzer am Unterlauf die Waldbesitzer am Oberlauf für den Service bezahlen, den sie mit ihrem bewaldeten Land leisten. Der menschliche Wirtschaftskreislauf orientiert sich dabei an den Realitäten des Naturkreislaufs und senkt so den Anreiz, den Wald abzuholzen.
Im Mandala knattert und prasselt der Regen weiter. Von meinem Sitzplatz aus höre ich zwei brüllende Bäche. Sie liegen zu beiden Seiten des Mandalas, ungefähr hundert Meter entfernt. Die Regenmassen haben die rieselnden Bächlein in donnernde Strudel verwandelt. Nachdem ich eine Stunde oder mehr in regenfester Kleidung ausgeharrt habe, bedrückt mich langsam das endlose Getöse. Doch das Moos fühlt sich offensichtlich mehr zu Hause denn je. Nach fünfhundert Millionen Jahren Evolution ist es für regennasse Tage bestens gerüstet.