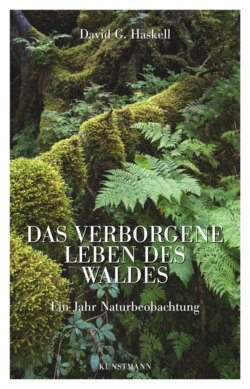Читать книгу Das verborgene Leben des Waldes - David G. Haskell - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13. MÄRZ Leberblümchen
ОглавлениеES WAR DIE GANZE WOCHE WARM, ein überraschender, aber willkommener Vorgeschmack auf den Mai. Die ersten Frühlingsblumen haben den Wandel bemerkt und drücken nun von unten gegen den Laubboden. Die einst ebene, tote Blätterschicht hat Buckel bekommen, wo sich Stängel und Blütenknospen nach oben kämpfen.
Auf dem Weg zum Mandala ziehe ich die Schuhe aus, gehe barfuß vorsichtig über den ausgetretenen Wanderpfad und spüre die angenehme Wärme des Bodens. Es ist nicht mehr so beißend kalt. Als ich durch die graue Morgendämmerung laufe, jubilieren die Vögel. Phoebetyrannen schnarren vom steinigen Hang, Meisen zwitschern auf niedrigen Ästen, und von den hohen Bäumen unterhalb des Pfads klingt das Trommeln der Spechte herüber.
Am Mandala hat eine Blütenknopse, ein Leberblümchen, endlich den Weg durch die Laubschicht gefunden; die Knospe sitzt nun auf einem fingerlangen Stiel. Vor einer Woche noch war die Knospe eine schmale Kralle, mit silbernem Flaum. Langsam hat sich die Kralle gefüllt, mit zunehmenden Temperaturen wurde sie dicker und länger. Der Stiel ist an diesem Morgen ein elegantes Fragezeichen: das untere Ende im Boden versteckt, am oberen Ende hängt die verschlossene Blüte. Verschämt blickt sie zu Boden, die Kelchblätter zum Schutz vor nächtlichen Pollendieben geschlossen.
Eine Stunde nach Tagesanbruch bricht die Knospe auf. Die drei Kelchblätter öffnen sich und geben den Blick auf die Ränder dreier weiterer frei. Die Kelchblätter sind violett gefärbt. Hepatica, das Leberblümchen, besitzt keine echten Blütenblätter, doch die Kelchblätter haben dieselbe Form und Funktion: Sie schützen nachts die Blüte und locken tagsüber Insekten an. Die sich öffnende Blüte bewegt sich für meine Augen zu langsam, ich kann die Bewegung nicht unmittelbar mitverfolgen. Nur wenn ich weg- und nach einer Weile wieder hinschaue, nehme ich eine Veränderung wahr. Ich versuche, ruhig zu atmen, in Pflanzengeschwindigkeit, doch mein Gehirn ist zu geschwind: Die langsame, anmutige Bewegung entgeht mir.
Eine weitere Stunde vergeht, und der Stiel streckt sich. Das Fragehat sich in ein Ausrufezeichen verwandelt. Die Kelchblätter sind nun weit geöffnet, leuchtend violett recken sie sich der Welt entgegen, um Bienen anzulocken, die die Strandlookfrisur der Staubbeutel in ihrer Mitte erforschen. Nach einer weiteren Stunde wirkt das Ausrufezeichen wie flüchtig hingeworfen: Leicht rückwärts geneigt, hebt es das Blütenantlitz mir entgegen. Es ist die erste Mandalablüte in diesem Jahr. Die heitere, himmelwärts gerichtete Haltung des Blütenstiels scheint mir sehr passend, um den Frühling einzuläuten und zu feiern.
Der Name der Pflanze, Leberblümchen oder lateinisch Hepatica, hat eine lange Geschichte: Er geht auf eine nahe gleichnamige westeuropäische Verwandte zurück, die seit mindestens zweitausend Jahren in der Pflanzenmedizin eingesetzt wird. Der Name verweist auf ihre Heilkraft, die ihr aufgrund ihrer dreilappigen, leberförmigen Blätter zugeschrieben wurde.
Die meisten Kulturen unserer Welt leiten aus der Form von Pflanzen gern heilende Wirkungen ab – und daraus den Pflanzennamen. In der westlichen Welt wurde diese Sitte sogar von einem merkwürdigen Gelehrten in ein theologisches System gegossen. Ein deutscher Schuster, Jakob Böhme, hatte verblüffende Visionen, die ihm etwas über die Beziehung zwischen Gott und der Schöpfung verrieten. Durch ihre stille Größe und herzzerreißende Einfalt entriss ihn seine Offenbarung dem Schusterhandwerk und drückte ihm die Feder in die Hand. Heraus kam ein Buch, strömende Worte, mit denen er seine wortlosen Visionen zu schildern versuchte. Böhme glaubte, dass sich die göttliche Schöpfungsabsicht in der Form der Weltendinge offenbare. Die Metaphysik war den Dingen eingeschrieben. Er schrieb: »Und ist kein Ding in der Natur, es offenbart seine innerliche Gestalt nicht auch äußerlich, denn das Innerliche arbeitet stets zur Offenbarung … und verwirklicht, wozu es gut und nützlich ist.« Der unvollkommene, sterbliche Mensch könne also aus der äußeren Erscheinung der Welt ihren Zweck ableiten und in Form, Farbe und Gesetz der Schöpfung den göttlichen Gedanken erkennen.
Nach der Veröffentlichung seines Werks wurde Böhme aus seiner Heimatstadt Görlitz verbannt. Kirche und Stadtrat wollten verbotene mystische Erfahrungen nicht tolerieren. Schuster, so ihre Meinung, sollten bei ihrem Leisten bleiben und Visionen den Belesenen und Begüterten überlassen. Später durfte Böhme unter der Bedingung zurückkehren, sich der Feder und des Papiers zu enthalten. Er kämpfte und scheiterte. Die Vehemenz seiner Visionen ließ ihn nach Prag fliehen, wo er weitere theologische Betrachtungen verfasste.
Böhmes Vorstellungen fanden erst wirklich Verbreitung, als Pflanzenheilkundler sein Werk für sich entdeckten. Die Lehre war gut fürs Geschäft, weil sie ein theologisches Schaufenster bot, in das man die Heilmittel stellen konnte. Viele Ärzte verwendeten die äußere Pflanzenform zudem bereits als Eselsbrücke, mit der man sich die Heilwirkung von Pflanzen leichter merken konnte: der scharlachrote Saft der Blutwurz für Blutkrankheiten, die gezahnten Blätter und weißen Blütenblätter der Zahnwurz für Zahnbeschwerden, die gewundenen Blätter der Schlangenwurz für Schlangenbisse und so weiter. Nun besaßen die Heiler eine Theorie, die ihre Behandlungsmethoden systematisierte und rechtfertigte. In Form, Farbe und Wuchs der Pflanzen offenbarten sich gottgewollte Heilkräfte. Duftende, dekorative Apfelblüten konnten Fruchtbarkeits- und Hautprobleme heilen, rote, scharfe Pflanzen, die Blut und Wut verrieten, Kreislauf und Geist anregen. Die dreilappigen violetten Leberblümchenblätter dagegen trugen das Zeichen der Leber.
Die Verwendung äußerer Anzeichen zur Herleitung der chemischen und heilenden Wirkstoffe von Pflanzen nannte man Signaturenlehre. Sie verbreitete sich in ganz Europa und stieß schließlich auch bei der wissenschaftlichen Elite auf Interesse. Sie bemühte sich, die Lehre der Heilkundler aus dem Dunstkreis der Volkskunst zu holen und der damals modernen astrologischen Wissenschaft zuzuschlagen. Die Signatur einer jeden Pflanze, so sagten die Wissenschaftler, reflektiere Gottes Absicht, allerdings über den Umweg einer komplexen Kosmologie aus Planeten, Monden und Sonne. Die Apfelblüte etwa, mit ihrer Schönheit und Heilkraft, stehe unter dem Einfluss von Venus. Jupiter regiere alle Leberpflanzen, und Mars sei der Herrscher über den kriegerisch gesinnten Pfeffer. Für eine korrekte Diagnose und Behandlung sei es daher erforderlich, dass ein qualifizierter Wissenschaftler ein Horoskop ausarbeitet und ein Heilmittel austüftelt, das das ebenso tiefgründige wie teure Wissen von Himmelssphären und ihrem Einfluss auf Pflanzen und menschliche Körper berücksichtigt. Das wissenschaftliche Establishment wetterte gegen die Quacksalberei einfältiger Heiler vom Lande, während es zugleich die Heilpflanzen der Quacksalber enteignete und in die moderne astrologische Medizin überführte.
Das gespannte Verhältnis zwischen medizinischem Establishment und Quacksalbern dauert bis heute an, klar. Die astrologische Signaturenlehre findet kaum noch Befürworter. Unsere Ärzte glauben nicht mehr, dass uns die göttliche Fügung medizinische Ratschläge in Form von Blättern und Sternbildern erteilt. Trotzdem sollten wir die Signaturenlehre nicht voreilig als belanglosen Aberglauben abtun. Als Methode zur kulturellen Weitergabe medizinischen Wissens war sie eine machtvolle Ordnungshilfe – manchmal vielleicht aussagekräftiger und kohärenter als viele Gedächtnishilfen, mit denen Ärzte heute versuchen, sich im modernen Wissenswust zu orientieren. Die Methode gab den oft des Lesens unkundigen Heilern Tipps, durch die sie eine Verbindung zwischen den Symptomen eines Patienten und den oft rätselhaften Details der Pflanzenbestimmung und Medizin herstellen konnten. Nicht weil unsere Vorfahren so einfältig gewesen wären, konnte sich die Signaturenlehre so lange halten, sondern weil sie so überaus nützlich war.
Der Name Leberblümchen zeugt von der Neigung unseres Kulturkreises, Pflanzen nach ihrem Nutzen zu benennen. Eine solche Namensgebung gemahnt uns daran, dass wir auf Pflanzen angewiesen sind: als Nahrung und Medizin. Nutzenorientierte Namen können einem wahren Naturerleben aber auch im Wege stehen. So weist beispielsweise die Teleologie unserer Nomenklatur in die falsche Richtung. Denn das Dasein des Leberblümchens dient nicht unserem Zweck: Die Pflanze hat ihre eigene Geschichte, die – in den europäischen und nordamerikanischen Wäldern – längst begonnen hatte, als der erste Mensch Jahrmillionen später die Erde betrat. Unsere Namensgebung zwingt der Natur zudem klare, eindeutige Kategorien auf, die den komplexen Abstammungslinien des Lebens und dem reproduktiven Austausch nur mangelhaft gerecht werden. Die moderne Genetik lässt jedenfalls vermuten, dass die Grenzen der Natur durchlässiger sind, als wir meinen, wenn wir vermeintlich »getrennte« Arten benennen.
An diesem heiteren Vorfrühlingsmorgen erinnert mich die Zuversicht, mit der das Leberblümchen die ersten warmen Sonnenstrahlen und die summenden Bienen begrüßt, wieder daran, dass das Leben im Mandala auch unabhängig von menschlichen Lehrmeinungen existiert. Wie alle Menschen bin ich von meiner Kultur geprägt: Ich sehe die Blüte nur bruchstückhaft, mein Blickfeld ist durch Jahrhunderte menschlicher Worte verstellt.