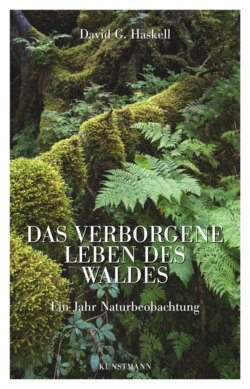Читать книгу Das verborgene Leben des Waldes - David G. Haskell - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
21. JANUAR Das Experiment
ОглавлениеEISIGER WIND PEITSCHT ÜBER das Mandala, dringt durch meinen Schal, am Kiefer spüre ich einen stechenden Schmerz. Es ist windig und zwanzig Grad unter null. Solche Temperaturen sind in den süd lichen Wäldern der USA ungewöhnlich. Im Winter wechseln sich hier meistens Tauwetter und leichter Frost ab, nur wenige Tage im Jahr sinkt die Temperatur tiefer. Die derzeitige Kälte bringt das Leben im Mandala an seine physischen Grenzen.
Ich möchte die Kälte spüren wie die Tiere im Wald, ohne schützende Kleidung. Aus einer Laune heraus werfe ich Handschuhe und Mütze auf den gefrorenen Boden, lasse den Schal folgen. Dann ziehe ich blitzschnell den kälteisolierenden Overall sowie Hemd, T-Shirt und Hose aus.
Die ersten zwei Sekunden ist das Experiment überraschend erfrischend; ohne die stickige Kleidung ist es angenehm kühl. Doch dann fegt der Wind alle Illusionen hinweg, und mein Kopf ist schmerzbenebelt. Die Wärme strömt aus meinem Körper, meine Haut brennt.
Ein Carolinameisenchor liefert die Begleitmusik zu meinem grotesken Striptease. Die Vögel tanzen wie Funken durch die Bäume, huschen durch die Zweige. Sie verharren nirgends länger als eine Sekunde, dann zischen sie davon. Dass die Meisen so lebhaft sind, ich aber in der Kälte physisch versage, scheint den Naturgesetzen zu widersprechen. Kleine Tiere sollten mit der Kälte schlechter zurechtkommen als ihre großen Verwandten! Das Volumen von Objekten, auch von tierischen Körpern, nimmt mit der Objektlänge kubisch zu. Und da sich die Wärmemenge, die ein Tier erzeugen kann, proportional zum Körpervolumen verhält, erhöht sich die erzeugte Wärmemenge mit der Körpergröße kubisch. Die Oberfläche, über die Wärme verloren geht, wächst dagegen mit zunehmender Länge nur im Quadrat. Kleine Tiere kühlen schneller aus, weil ihr Körper im Verhältnis viel mehr Oberfläche als Volumen besitzt.
Das Verhältnis zwischen Größe und Wärmeverlust eines Tiers hat bestimmte geografische Gesetzmäßigkeiten in puncto Körpergröße hervorgebracht. Wenn eine Tierart weite Landstriche besiedelt, sind ihre nördlichen Vertreter gewöhnlich größer als ihre südlichen. Das nennt man – nach dem Anatom, der das Phänomen im 19. Jahrhundert zuerst beschrieb – die Bergmann’sche Regel. So sind die Carolina meisen in Tennessee, die im äußersten Norden ihres Verbreitungsgebiets leben, zehn bis zwanzig Prozent größer als die Exemplare in Florida, im südlichsten Verbreitungsgebiet. Bei den Vögeln in Tennessee hat sich das Verhältnis zwischen Körperoberfläche und Körpervolumen verschoben, um die Anpassung an den kalten Winter zu verbessern. Noch weiter im Norden nimmt dann eine enge Verwandte, die Schwarzkopfmeise, den Platz der Carolinameise ein: Sie ist noch einmal zehn Prozent größer.
Die Bergmann’sche Regel scheint mir ziemlich fern, als ich nackt im Wald stehe. Es geht ein scharfer Wind, und das Brennen auf der Haut verstärkt sich rasch. Dann spüre ich plötzlich einen tiefer gehenden Schmerz. Irgendetwas außerhalb meines Bewusstseins sitzt in der Falle und schlägt Alarm. Nach nur einer Minute in winterlicher Kälte hat mein Körper vollständig versagt. Dabei wiege ich zehntausend Mal mehr als eine Meise. Eigentlich müssten diese Vögel in Sekundenschnelle tot sein.
Ihr Überleben verdanken die Meisen zum Teil ihrem kälteisolierenden Gefieder, das ihnen gegenüber meiner nackten Haut einen klaren Vorteil verschafft. Ihr glattes, oberes Federkleid wird durch versteckte Daunenfedern aufgebauscht. Daunenfedern bestehen aus Tausenden dünner Proteinstränge. Die winzigen Härchen bilden einen federleichten Flaum, der Wärme zehn Mal besser speichert als ein Styroporbecher. Im Winter verdoppeln die Vögel die Zahl ihrer Federn und verbessern so die Isolierfähigkeit ihres Gefieders. An kalten Tagen spannen Vögel zudem die Muskeln unter dem Gefieder an, sie plustern sich auf, sodass ihre Isolierung doppelt so dick wird. Doch auch ihr eindrucksvoller Kälteschutz kann das Unvermeidliche nur ein wenig hinausschieben. Die Haut der Meisen brennt nicht wie meine in der Kälte, gibt aber trotzdem Wärme ab. Ein oder zwei Zentimeter Daunengepluster zögern den Kältetod höchstens ein paar Stunden hinaus.
Ich lehne mich in den Wind. Das Gefühl der Bedrohung wächst. Mein Körper zuckt und zittert unkontrollierbar.
Die chemischen Reaktionen, mit denen ich normalerweise Wärme erzeuge, erweisen sich als vollkommen unzureichend, und die anfallsartigen Muskelzuckungen sind der letzte Versuch, das Absinken der Kerntemperatur noch aufzuhalten. Meine Muskeln feuern scheinbar wahllos, ziehen sich gegenseitig zusammen, ich schlottere am ganzen Körper. Im Muskelinneren werden Nahrungsmoleküle und Sauerstoff verbrannt, als würde ich laufen oder schwer heben, doch die Verbrennung erzeugt jetzt einen Wärmerausch: Durch das zwanghafte Schlottern in Beinen, Brust und Armen wird das Blut erwärmt und die Wärme zum Gehirn und Herzen transportiert.
Zittern ist auch die wichtigste Strategie, mit der sich Meisen gegen Kälte verteidigen. Im Winter nutzen die Vögel ihre Muskeln als Wärmepumpen. Wenn sie in der Kälte nicht aktiv sind, erzittern ihre Muskeln. Ihre wichtigste Wärmequelle sind dabei Flugmuskelpakete in der Brust. Die Flugmuskeln machen ungefähr ein Viertel des Meisengewichts aus; wenn sie zittern, wird also warmes Blut in Hülle und Fülle erzeugt. Menschen besitzen keine vergleichbar großen Muskeln, unser Zittern und Bibbern fällt daher eher bescheiden aus.
Als ich so zitternd dastehe, steigt Angst in mir auf. Ich gerate in Panik und kleide mich so schnell wie möglich an. Meine Hände sind klamm, nur mit Mühe halten meine Finger die Kleidung, ich friemele an Reißverschlüssen und Knöpfen herum. Mein Kopf schmerzt, als hätte ich unversehens Bluthochdruck. Ich verspüre nur einen Wunsch: mich zu bewegen. Ich renne, springe und rudere mit den Armen. Mein Gehirn signalisiert mir: Sorg für Wärme, aber schnell.
Das Experiment war nach einer Minute beendet; das entspricht etwa einem Zehntausendstel der Zeit, die diese arktische Woche dauert. Dennoch, mein Körper ist aus dem Takt. Mein Kopf hämmert, meine Lungen lechzen nach Luft, meine Gliedmaßen sind förmlich gelähmt. Wenige Minuten später wäre mein Körper unterkühlt gewesen, jede noch so flüchtige Muskelkoordination vergeblich; Benommenheit und Halluzinationen hätten von mir Besitz ergriffen. Normalerweise hält der menschliche Körper eine Temperatur von ungefähr siebenunddreißig Grad Celsius aufrecht. Wenn die Körperkerntemperatur nur um ein wenig, auf vierunddreißig Grad sinkt, kommt es zu geistiger Verwirrung. Bei dreißig Grad schalten sich die ersten Organe ab. Damit die Temperatur so weit abfällt, muss man bei eisigem Wind wie heute nur eine Stunde nackt der Kälte ausgesetzt sein. Meiner klugen kulturellen Kälteanpassung entkleidet, entpuppe ich mich als tropischer Affe, der im Winterwald vollkommen fehl am Platz ist. Die mühelose Überlegenheit der Meisen ist geradezu demütigend.
Nachdem ich fünf Minuten lang Arme und Beine wie der Teufel bewegt habe, verkrieche ich mich noch tiefer in meine Kleidung: Ich fröstele noch, bin aber nicht mehr in Panik. Meine Muskeln sind ermüdet, ich fühle mich erschöpft wie nach einem Sprint. Erst jetzt spüre ich, welche Strapaze die Wärmeerzeugung für meinen Körper bedeutet. Wenn ein Tier länger als ein paar Minuten zittert, können seine Energiereserven schnell verbraucht sein. Darum ist Hunger bei Forschern der Spezies Mensch und wilden Tieren häufig ein Vorbote des Todes. Solange wir genügend Nahrungsvorräte besitzen, können wir uns zitternd und bibbernd am Leben erhalten, doch mit leerem Magen und verbrauchten Fettreserven gibt es keine Rettung mehr.
Ich kann meine Reserven wieder auffüllen, wenn ich in meiner warmen Küche bin, wo ich dem Winter dank Nahrungskonservierungs- und Transporttechnologien erfolgreich trotze. Doch Meisen verfügen weder über Trockengetreide noch Nutztierhaltung oder importiertes Gemüse. Wenn sie im Winter überleben wollen, müssen sie genügend Futter finden, um ihren Minibrennofen in Gang zu halten.
Der Energieverbrauch von Meisen wurde im Labor und bei frei lebenden Vögeln gemessen. An einem Wintertag wie diesem brauchen Vögel fünfzehntausend Kilokalorien, um sich am Leben zu erhalten. Die Hälfte der benötigten Energie fällt für das Zittern an. Die abstrakten Zahlen werden ein wenig konkreter, wenn wir sie in die Währung »Vogelnahrung« umrechnen. Eine Spinne, so groß wie ein Komma auf dieser Seite, enthält gerade einmal 0,25 Kilokalorien. Eine Spinne in Großbuchstabengröße entspricht fünfundzwanzig Kilokalorien und ein wortgroßer Käfer 60 Kilokalorien. Ein öliger Sonnenblumenkern hat fast zweihundertfünfzig Kalorien, doch die Vögel hier müssen ohne körnergefüllte Futterspender auskommen. Um ihren Energiebedarf zu decken, müssen die Meisen täglich Hunderte von Futterbröckchen finden. Aber in der Mandalaspeisekammer herrscht Ödnis und Leere. Ich sehe im frostgeplagten Wald keine Käfer, Spinnen oder anderes Essbares.
Meisen können dem scheinbar wertlosen Wald noch Nährstoffe abgewinnen, vor allem, weil sie hervorragend sehen. Auf der Netzhaut ihrer Augen sind die Rezeptoren doppelt so dicht gepackt wie meine. Vögel sehen schärfer und detaillierter als ich. Wo ich die glatte Oberfläche eines Zweiges erblicke, sehen sie Risse und raue Zerklüftungen, in denen sich möglicherweise Nahrung verbirgt. Viele Insekten überwintern in winzigen Rindenritzen, aber Meisen stöbern die Insektenverstecke mit scharfem Blick auf. Den Reichtum ihrer visuellen Welt zu erleben ist uns verwehrt, doch wenn wir durch eine Lupe schauen, erhalten wir eine kleine Vorstellung davon: Details, die sonst unsichtbar sind, geraten plötzlich in den Blick. Ihre Wintertage verbringen Meisen großteils damit, ihren messerscharfen Blick über Zweige, Stämme und Laubboden schweifen zu lassen und Futterverstecke aufzuspüren.
Meisen sehen zudem mehr Farben als ich. Wenn ich das Mandala betrachte, müssen meine Augen mit drei Farbrezeptoren, den Zapfen, auskommen, mit denen ich drei Primärfarben und vier Hauptkombinationen der Primärfarben erkenne. Meisen besitzen einen zusätzlichen Zapfen für ultraviolettes Licht. Sie sehen vier Primärfarben und elf Hauptkombinationen, und ihr sichtbares Spektrum ist damit wesentlich größer als alles, was wir sehen oder uns auch nur vorstellen können. Die Zapfen der Vögel sind zudem mit farbigen Öltröpfchen ausgestattet, die als Lichtfilter fungieren und dafür sorgen, dass jeder Zapfen nur von einem schmalen Farbspektrum stimuliert wird. Ihr Farbsehen ist daher präziser. Wir besitzen keine derartigen Filter, daher sehen Vögel auch in unserem sichtbaren Lichtspektrum Farbnuancen, die uns verborgen bleiben. Die Meisen leben in einer farbenprächtigen Hyperrealität, zu der unsere trüben Augen keinen Zugang haben. Und hier im Mandala nutzen sie ihre Fähigkeiten zur Futtersuche. Die spärlichen vertrockneten Beeren, die hie und da auf dem Waldboden liegen, reflektieren das ultraviolette Licht, und auch die Flügel mancher Käfer und Nachtfalter oder manche Raupen sind ultraviolett gefärbt. Doch die Vögel würden Insekten auch enttarnen, ohne ultraviolett zu sehen, weil sie durch ihr präzises Farbsehen noch geringste Unregelmäßigkeiten aufspüren.
Das Sehvermögen von Vögeln und Säugetieren hat sich bereits in der Jurazeit, vor hundertfünfzig Millionen Jahren auseinanderentwickelt. Damals spaltete sich die Abstammungslinie, die die neuzeitlichen Vögel hervorbrachte, von den Reptilien ab. Und die urzeitlichen Vögel erbten dabei von ihren Vorfahren, den Reptilien, vier Zapfen. Auch die Säugetiere haben sich aus den Reptilien entwickelt, aber ihre Linie spaltete sich früher ab als die der Vögel. Anders als Vögel verbrachten unsere Vorfahren, die Proto-Säugetiere, das Jurazeitalter als nachtaktive, spitzmausähnliche Geschöpfe – und die natürliche Zuchtwahl mit ihrem kurzsichtigen Nützlichkeitsgedanken hielt prächtige Farben bei solchen Nachtgeschöpfen offenbar für überflüssig. Zwei der vier Zapfen, die die Säugetiere von ihren Vorfahren geerbt hatten, gingen verloren: Die meisten Säugetiere besitzen bis heute nur zwei Zapfen. Lediglich einige Primaten, darunter unsere Ahnen, entwickelten später einen dritten.
Die Carolinameisen können ihr gutes Sehvermögen auch dank körperlicher Geschicklichkeit hervorragend nutzen. Mit einem einzigen Flügelschlag huscht ein Vogel von einem Ast zum nächsten. Füße umkrallen einen Zweig, schon lässt sich der Vogel fallen und hängt schaukelnd am Astende. Der Schnabel pickt, der Körper, noch immer kopfüber, dreht sich dahin und dorthin, dann öffnen sich blitzschnell die Flügel, und der Vogel fliegt zum nächsten Zweig. Nirgendwo bleibt etwas ungeprüft. Die Vögel verbringen genauso viel Zeit kopfüber und spähen unter Zweige, wie sie auf den Zweigen sitzen.
Doch trotz engagierter Suche finden die Meisen keine Beute, solange ich sie beobachte. Wie die meisten Vögel rucken Meisen beim Schlucken auffällig mit dem Köpfchen oder krallen größere Beute mit den Füßen fest, wenn sie sie mit dem Schnabel zerhacken. Der Schwarm bleibt ungefähr eine Viertelstunde in Sichtweite, ohne Nahrung zu finden. Die Meisen werden wohl auf ihre Fettreserven zurückgreifen müssen, um die Kälte zu überstehen. Im Winter sind Fettreserven lebenswichtig, und sie erlauben den Meisen zudem, die wechselhafte Winterwitterung für sich zu nutzen. Wenn es ein wenig wärmer wird oder sie ganzen Spinnenhaufen oder Beerenbüscheln begegnen, wird aus der Futterflut ein Fettpolster, das sie durch kältere und kargere Winterzeiten bringt.
Die einzelnen Meisen besitzen unterschiedlich dicke Fettpolster. Meisen gehen in hierarchischen Schwärmen auf Futtersuche, zu denen normalerweise ein dominantes Paar und mehrere Rangniedere gehören. Die dominanten Vögel können von allem fressen, was der Schwarm findet, sind also allgemein bei jeder Witterung gut genährt. Herrschermeisen besitzen einen gepflegten Körper. Niedere Vögel dagegen bekommen die volle Härte des Winters zu spüren, sie können nur zeitweilig gut fressen. Die rangniederen Vögel, häufig Jungtiere oder erfolglose Brüter, kompensieren die unregelmäßige Nahrungsaufnahme durch Fettpolster: ihre Versicherung für magere Zeiten. Doch Fettpolster haben ihren Preis. Rundliche Vögel werden leichter zur Beute von Habichten. Das Fettpolster einer Meise ist also eine reine Abwägungssache: zwischen der Bedrohung durch Hunger und der Bedrohung durch Fressfeinde.
Meisen runden ihr Fettpolster zudem durch Insekten und Körner ab, die sie als Vorrat unter Rindenschuppen stopfen. Die Carolinameisen verstecken ihr Futter gern in den Unterseiten dünner Äste, vermutlich um es vor diebischen, aber weniger wendigen Vogelarten zu schützen. Dennoch sind ihre Verstecke vor Plünderern nicht sicher, weshalb die Meisenschwärme im Wald ihr Winterrevier rigoros gegen Eindringlinge verteidigen. In anderen Gegenden der Welt leben Meisen, die keine Vorräte anlegen, längst nicht so territorial gebunden.
Im Winter gesellen sich zu den Schwärmen der Carolinameisen häufig größere Vogelarten. Heute sucht ein Dunenspecht erst trommelnd nach Larven im Eichenstamm, dann schließt er sich den Meisen an und saust mit ihnen ostwärts. Auch eine Indianermeise fliegt dem Schwarm hinterher. Indianermeisen schwirren wie Carolinameisen durch die Zweige, sind dabei aber weniger geschickt: Sie hocken vor allem auf den Zweigen und hängen nicht kopfüber. Alle Vögel im Schwarm rufen unentwegt, um den Trupp zusammenzuhalten. Carolina- und Indianermeisen pfeifen und zwitschern, der Specht lässt hohe pik-Laute ertönen. Im Schwarm sind die Vögel besser vor Habichten geschützt: Viele Augen sehen mehr als zwei. Doch die Carolinameisen müssen für die Sicherheit in der Menge bezahlen. Die Indianermeisen sind doppelt so schwer wie sie und beherrschen das Feld: Sie schubsen die Carolinameisen von toten Ästen, hohen Zweigen und anderen beliebten Futterplätzen. Der winzige Ortswechsel verringert die Futterchancen der Carolinameisen beträchtlich. In Schwärmen ohne Indianermeisen sind Carolinameisen besser genährt. Das Überleben im Wintermandala erfordert also nicht nur exzellente körperliche Fähigkeiten, sondern auch geschickte soziale Verhandlungen.
Langsam schwindet das Tageslicht. Ich recke und strecke meine ausgekühlten Gliedmaßen, befreie meine Augen von Eiskrusten und mache mich auf den Heimweg. Die Vögel werden noch ein paar Minuten nach Futter suchen und sich dann zu ihrem Schlafplatz begeben. Wenn das Licht nachlässt und es kühler wird, sammeln sich die Carolinameisen in Astlöchern, wo sie vor der wärmezehrenden Macht des Windes geschützt sind. Dort drängen sie sich zusammen, und die einnickende Vogelkugel, mit großem Volumen und relativ kleiner Oberfläche, bestätigt die Bergmann’sche Regel. In der Nacht wird die Körpertemperatur der Meisen um zehn Grad sinken: Sie verfallen in eine energiesparende Winterstarre. Weil die Vögel Verhalten und Physiologie der Witterung angepasst haben, bieten sie dem Winter nicht nur tagsüber Paroli. Winterstarre und Vogelkugel halbieren ihren Energiebedarf in der Nacht.
Die Anpassung der Carolinameisen an die klirrende Kälte ist beeindruckend, aber dennoch nicht unbedingt ausreichend: Morgen werden weniger Meisen als heute den Wald beleben. Väterchen Frost wird zahllose Meisen hinabziehen und in eine noch erschreckendere Leere stoßen als die, die ich in der Kälte erlebt habe. Nur die Hälfte der Meisen, die im herbstlichen Blätterwald nach Futter gesucht hat, wird im Frühling die Eichenknospen aufspringen sehen. Nächte wie diese sind die Hauptursache der hohen Wintersterblichkeit der Vögel.
Die frostigen Temperaturen werden nur wenige Tage anhalten, aber die erhöhte Vogelsterblichkeit wird sich noch das ganze Jahr bemerkbar machen. Der kalte Wintertod drängt die Meisenpopulation zurück und verringert sie um alle Vögel, deren Bedarf die knappe Futterversorgung übersteigt. Jede Carolinameise benötigt zu ihrem Selbsterhalt drei und mehr Hektar Wald. Das nur ein Quadratmeter große Mandala kann also lediglich ein paar Hunderttausendstel einer Meise ernähren. Die heutige Nacht wird mit kalter Hand alle überzähligen Meisen aussortieren.
Im Sommer kann das Mandala wesentlich mehr Vögel ernähren, aber weil die Hülle und Fülle von Standvögeln wie den Carolinameisen durch die kärgliche Winternahrung ausgedünnt ist, übersteigt das sommerliche Futterangebot ihren Appetit bei Weitem. Die saisonale Futterflut machen sich die Zugvögel zunutze, wenn sie lange Flüge von Mittel- und Südamerika auf sich nehmen, um am Überfluss der nordamerikanischen Wälder teilzuhaben. Die Winterkälte ist somit für den jährlichen Vogelzug von Millionen von Tangaren, Waldsängern und Vireos verantwortlich.
Der nächtliche Tod fördert außerdem die Feinanpassung der Carolinameisen an ihre Umwelt: Kleine Carolinameisen sterben eher als rundlichere Familienangehörige, wodurch sich das Bergmann’sche Breitengradmuster verstärkt. Extreme Kälte sortiert ferner alle Vögel einer Population aus, deren Zittern, Federflaum oder Energiereserven mangelhaft sind. Am nächsten Morgen wird die Meisenpopulation im Wald noch besser an die winterlichen Bedingungen angepasst sein. Das ist das Paradox der natürlichen Selektion: Das zunehmend perfektere Leben erwächst aus dem Tod.
Meine eigene Unzulänglichkeit bei Kälte hat ihren Grund ebenfalls in der natürlichen Selektion. Ich bin im Schneemandala fehl am Platz, weil meine Vorfahren, was Kälte und Abhärtung betraf, einen großen Bogen um die Selektion gemacht haben. Der Mensch stammt bekanntlich vom Affen ab – der Aberdutzende Jahrmillionen im tropischen Afrika lebte. Und da dort die größere Herausforderung darin bestand, den Körper kühl zu halten, besitzt unser Körper wenig, was ihn vor Kälte schützen könnte. Als meine Vorfahren Afrika verließen und nach Nordeuropa einwanderten, hatten sie Feuer und Kleidung dabei: Sie versetzten die Tropen einfach in die gemäßigten Zonen und Polargebiete. Durch ihr kluges Vorgehen konnten sie viel Leid und Tod verhindern – zweifellos ein wünschenswerter Erfolg. Doch der Komfort schlug der natürlichen Selektion ein Schnippchen. Feuer und Kleidung haben uns auf ewig dazu verdammt, in der Welt des Winters fehl am Platz zu sein.
Es wird dunkel, ich kehre zum Erbe meiner Vorfahren, dem warmen Ofen zurück und überlasse das Mandala den Vögeln, den Meistern der Kälte. Ihre Meisterschaft haben sie auf die harte Tour gelernt: im Kampf, geführt von Tausenden von Generationen. Ich wollte die Kälte genauso erleben wie die Tiere im Mandala, muss aber einsehen, dass das nicht geht. Mein Körper hat sich evolutionär anders entwickelt als der der Meisen; dasselbe zu erleben ist uns darum verwehrt. Dennoch: Seitdem ich mich in meiner Nacktheit dem eisigen Wind ausgesetzt habe, ist meine Bewunderung für jene anderen Wesen noch gestiegen. Ich kann nur staunen.