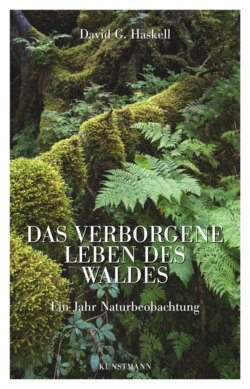Читать книгу Das verborgene Leben des Waldes - David G. Haskell - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. FEBRUAR Spuren
ОглавлениеDIE SPITZEN EINES SCHNEEBALLSTEAUCHS wurden weggemeißelt, an seinen Zweigen sitzen nur noch schräge Stummel. Doch das Tier, das die zarten Enden abgeknipst hat, hat im Mandala eine Spur hinterlassen: drei Abdrücke im Laubboden, die von Ost nach West zeigen, mit jeweils zwei mandelförmigen Vertiefungen, etwa fünf Zentimeter tief. Alles deutet auf einen Zehenspitzengänger hin, es ist ein Trittsiegel aus dem Paarhuferclan. Wie fast alle terrestrischen Gemein schaften der Welt wurde das Mandala von einem Säugetier mit gespal tenem Huf heimgesucht, in diesem Fall einem Weißwedelhirsch.
Der Hirsch, der das Mandala letzte Nacht durchquert hat, hat eine kluge Wahl getroffen. Der Ahornblättrige Schneeballstrauch hat derzeit in seinen Zweigspitzen Nahrung gelagert, als Vorbereitung auf den Frühling. Die jungen Triebe sind noch nicht hart und holzig. Der Strauch wurde also seines zarten Grüns beraubt, das verdaut und in Hirschmuskeln reinvestiert wurde – oder, falls der Knibbler eine Hirschkuh war, in das Kalb im Mutterleib.
Der Hirsch hatte Hilfe. Um die Nahrungsvorräte, die in den harten Zellen von Zweigen und Blättern eingeschlossen sind, zu plündern, müssen nämlich Groß und Klein zusammenarbeiten. Große, vielzellige Tiere können zwar Holziges knabbern und kauen, aber keine Zellulose verdauen, die Moleküle also, aus denen die meisten Pflanzen bestehen. Doch Mikroben, winzige Einzeller wie Bakterien und Protisten, sind zwar mickrig gebaut, aber dafür chemisch stark. Bei Zellulose fackeln sie nicht lange. Daraus ist eine Diebesbande entstanden: Die pflanzenzermahlenden Tiere, die durch die Gegend streunen, machen mit den Mikroben, die pulverisierte Zellulose verdauen, gemeinsame Sache. Verschiedene Tiergruppen haben dabei, völlig unabhängig voneinander, denselben Plan ausgeheckt: Die Termiten arbeiten mit den Protisten zusammen, die ihren Darm bewohnen; Kaninchen und Verwandte beherbergen in einer großen Kammer am Ende ihres Verdauungstrakts Mikroben, und der Stinkvogel, ein seltsamer blätterfressender Vogel in Südamerika, besitzt sogar einen Gärsack im Hals. Und Wiederkäuer wie Hirsche können in ihrem Spezialmagen, dem Pansen, gar auf eine ganze Wundertüte voller Helfer zählen.
Die Mikrobenpartnerschaft sorgt dafür, dass große Tiere die im Pflanzengewebe verborgenen Energielager aufschließen können. Tiere, wie auch der Mensch, die keinen Vertrag mit den Mikroben haben, sind dagegen in ihrer Nahrungsauswahl beschränkt: auf weiche Früchte, einige leicht verdauliche Samen oder Milch und Fleisch ihrer vielseitigeren tierischen Verwandten.
Die Triebe im Mandala wurden mit den unteren Zähnen und der harten oberen Gaumenplatte abgeknipst, die die oberen Vorderzähne ersetzt. Dann wurden die holzigen Happen an die hinteren Zähne weitergeschickt, zermahlen und heruntergeschluckt. Als sie schließlich im Pansen landeten, betraten sie ein neues Ökosystem, ein gewaltiges Mikroben-Schleuderfass. Der Pansen ist ein Beutel, von dem die übrigen Verdauungsorgane des Hirschs abzweigen. Sämtliche Nahrung außer der Muttermilch geht zunächst durch den Pansen, ehe sie dann den übrigen Magen und den Darm passiert. Der Pansen ist von Muskeln umgeben, die den Panseninhalt schleudern. Hautlappen im Pansen, die Zotten, arbeiten wie die Trommelrippen einer Waschmaschine: Sie wenden die Nahrung beim Schleudern hin und her.
Die meisten Mikroben im Pansen ertragen keinen Sauerstoff. Sie stammen von altertümlichen Lebewesen ab, die sich einst unter völlig anderen atmosphärischen Bedingungen entwickelten. Erst als vor ungefähr zweieinhalb Milliarden Jahren die Fotosynthese erfunden wurde, kam der Sauerstoff in die Luft unserer Erde; doch weil Sauerstoff eine gefährliche reaktive Chemikalie ist, hat diese Giftverschmutzung unseres Planeten vielen Lebewesen den Garaus gemacht – und viele andere gezwungen, sich zu verkriechen. Bis heute leben die Sauerstoffhasser in Teichgründen, Sümpfen oder tief unter der Erde, wo sie ein sauerstoffloses Dasein fristen. Andere dagegen haben sich dem neuen Umweltverschmutzer angepasst und konnten den giftigen Sauerstoff, durch ein elegantes Ausweichmanöver, zum eigenen Vorteil nutzen. So entstand die Sauerstoffatmung, ein Energie freisetzender biochemischer Trick, den auch wir übernommen haben. Unser Leben hängt also von einem urzeitlichen Luftverschmutzer ab.
Mit der Entwicklung des tierischen Darms bot sich den sauerstoffhassenden Flüchtlingen dann ein neues Versteck. Der Darm ist nicht nur relativ sauerstofffrei, sondern der Traum jeder Mikrobe: fein gemahlene Nahrung am laufenden Band. Es gab allerdings ein Problem. In Tiermägen befinden sich normalerweise saure Verdauungssäfte, die alles Leben zerstören. Die meisten Tiere konnten somit keine pflanzenverdauenden Mikroben beherbergen. Nur die Wiederkäuer veränderten, als perfekter Wirt, ihren Magen und wurden folgerichtig mit einer Vier-Sterne-Bewertung für evolutionären Erfolg belohnt. Kernstück ihrer Gastlichkeit sind Lage und Freundlichkeit des Pansens, der vor den übrigen Verdauungsorganen liegt und sich stets neutral verhält, weder sauer noch basisch. Die Mikroben blühen in diesem Schleuder-Spa geradezu auf. Der basische Speichel der Tiere neutralisiert zudem alle sauren Verdauungsprodukte. Und etwaiger Sauerstoff wird von einer kleinen Truppe von Bakterien als Zimmermädchen aufgesaugt.
Der Pansen funktioniert so gut, dass es Wissenschaftlern selbst mit den raffiniertesten Teströhren und Behältnissen nicht gelungen ist, die Wachstumsrate oder Verdauungsleistung der Pansenmikroben zu erreichen, geschweige denn zu übertreffen. Die Leistungsfähigkeit des Pansens basiert auf einer komplexen biologischen Vielfalt, die in den Verwöhnkammern prächtig gedeiht. Eine Billion Bakterien, mindestens zweihundert verschiedene Arten, schwimmen in jedem Milliliter Pansenflüssigkeit herum. Einige der Mikroben wurden bereits beschrieben, andere harren noch ihrer Beschreibung oder Entdeckung. Viele der Bakterien leben ausschließlich im Pansen, wobei sie und ihre frei lebenden Vorfahren sich in den fünfundfünfzig Millionen Jahren wohl auseinanderentwickelt haben, die seit Entstehung des Pansens vergangen sind.
Im Pansen wird das bakterielle Proletariat von einer Schar Protisten ausgebeutet, die zwar Einzeller, aber Hundert oder Tausend Mal so groß sind wie Bakterien. Die Protisten wiederum werden von schmarotzenden Pilzen befallen, die ihre großen Zellen platzen lassen. Wieder andere Pilze treiben frei in der Pansenflüssigkeit herum oder besiedeln Pflanzenkrümel. Nur dank der großen Lebensvielfalt im Pansen können alle Pflanzenreste vollständig verdaut werden. Keine Art kann eine Pflanzenzelle allein bewältigen. Jede übernimmt nur einen kleinen Teil im Gesamtprozess, spaltet ihre Lieblingsmoleküle ab, sammelt so viel Energie wie zum Wachsen nötig und gibt den Restmüll an die Pansenflüssigkeit zurück. Der Müll wird dann zur Nahrung eines anderen Lebewesens, zu einer weiteren Stufe im Demontage-Netzwerk. Die Bakterien zerstören, mithilfe einiger Pilze, den Großteil der Zellulose. Die Protisten dagegen lieben Stärkekörner; vielleicht sehen sie darin die Kartoffelbeilage ihrer Bakterienwürste. Die Nährstoffe im Pansen durchlaufen also eine Miniaturnahrungskette und werden dann an die Pansenflüssigkeit zurückgegeben – ein Abbild des Nahrungskreislaufs größerer Ökosysteme. In jedem Hirschbauch existiert ein eigenes Mandala, ein komplexer Tanz des Lebens, der von gierigen Lippen und Zähnen in Schwung gehalten wird. Junge Wiederkäuer müssen ihre Pansengemeinschaft dagegen erst entwickeln: Sie fangen bei null an und brauchen einige Wochen, bis die Gemeinschaft steht. Derweil trinken sie bei ihrer Mutter, knibbeln an Boden und Vegetation und sammeln und schlucken so die Mikroben, die später zu ihren Helfern werden.
Das Ökosystem Pansen ist ein Mandala der Selbstaufopferung, eine Verkörperung des endlosen Wandels. Die Mikroben werden schließlich mit den verdauten Pflanzenzellen aus dem Pansen befördert, gelangen in den zweiten Vormagen des Hirschs und werden dort mit Säure und Verdauungssäften überschwemmt. Die Gastlichkeit des Darms gegenüber den Mikroben hat hier ein Ende. Sie werden vom Wirt getötet und verarbeitet, wobei er alle Proteine, Vitamine und verflüssigte Pflanzenreste selber einsackt.
Der Pansen hält die festen Pflanzenteile und daran haftende Mikroben zurück und sorgt so für die vollständige Verdauung der Pflanzen, aber auch für die Fortdauer der mikrobischen Pansengemeinschaft. Der Hirsch beschleunigt dabei den Abbau der festen Stoffe, indem er sie ins Maul zurückholt, wiederkäut und die pulverisierten Reste erneut herunterschluckt. Das Wiederkäuen ermöglicht dem Hirsch, seine Nahrung wie der böse Wolf in einem Happs zu verschlingen und später an sicherem Ort zu zerkauen.
Mit den Jahreszeiten verändern sich die Pflanzenteile, nach denen Hirsche suchen. Die holzige Winternahrung wird zu Frühlingsgrün, später im Herbst dann zu Eicheln. Der Pansen reagiert auf die veränderten Nahrungsbedingungen durch steigende und sinkende Mitgliederzahlen der Pansengemeinschaft. Die Bakterien, die weiche Frühlingsblätter verdauen, verschwinden langsam, wenn sich der Winter nähert. Der Hirsch muss dazu nicht mal den Chef herauskehren, denn durch die gegenseitige Konkurrenz der Pansenbewohner passt sich die Verdauung automatisch der verfügbaren Nahrung an. Plötzliche Veränderungen können die geschmeidige Anpassung der Pansengemeinschaft an ihr Umfeld allerdings stören. Wenn ein Hirsch mitten im Winter Getreide oder frisches Grün frisst, gerät der Pansen aus dem Gleichgewicht: Es kommt zu einem unkontrollierten Säureanstieg, Gase blähen den Pansen auf. Die Magenverstimmung kann für den Hirsch tödlich enden. Die jungen Wiederkäuer, die noch an den mütterlichen Zitzen nuckeln, stehen vor ganz ähnlichen Verdauungsproblemen. Milch würde im Pansen vergären und Gase bilden, vor allem, solange der Pansen der unreifen Tiere noch nicht vollständig von Mikroben besiedelt ist. Der Saugreflex führt daher automatisch zur Eröffnung eines Nebenwegs, der den Pansen umgeht und die Milch direkt in den nächsten Vormagen leitet.
Die Natur konfrontiert Wiederkäuer selten mit raschen Nahrungsveränderungen, doch Landwirte, die ihre Kühe, Ziegen oder Schafe füttern, müssen dem Pansen Rechnung tragen. Doch dessen Bedürfnisse stimmen nicht unbedingt mit den Wünschen der menschlichen Handelsmärkte überein; der Pansen ist daher der Fluch der industriellen Landwirtschaft. Wenn die Kühe von der Weide geholt und in Mastparzellen gestellt werden, um sich mit Getreide vollzufressen, muss die Pansengemeinschaft mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Nur wenn wir die mikrobischen Helfer niederringen, können wir dem Fleisch der Kühe unseren Willen aufzwingen.
Fünfundfünfzig Millionen Jahre Pansenentwicklung gegen fünfzig Jahre industrielle Landwirtschaft: Die Sache sieht nicht gut für uns aus.
Der Hirsch im Mandala ist dezent vorgegangen. Auf den ersten Blick scheinen Sträucher und Jungpflanzen unbehelligt. Nur wenn man näher hinschaut, erkennt man die gestutzten Zweigspitzen und die verbliebenen Stummel der amputierten Seitentriebe. Insgesamt wurde ungefähr die Hälfte der ein Dutzend Strauchtriebe im Mandala gekürzt, keiner jedoch vollständig. Ich schließe daraus, dass Hirsche und ihre Mikrobenfreunde häufige Mandalabesucher sind, die Hirsche aber keine Hungerleider. Sie könnnen es sich leisten, nur die saftigen Triebspitzen abzuknabbern und die holzigen Teile stehen zu lassen. Die Weißwedelhirsche sind pingelig, ein Luxus, der in den östlichen Waldgebieten der USA stark gefährdet ist. In vielen Landstrichen, in denen Hirsche leben, waren alle Pflanzenschutzmaßnahmen umsonst: Die Hirschpopulationen haben sich rasch vermehrt, und Zähne und Pansen der wachsenden Schar haben dem Wald seine Sämlinge, Sträucher und Wildblumen geraubt.
Viele Ökologen halten die aktuelle Zunahme der Hirschpopulationen für eine amerikaweite Katastrophe. Vergleichbar vielleicht noch damit, den Pansen im Winter mit Getreide vollzustopfen. Die Gemeinschaft werde in ein unnatürliches Ungleichgewicht gestürzt. Alles spricht scheinbar gegen den Hirsch. Die Hirschzahlen steigen. Die Pflanzenpopulationen gehen zurück. Vögel, die ihre Nester in Sträucher bauen, finden keine Nistplätze mehr. Durch Zecken übertragene Krankheiten lauern in den Gärten unserer Vorstädte. Wir haben die Jäger ausgeschaltet, erst die amerikanischen Ureinwohner, dann die Wölfe, dann die modernen Jäger, die Jahr für Jahr weniger werden. Mit unseren Äckern und Städten haben wir den Wald in Streifen und Flecken geschnitten und so erst die Habitatränder geschaffen, auf denen Hirsche so gern äsen. Wir haben die Hirschpopulationen gehegt und gepflegt, seit Wildschutzgesetze die Jagdsaison auf Zeiten begrenzen, in denen die Populationen möglichst keinen Schaden nehmen. Der Wald ist sicher gefährdet?
Mag sein, doch wenn wir genauer hinschauen, wird das Schwarz-Weiß-Bild vom Hirsch in den östlichen Waldgebieten leicht unscharf. Unser kulturelles und wissenschaftliches Gedächtnis, das uns sagt, wie ein »normaler« Wald auszusehen hat, wurde in einem bestimmten historischen Moment geprägt, einem Moment, in dem erstmals seit Jahrtausenden keine Hirsche mehr im Wald lebten. Die Hirsche wurden durch die intensive kommerzielle Jagd im ausgehenden 19. Jahrhundert beinah ausgerottet. In den meisten Gegenden von Tennessee, auch in diesem Mandala, gab es keine Hirsche mehr. Von 1900 bis in die 1950er-Jahre hat kein Hirsch das Mandala besucht. Erst die Umsiedlung von Hirschen aus anderen Regionen sowie die intensive Bejagung von Rotluchs und Wildhunden führte nach und nach zu größeren Hirschpopulationen, und in den 198oer-Jahren gab es wieder reichlich Hirsche. Ähnlich verlief die Entwicklung im gesamten östlichen Waldgebiet der USA.
Die Geschichte hat unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Wald verzerrt. Die meisten wissenschaftlichen Studien über die Ökologie der östlichen Waldgebiete Nordamerikas im 20. Jahrhundert wurden in Wäldern durchgeführt, die ungewöhnlich wenig beweidet waren. Das gilt besonders für ältere Untersuchungen, die uns heute als Vergleichsmaßstab für ökologische Veränderungen dienen. Der Maßstab täuscht: Zu keinem anderen historischen Zeitpunkt fehlten im Wald Wiederkäuer und andere große Pflanzenfresser. Doch unser Gedächtnis gaukelt uns einen Wald als normal vor, der ohne große Pflanzenfresser sehr bequem vor sich hin lebt.
Aus dieser Erkenntnis ergeben sich beunruhigende Aussichten: Schon bald könnte für Wildblumen und niedrig nistende Vögel ein ungewöhnlich komfortables Zeitalter zu Ende gehen. Die »Überweidung« durch Wild könnte den Wald in seinen normalen ausgedünnten, lichten Zustand zurückverwandeln. Die überlieferten Tagebücher und Briefe der frühen europäischen Siedler sprechen jedenfalls dafür: So schrieb Thomas Harriot 1580 aus Virginia, »an manchen Orten gibt es hier sehr viel Wild«, und Thomas Ashe notierte 1682, »mit seinen vielen Herden scheint das ganze Land ein einziger Wildpark zu sein«. Und 1687 beschäftigte auch Baron de La Hanton das Thema: »Ich bin sprachlos, wie viele Hirsche und Truthähne es in den Wäldern gibt.«
Die Zeugnisse der europäischen Kolonialisten sind eindrucksvoll, aber wohl kaum eindeutig. Die Beschreibungen könnten übertrieben sein – eine klammheimliche Kampagne für das kolonialistische Projekt; außerdem betraten die Siedler einen Kontinent, dessen menschliche Bewohner, größtenteils Jäger, bereits durch Krankheit und Genozid dezimiert waren. Doch die Erzählungen der Genozidüber lebenden und archäologische Funde, die ihre Vorfahren hinterließen, deuten darauf hin, dass es sogar vor Ankunft der Europäer reichlich Wild in den Wäldern gab. So rodeten die amerikanischen Ureinwohner die Wälder, um das Wachstum von Jungpflanzen zu fördern, welche wiederum die Fruchtbarkeit des Wilds befeuerten. Hirschfleisch und -felle sicherten das Überleben der Menschen im Winter, und die Hirschgeister tanzten durch die Mythologien der ersten menschlichen Bewohner Amerikas. Historische und archäologische Daten führen somit zum selben Ergebnis: Die Hirsche bewohnten unsere Wälder in großer Zahl, ehe ihnen im 19. Jahrhundert die Gewehre den Garaus machten. Die wildfreien Wälder zu Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts waren eine Ausnahmeerscheinung.
Unsere moderne Hirschphobie erscheint noch fragwürdiger, wenn wir uns den amerikanischen Kontinent anschauen, ehe der erste Mensch einen Fuß darauf setzte. Im nordamerikanischen Osten wachsen seit fünfzig Millionen Jahren gemäßigte Wälder. Der Wald bildete einst ein dichtes Band, das sich über Asien, Nordamerika und Europa erstreckte. Als sich das Erdklima abkühlte, wurde der Streifen in Stücke geschnitten, vor allem durch mehrere Eiszeiten, die die gemäßigten Wälder erst nach Süden verschoben und dann, mit dem Zurückweichen der Gletscher, wieder nordwärts drängten. Die Reste dieser Wälder wachsen heute als Flickwerk in Ostchina, Japan, Europa, dem mexikanischen Hochland und dem nordamerikanischen Osten. Und der Tanz des gemäßigten Walds über die Kontinente kennt ein Thema ohne Variationen: Im Wald weiden Säugetiere, häufig sogar viele.
Der Hirsch, der über das Mandala lief, ist einer der letzten Ver treter eines weit umfangreicheren pflanzenverstümmelnden Bestia riums. Riesenfaultiere wälzten ihre nashorngroßen Körper durch die Wälder, um dort zu äsen. In ihrer Nähe weideten Moschusochsen, riesige pflanzenfressende Bären, langnasige Tapire, Nabelschweine, Bisons, verschiedene ausgestorbene Hirsch- und Antilopenarten und, am gefährlichsten, Mastodonten. Die Mastodonten waren Verwandte des modernen Elefanten, mit Stoßzähnen und breitem, flachem Kopf. Die beeindruckenden Tiere, mit drei Meter Schulterhöhe, ästen am nördlichen Rand der östlichen Waldgebiete und starben, wie viele andere große Pflanzenfresser, am Ende der letzten Eiszeit, vor ungefähr elftausend Jahren aus. Eiszeiten waren zuvor schon gekommen und gegangen, doch das letzte Tauwetter brachte einen neuen Räuber, den Menschen. Kurz nachdem der Mensch den amerikanischen Kontinent betreten hatte, starben die großen Pflanzenfresser aus. Die kleineren Säugetiere waren von der Ausrottungswelle kaum betroffen; es verschwanden nur die großen Geschöpfe mit reichlich Fleisch.
In den Höhlen und Sümpfen der östlichen USA finden sich in Hülle und Fülle fossile Funde der großen Pflanzenfresser. Sie befeuerten im 19. Jahrhundert die Evolutionsdebatte. Darwin erkannte in den Tieren einen weiteren Beleg dafür, dass sich die natürliche Welt fortwährend im Fluss befindet. Er stellte fest: »Man kann nicht ohne das tieffste Erstaunen über den veränderten Zustand dieses Festlandes nachdenken. Früher muss es von großen Ungeheuern voll gewesen sein, wie der südliche Theil von Afrika; jetzt finden wir nur … Pygmäen, wenn man sie mit den untergegangenen Racen vergleicht.« Thomas Jefferson widersprach ihm, er glaubte, die Riesenfaultiere und anderen Geschöpfe müssten noch irgendwo leben. Warum hätte Gott sie erst erschaffen sollen, wenn er sie dann ausradierte? Die Schöpfung war Gotteswerk und somit vollkommen: Die Natur würde ins Wanken geraten, wenn Teile wegbrächen. Jefferson gab der Lewis-und-Clark-Expedition, die in Richtung Pazifikküste unterwegs war, den Auftrag, Berichte über diese Tiere anzufertigen. Doch die Expedition fand keinerlei Spur von lebenden Mastodonten, Riesenfaultieren oder anderen ausgestorbenen Lebewesen. Darwin hatte recht: Teile der Schöpfung können zerstört werden.
Ähnlich wie die Spur, die den räubernden Hirsch im Mandala verrät, zeugt der Bau manch einheimischer Pflanze von längst ausgestorbenen Pflanzenfressern. So besitzen Lederhülsenbaum und Stech palme dornige Stämme oder Blätter, doch die Dornen enden in drei Meter Höhe, der doppelten Höhe dessen, was heutige Pflanzenfresser erreichen, aber genau in der richtigen Höhe, um ausgestorbene Megalaubfresser abzuschrecken. Der Lederhülsenbaum ist gleich doppelt vereinsamt: Seine fünfzig Zentimeter langen Hülsen sind so groß, dass keine heute lebende Art sie vollständig verspeisen und ihre Samen verbreiten kann – für die ausgestorbenen Pflanzenfresser wie Mastodonten und Riesenfaultiere dagegen hatten sie die ideale Größe. Die milchig-weißen Kugeln des Osagedorns sind ebenfalls Früchte, denen der Samenkurier abhandengekommen ist. Auf fernen Kontinenten werden ähnliche Früchte von Elefanten, Tapiren und anderen großen Pflanzenfressern verspeist, die es in Nordamerika nur noch als Fossilien gibt. Die verwitweten Pflanzen, von der Vergangenheit gezeichnet, lassen uns erahnen, wie schmerzlich der Verlust für den Wald insgesamt sein muss.
Wie die urzeitlichen Wälder wirklich aussahen, werden wir nie wissen, doch die Knochen ausgestorbener Laubäser sowie die Erzählungen der ersten Amerikaner lassen vermuten, dass Sträucher und Jungbäume kein einfaches Leben hatten. Die nordamerikanischen Wälder waren fünfzig Millionen Jahre lang ein beliebtes Weideland, dann folgten zehntausend Jahre mit drastisch reduziertem Pflanzenfresserbestand und hundert Jahre, in denen seltsamerweise niemand äste. Waren die ursprünglichen Wälder möglicherweise kahl und schütter, von Herden umherziehender Pflanzenfresser kurz gehalten? Sicher hatten die Pflanzenfresser selber Feinde, die es heute ebenfalls nicht oder so gut wie nicht mehr gibt. Säbelzahntiger und Canis dirus sind ausgestorben, Wolf, Berglöwe und Rotluchs selten geworden. Im Westen der Vereinigten Staaten jagten einst der gewaltige amerikanische Löwe und der Gepard. Doch dass es so viele große Fleischfresser gab, deutet auch auf eine stattliche Zahl von Pflanzenfressern hin. Riesige Raubkatzen und Wölfe brauchen riesige Herden. Große Fleischfresserpopulationen können nur in Gegenden überleben, die mit Laubäsern reich gesegnet sind. Das Fleisch der Karnivoren ist letztendlich nur das pflanzliche Material, das in der Nahrungskette hochgereicht wurde. Die zahlreichen Fossilienfunde großer Raubtiere sind also ein deutlicher Beleg dafür, dass die Pflanzen stark abgeweidet wurden.
Der Mensch hat mehrere Raubtiere ausgerottet, aber in letzter Zeit drei neue hirschreißende Geschöpfe an ihre Stelle gesetzt: Haushunde, aus dem Westen eingewanderte Kojoten und Autokühler. Erstere jagen sehr effektiv Hirschkälber, Letztere sind die größten Vorstadtkiller erwachsener Tiere. Wir stehen vor einer unlösbaren Gleichung: Einerseits sind Dutzende Pflanzenfresserarten ausgestorben, andererseits haben wir den einen Jägertyp durch einen anderen ersetzt. Wie viele Laubäser in unseren Wäldern sind normal, akzeptabel oder natürlich? Eine schwierige Frage, zweifellos, aber eins steht fest: Im üppigen Wald des 20. Jahrhunderts haben ungewöhnlich wenige Laub äser gelebt.
Ein Wald ohne große Pflanzenfresser ist wie ein Orchester ohne Geigen. Wir haben uns inzwischen an die unvollendeten Symphonien gewöhnt und erschrecken daher, wenn die rastlosen Geigenklänge zurückkehren und die vertrauten Instrumente bedrängen. Doch unsere Abwehrhaltung gegen die großen Pflanzenfresser im Wald entbehrt einer fundierten historischen Grundlage. Wir sollten unseren Blickwinkel weiten, uns die komplette Symphonie anhören und die Partnerschaft von Tier und Mikrobe genießen, die seit Jahrmillionen an den zarten Trieben zerrt. Auf Wiedersehen Sträucher; hallo Zecken. Willkommen im neuen Pleistozän.