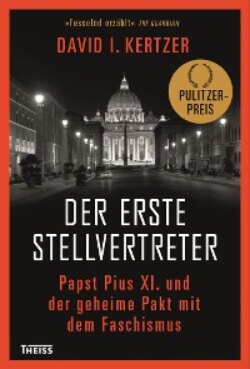Читать книгу Der erste Stellvertreter - David Kertzer - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9 Der Erlöser
ОглавлениеEine Flut von Telegrammen traf ein, um Pius XI. zu dem historischen Abkommen zu gratulieren. Ein amerikanischer Journalist, der kurz nach der Unterzeichnung mit dem Papst zusammentraf, fand ihn lächelnd und verjüngt, „so frisch und dynamisch wie am Tag seiner Wahl“.1 Am 17. Februar gab die Nobelgarde einen prunkvollen Empfang im Vatikan, wo der schwarze Adel Roms mit hohen Geistlichen der Kurie zusammenkam. Bei gedämpftem Licht versammelten sie sich vor einer Leinwand und sahen eine Wochenschau über die Unterzeichnungszeremonie an. Als der Duce ins Bild kam, gab es Applaus und Hochrufe.2
Der Diktator war sehr erpicht auf den Abschluss gewesen, weil eine wichtige Wahl vor der Tür stand. Da Italien nur noch eine einzige politische Partei besaß, musste das Parlament auf neue Art gewählt werden. Mussolinis beiläufiger Kommentar nach der letzten Wahl 1924 stellte sich als prophetisch heraus. Dies war das letzte Mal gewesen, dass er das unwürdige Verfahren einer Wahl mit Gegenkandidaten ertrug. Im neuen System wählte der Faschistische Großrat die Kandidaten für die 400 Parlamentssitze aus. Die Wähler konnten nur die gesamte Liste annehmen oder ablehnen. Mussolini nannte es keine Wahl, sondern eine Volksabstimmung über das Regime.3
Der Vatikan unterstützte Mussolinis Kampagne mit aller Kraft. Am 17. März 1929, eine Woche vor dem Wahltag, appellierte der Osservatore Romano an alle Katholiken, mit Ja zu stimmen. Das war keine geringe Hilfe für Mussolini, denn 99 % der Italiener waren katholisch. Die übrige katholische Presse und Priester im ganzen Land schlossen sich der Kampagne eifrig an.4
Für die meisten Beobachter mobilisierte ein dankbarer Papst einfach die Kirche, um Mussolinis Liste loyaler Faschisten zu unterstützen. Doch hinter den Kulissen sah es anders aus. Der Papst war nicht bereit, Mussolinis Personal ohne Prüfung zu genehmigen.5 Von den 1000 Namen, die dem Großrat von verschiedenen faschistischen und staatlichen Organisationen vorgelegt wurden, damit er 400 Kandidaten auswählte, hielt der Papst drei Viertel für nicht katholisch genug. Er war der Meinung, mit der Unterzeichnung des Konkordats sei Italien „ein konfessioneller Staat“ geworden. Die Zusammensetzung des Parlaments sollte diese neue Realität widerspiegeln.
Der Papst wollte, dass Mussolini seine Liste streiche und eine andere mit Personen aufstelle, die „frei von jeder Beziehung zum Freimaurertum, zum Judentum, kurz gesagt zu irgendwelchen kirchenfeindlichen Parteien“ seien. Der Brief mit seinen Wünschen schloss: „Auf diese Weise wird der Duce … das große Werk des Abkommens und des Konkordats auf die schönste und notwendigste Weise krönen. Er wird erneut zeigen, dass er (wie Seine Heiligkeit ihn vor kurzem genannt hat) der von der Vorsehung gesandte Mann ist.“6
Wenige Tage später brachte Tacchi Venturi Mussolini eine Liste von Männern, die der Papst als „würdige Vertreter eines konfessionellen Staates“ ansah.7 Die Päpste hatten seit langem das Freimaurertum verurteilt, und eine der ersten Maßnahmen, mit denen Mussolini nach seinem Machtantritt der Kirche zu gefallen suchte, war der Beschluss gewesen, dass Freimaurer nicht der Faschistischen Partei angehören dürften.8 Nun forderte der Papst, Juden und Freimaurer auf der Kandidatenliste durch Faschisten mit einem erwiesenen katholischen Glauben zu ersetzen. Erst nachdem Mussolini die Änderungen vorgenommen hatte, mobilisierte der Vatikan starke kirchliche Unterstützung für die Zustimmung.9 Am Wahltag, einem Sonntag, führten Priester in ganz Italien ihre Gemeinden buchstäblich zu den Wahllokalen.10 Mussolinis Triumph war vollkommen, er bekam 98,3 % der Stimmen.11
Am Tag nach dem Plebiszit wurde der Papst von einem alten Protegé besucht. Stefano Jacini war einer der Söhne des Mailänder Adels, deren geistlicher Mentor Ratti vor Jahren gewesen war. Als Jacini das Bronzetor an Berninis Kolonnaden durchschritt, wurde er von Schweizergardisten in ihren buntgestreiften Uniformen begrüßt. Sie prüften seine Einladung und führten ihn die lange Treppe in den Apostolischen Palast hinauf. Dann wurde er von Nobelgardisten durch die prunkvollen Säle geführt. Es war, als sei er in ein Renaissance-Drama versetzt worden. In den reich dekorierten Räumen, die er durchschritt, standen päpstliche Gendarmen Wache – Italiener in exakten Nachbildungen der Uniform napoleonischer Grenadiere. Ein Geistlicher führte den 42 Jahre alten Jacini ins Arbeitszimmer des Mannes, den er noch als einfachen Priester gekannt hatte.
Pius XI. lächelte, als er eintrat. Während ihres siebzigminütigen Gesprächs sagte der Papst oft „ich“ statt des üblichen „wir“. Längere Zeit sprachen sie über die Lateranverträge.
„Problem gelöst!“, sagte der Papst fröhlich. „Ja, ich freue mich, aber jetzt kommt der schwere Teil, man muss darauf achten, dass die Klauseln angewendet werden. Wir mussten niemals dringender beten als jetzt, aber die Zukunft liegt in Gottes Hand.“ Er erinnerte Jacini an die Verse Metastasios, eines italienischen Dichters aus dem 18. Jahrhundert: „Es gibt keine Vergangenheit, die Erinnerung malt sie./Es gibt keine Zukunft, die Hoffnung formt sie./Es gibt nur die Gegenwart, die stets uns entgleitet“, zitierte der Papst.12
Da er wusste, dass Jacini ein führendes Mitglied der Volkspartei gewesen war, wollte Pius seinen Handel mit dem Duce rechtfertigen. Er habe die Gelegenheit nicht verstreichen lassen dürfen, denn sonst könne die Geschichte ihn verurteilen. „Bei all dem hat mir Gott geholfen.“ Er beklagte sich über jene, die seine Annäherung an das faschistische Regime kritisiert hatten. „Das war, als würde man sagen, man soll nicht mehr atmen, weil man in einem Raum mit verschmutzter Luft ist.“ Der Papst erklärte: „Für die Kirche gibt es Revolution und Revolution, die eine zerstört die Autorität und die bestehende Ordnung, die andere verwandelt sie. Die italienische Revolution geschieht mit Zustimmung des Königs und der Monarchie. Mehr konnten wir uns nicht wünschen.“
„Es war keine echte Revolution“, suchte er sich immer noch vor dem jungen Adligen zu rechtfertigen. „Eine Umwälzung, ja. Wir müssen sehen, was daraus wird.“ Dann fielen ihm die Worte seines geliebten Manzoni ein: „Die Dämmerung ist weder hell noch dunkel. Was wird danach kommen? Tag oder Nacht? Warte ein wenig, und du wirst es sehen.“
Während der Papst redete, wurde er lebhafter, rutschte auf seinem Sessel hin und her, stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch und schob den weißen zucchetto auf dem Kopf zurück. „Sein Haar war immer noch blond, er lächelte hinter der goldgefassten Brille, sein Gesicht war lebhaft, und er begleitete seine Bemerkungen mit einem Schmunzeln. Eine Weile schien er wieder der Don Achille von früher zu werden.“13
Obwohl das Abkommen mit dem Papst ein großer öffentlicher Erfolg für Mussolini gewesen war, hatte es auch Nachteile. Nichts ärgerte ihn mehr, als wenn man ihn den Schoßhund des Papstes nannte, und manche warfen ihm nun genau das vor. Der Duce war ein stolzer, arroganter Mann mit einem immer größeren Ego, und er war empfänglich für Einflüsterungen, dass er seine Prinzipien aufgebe und einen Staat schaffe, der nicht von Faschisten gelenkt werde, sondern von Priestern. Dass La Civiltà Cattolica Mussolinis Sieg beim Volksentscheid als Beginn einer „christlichen Erneuerung der Gesellschaft“ pries, war da keine Hilfe.
Es war ein heikler Moment für Mussolini. Innerhalb und außerhalb des Parlaments gab es Unzufriedene. Faschisten der ersten Stunde, die der Bewegung von Anfang an gefolgt waren, sahen den Vertrag als Verrat am wahren Faschismus an, der dem Papst einen unerwünschten Einfluss verschaffte. Manche aus der alten liberalen Elite waren verärgert, dass der Duce die Trennung von Kirche und Staat aufgegeben hatte.
Am 13. Mai erhob sich Mussolini im Parlament, um zum Abschluss der Debatte über die Ratifizierung der Lateranverträge zu sprechen. Es sollte eine seiner berühmtesten Reden werden.
„Geehrte Kameraden“, begann er vor dem brechend vollen Saal. Es herrsche viel Verwirrung über die neuen Verträge. Er versicherte, im italienischen Staat „ist die Kirche nicht souverän, nicht einmal frei.“ Sie bleibe den Gesetzen unterworfen. Italien habe den großen Vorteil, die Heimat einer universellen Religion zu sein, doch die katholische Kirche verdanke einen großen Teil ihres Erfolgs Italien selbst: „Diese Religion wurde in Palästina geboren, aber in Rom wurde sie katholisch.“ Dann fügte er, um den Papst zu ärgern, hinzu, wenn die frühchristliche Gemeinde in Palästina geblieben wäre, „wäre sie wohl bloß eine von vielen Sekten gewesen, die in jener überhitzten Umgebung blühten … und höchstwahrscheinlich wäre sie ausgestorben, ohne eine Spur zu hinterlassen.“14 Er kam zu dem Schluss, der italienische Staat sei „katholisch, aber auch faschistisch, und vor allem anderen grundsätzlich faschistisch.“15
Am nächsten Tag schickte Pius den Rechtsanwalt Francesco Pacelli mit einer Drohung zu Mussolini: Der Papst sei zornig und könnte die Gespräche über die Umsetzung der Verträge unterbrechen. Der Diktator versuchte ihn zu beruhigen und sagte, in der kommenden Senatsrede werde er alle Missverständnisse ausräumen.
Bild 13: Mussolini und Gasparri nach der Ratifizierung der Lateranverträge im Vatikan, 7. Juni 1929; sitzend Kardinal Gasparri und Mussolini, stehend zwischen ihnen Monsignore Borgongini, links von ihm Francesco Pacelli und Monsignore Pizzardo.
Als der Senat drei Tage später die Vorlage zur Bestätigung der Verträge diskutierte, saß Pacelli auf der Galerie, um Mussolinis Rede anzuhören. Sie unterschied sich aber kaum von dem, was er im Parlament gehört hatte. „Ich habe den Eindruck, dies [die Rede] wird dem Heiligen Vater nicht ganz gefallen“, schrieb er in sein Tagebuch.
Obwohl nur wenige davon wussten, drohten Mussolini und der Papst in den folgenden zwei Wochen abwechselnd, die gesamten sorgfältig konstruierten Lateranverträge aufzukündigen. Pacelli eilte verzweifelt hin und her, um eine Katastrophe abzuwenden. Schließlich erkannten beide Seiten, dass sie zu viel zu verlieren hatten. Am 7. Juni fuhr Mussolini in den Vatikan und unterzeichnete mit Kardinal Gasparri in dessen Räumen die endgültige Übereinkunft.16
Durch die Lateranverträge gingen der Papst und der Duce eine merkwürdige Partnerschaft ein. Jeder sah sich an der Spitze einer „totalitären“ Organisation, ein Begriff, den beide benutzten. Sie konnte nur ein Oberhaupt haben und forderte totale Loyalität. Der Papst wollte die Macht der Faschisten nutzen, um einen katholischen Staat wiederherzustellen, obwohl er nicht so dumm war, zu glauben, er könne Mussolini je „christianisieren“. Der Duce wollte seine Herrschaft durch die Macht der Kirche festigen, doch in seinen Augen sollten katholische Geistliche nur Diener der faschistischen Regierung sein, Werkzeuge, die dem Regime öffentliche Unterstützung sicherten.
Beide Seiten hatten durch das Abkommen viel zu gewinnen, aber weder Mussolini noch der Papst fühlten sich je ganz wohl dabei. Der Papst würde erst zufrieden sein, wenn Mussolini das respektierte, was er als die gottgewollten Vorrechte der Kirche ansah. Mussolini wollte dem Papst geben, was er verlangte, solange es nicht mit seiner Diktatur und seinen Träumen vom Ruhm kollidierte. Wie der Papst herausfinden sollte, ließ Mussolini sich nur bis zu einem bestimmten Punkt drängen. Beide Männer wachten eifersüchtig über die Rechte, die ihnen ihrer Meinung nach zukamen. Beide neigten zu Wutanfällen. Man konnte durchaus annehmen, dass die Partnerschaft nicht halten würde.
Bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen ernannte Mussolini den 44 Jahre alten Cesare De Vecchi zu Italiens erstem Botschafter beim Heiligen Stuhl. Der aus einer Mittelschichtfamilie im Piemont stammende De Vecchi hatte Jura studiert und während des Ersten Weltkriegs einen Stoßtrupp befehligt. Später wurde er Anführer der squadristi in Turin. 1921 ging er für die Faschisten ins Parlament, und sein Moment des größten Triumphs war es, dem Quadrumvirat anzugehören, das den Marsch auf Rom anführte.
Warum der Duce für die delikate diplomatische Mission De Vecchi auswählte, ist schwer zu sagen. Mussolini machte sich häufig über seine Dummheit und Aufgeblasenheit lustig und beschwerte sich, er habe kein politisches Gespür. Im Mai 1923 feuerte er De Vecchi von seinem Posten als Unterstaatssekretär für Finanzen und sagte, er sei bloß für das Soldatenleben geeignet.17 Er schickte ihn für fünf Jahre als Gouverneur nach Italienisch-Somaliland. Doch De Vecchi hatte auch Eigenschaften, die für ihn sprachen. Er war ein frommer Katholik und unterhielt zur königlichen Familie ebenso Beziehungen wie zu den oberen Rängen des Militärs; zwei Sphären, die sich der faschistischen Kontrolle weitgehend entzogen hatten. Für seine Treue zur Monarchie verlieh der König De Vecchi den Titel Graf von Val Cismon, den er mit Stolz trug. Dino Grandi notierte, wann immer jemand den König erwähne, zucke De Vecchi unwillkürlich zusammen, als würde er stramm stehen.18 Seine Arroganz, fehlendes Urteilsvermögen, laute Stimme, Glatze, kleine Augen und der exotische Schnurrbart – der entfernt an ein kleines Eichhörnchen erinnerte – machten ihn zu einem der beliebtesten Ziele des Regimes für öffentlichen Spott.19
Bild 14: Cesare De Vecchi, italienischer Botschafter beim Heiligen Stuhl von 1929 bis 1935.
Am 25. Juni traf der Botschafter vormittags in einer königlichen Kutsche mit zwei festlich geschmückten Pferden ein. Der Kutscher und die drei Lakaien auf der Rückseite der Kutsche waren wie für den Hof Ludwigs XIV. gekleidet. In einer Uniform, die an einen Operettenadmiral denken ließ, übergab De Vecchi sein Beglaubigungsschreiben. Er wurde in den kleinen Thronsaal geführt, wo der Papst umgeben von seinem Hofstaat saß. Der neue Botschafter beugte dreimal das Knie, wie es der Brauch war, und nach dem formellen Austausch von Begrüßungen lud Pius XI. ihn zu einem Privatgespräch in seine Bibliothek ein. De Vecchi kam wenig zu Wort, während sich der Papst – vielleicht angeregt von den norditalienischen Wurzeln des neuen Botschafters – freudig an frühere Bergtouren erinnerte. Als er an seine Jahre als junger Priester in der Ewigen Stadt dachte, verdüsterte sich seine Stimmung für einen Augenblick. Er erzählte De Vecchi, wie johlende Jugendliche ihn durch die Straßen von Rom gejagt, Steine geworfen und „Wanze!“ gerufen hätten.
Diese Tage seien Vergangenheit, versicherte ihm De Vecchi. Seit der Faschismus an der Macht war, würden Priester mit Respekt behandelt.20
Einen Monat später traf der Botschafter erneut mit dem Papst zusammen, doch diesmal war die Begegnung weit weniger angenehm. Er betrat die Bibliothek des Papstes etwas beklommen, da er wusste, wie zornig Pius über die jüngste Veröffentlichung von Mussolinis Parlamentsreden war. Beim Eintreten erweckten die durchs Fenster fallenden Sonnenstrahlen den Eindruck, als werfe die Brille des Papstes Blitze. Er attackierte De Vecchi mit Worten, die der Botschafter als „hart, gereizt, häufig grob und verletzend“ beschrieb. „Das kann nicht so weitergehen“, warnte Pius und schüttelte den Kopf. „Ihr Verhalten“ – womit er die Veröffentlichung der Reden meinte – „beleidigt die Kirche und ihr Oberhaupt. Ich bin mit offenem Herzen auf Italien zugegangen, und zum Dank für unsere Loyalität hat Signor Mussolini uns mit einem Maschinengewehr in den Rücken geschossen.“ Der Papst wühlte in seinen Papieren und zog Berichte über aktuelle Misshandlungen von Ortsgruppen der Katholischen Aktion hervor. In manchen Gegenden waren Funktionäre zusammengeschlagen worden, und man hatte den Leuten gesagt, gute Italiener würden nicht der Katholischen Aktion beitreten.
De Vecchi versuchte, die Regierung zu verteidigen. Sie könne nicht einfach danebenstehen, wenn Antifaschisten sich hinter katholischen Gruppen versteckten.
Der Papst reagierte wie von einer Wespe gestochen und schlug mit der Hand auf den Tisch. „Das will ich nicht hören!“ Er habe explizit angeordnet, dass die Katholische Aktion sich nicht in die Politik einmischen solle, und die Regierung habe kein Recht, ihre Mitglieder zu schikanieren.
Das sei gut und schön, erwiderte De Vecchi, aber es sei eine Sache, Befehle zu geben, und eine andere, ihnen zu gehorchen.
Während des zweieinhalbstündigen Gesprächs wurde es dämmrig. Als sich der Botschafter zum Gehen anschickte, sagte der nun etwas ruhigere Papst: „Sagen Sie Signor Mussolini in meinem Namen, er soll seine Freunde nicht mit seinen Feinden verwechseln und umgekehrt, denn ein solcher Irrtum würde seinen Platz in der Geschichte verkleinern. … Und sagen Sie ihm, dass ich in meinen Gebeten jeden Tag den Herrn anrufe, ihn zu segnen.“21
Mitte September sprach der Papst vor einer großen Gruppe junger Italiener. Immer noch erregt von der Behandlung der Katholischen Aktion, beklagte er das „Martyrium“, das ihnen drohe. Wenig später teilte De Vecchi ihm mit, wie bestürzt Mussolini über seine Worte gewesen sei. Er schlug vor, es sei das Beste, wenn der Papst seine Beschwerden wegen der Katholischen Aktion nicht öffentlich äußere, damit De Vecchi und andere sie über diplomatische Kanäle beilegen könnten.
Der Botschafter hätte es besser wissen sollen. Der Papst schlug auf den Tisch und fragte erbost: „Also soll ich nicht sprechen und nicht sagen, was meine Pflicht mir zu sagen gebietet?“
„So meine ich das nicht, Eure Heiligkeit“, antwortete De Vecchi. „Ich kenne die Person auf der anderen Seite, und mein Rat dient nur dem Gemeinwohl.“
„Dem Gemeinwohl“, wiederholte Pius. „Ich werde Ihnen sagen, was ich von jetzt an tun werde, um Sie bei bestimmten Anlässen zufrieden zu stellen. Ich werde dieses Fenster öffnen“ – hierbei zeigte der Papst auf das Fenster hinter seinem Schreibtisch – „und ich werde es so laut rufen, dass jeder auf dem Petersplatz mich hören kann!“
Einen Moment war De Vecchi sprachlos. „Das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht, Herr Botschafter!“, bekräftigte der Papst.22
Im selben Herbst musste der geplagte Botschafter einen weiteren päpstlichen Wutanfall ertragen. Prinz Umberto, der Thronfolger, wollte unbedingt in einer der großen Kirchen Roms heiraten, entweder in der Lateranbasilika oder in der gewaltigen Basilika Santa Maria Maggiore. Doch der Papst lehnte die Bitte ab. Da die Könige von Savoyen die Päpste so lange im Vatikan gefangen gehalten hatten, habe er selbst noch keine der beiden Kirchen besucht, und es sei unpassend, wenn der Urenkel des Königs, der die Päpste ihres Landes beraubt habe, dort heirate.23
De Vecchi kam mit der Bitte, der Papst möge dies überdenken. „Er hat schlechte Laune“, warnte Gasparri den Botschafter, bevor er eintrat.24 Doch der schnurrbärtige Monarchist stand unter dem Druck der königlichen Familie und versuchte es dennoch.
Darauf „geriet der Papst in Rage, wurde laut und unterbrach mich häufig, wenn ich sprechen wollte“, erinnerte sich De Vecchi. Er konnte nichts sagen und saß gerade und unbeweglich da, um das Ende der Tirade abzuwarten. Er versuchte so ausdruckslos wie möglich zu blicken, konnte aber ein nervöses Lächeln kaum vermeiden.
Der Papst gestikulierte dramatisch. „Ich bin beleidigt worden, tödlich beleidigt“, wiederholte er, schüttelte den Kopf und rutschte auf seinem Sessel herum. „Wenn Sie den Mund öffnen, beleidigt Ihr Atem den Papst; wenn Sie sich bewegen, demütigen Sie mich; wenn Sie Ihr düsteres Hirn in Bewegung setzen, planen Sie Beleidigungen gegen die Kirche. … Genug! Genug!“
Dann beklagte der Papst sich erneut, wie Mitglieder der Katholischen Aktion behandelt würden. Der besiegte Botschafter versuchte wieder, seinen Staatschef zu verteidigen, aber der Papst wurde so wütend, dass er aufsprang. Die Muskeln in seinem Gesicht zuckten, der Mund war zusammengepresst. Als er mit der Faust auf den Tisch schlug, wackelte die schwere Christusstatue aus Marmor. „Lügen! Lügen!“, brüllte er.
Pius ging im Zimmer auf und ab und redete wütend wie mit sich selbst. Ab und zu blieb er stehen und schlug wieder mit der Faust auf den Tisch. „Das haben Sie getan“, rief er wieder laut aus. „Sie haben den Papst getäuscht! Jeder sagt es, jeder weiß es, überall schreibt man darüber, in Italien und im Ausland!“
De Vecchi erduldete alles, aber als der Papst sagte: „Rom gehört mir“, konnte der Botschafter nicht an sich halten.
„Rom ist die Hauptstadt Italiens, der Sitz Seiner Königlichen Majestät und der Regierung“, stieß er hervor.
„Rom ist meine Diözese“, erwiderte der Pontifex.
„Gewiss, in religiösen Dingen …“, stimmte der Botschafter zu.
„Jawohl“, unterbrach ihn der Papst, „der Rest betrifft bloß die Reinigung der Straßen.“25
Die Kurienkardinäle murrten über den Papst, sie waren seine Wutanfälle leid und unzufrieden, weil sie in wichtigen Kirchenangelegenheiten nicht gehört wurden. Besonders ärgerte sie, dass er es in den zweieinhalb Jahren der Verhandlungen mit Mussolini nicht für nötig befunden hatte, sie zu konsultieren.26 Ende 1928 hatte Gasparri alle römischen Kardinäle auf Anweisung des Papstes in seinen Räumen versammelt, um ihnen mitzuteilen, dass ein Abkommen bevorstünde. Als er mit Fragen nach den Einzelheiten bombardiert wurde, sagte er, der Papst werde ihnen rechtzeitig alles mitteilen. Doch sie lasen den Text der Lateranverträge erst am 11. Februar 1929, dem Tag ihrer Unterzeichnung und Veröffentlichung. Kardinal Cerretti, der damals gerade auf einem Schiff aus Australien zurückkam, verbarg seinen Ärger nicht. Der Papst fresse Mussolini aus der Hand, spottete er.27
Unter den Kardinälen, die mit dem Vertrag des Papstes mit Mussolini unzufrieden waren, äußerte sich keiner lauter als Basilio Pompili, Kardinalvikar von Rom seit 1916. Wie andere Kardinäle in Rom fand der siebzigjährige Pompili Mussolini nicht vertrauenswürdiger als die Premierminister vor ihm und auch nicht katholischer. Seit italienische Truppen 1870 Rom eroberten, hatte die Kirche darauf bestanden, die Ewige Stadt könne nur vom Papst regiert werden. Dass Pius XI. diesen Anspruch aufgab und in den Augen der Kardinäle so wenig dafür zurückbekam, war ein Skandal, und dieses Gefühl teilte Pompili nicht nur mit seinem inneren Kreis, sondern auch mit einer größeren Gruppe von Bekannten. Besonders ärgerte ihn, dass der Papst ihn als Kardinalvikar von Rom niemals konsultiert hatte.28 „Sie haben Rom, sein Prestige, seine historische Bedeutung, seine Monumente, seine Kirchen verschenkt wie ein abessinisches Dorf“, beklagte er sich.29 Der Papst sei „unfähig, schwach, die Geißel und der Untergang der Kirche, die er verraten hat, als er sich der Gnade einer Regierung auslieferte, die nicht einmal entfernt den Namen katholisch verdient.“
Wiederholt forderte Pius Pompili auf, mehr Respekt für das Papstamt zu zeigen, aber als immer neue Berichte über seine Ausbrüche kamen, verlor er die Geduld und forderte ihn zum Rücktritt auf.30 Der Kardinalvikar, der einer der berühmtesten römischen Adelsfamilien entstammte, ließ sich nicht einschüchtern. „Eure Heiligkeit, Sie haben die Macht, mich meines Amtes zu entheben, dann tun Sie das“, erwiderte Pompili. „Aber bis zum Tag meines Todes werde ich niemals freiwillig diesen Posten aufgeben, den ich schon so lange innehabe und dessen ich mich nie unwürdig gezeigt habe.“31
Wenige Monate später, als der Papst ihn noch einmal zum Rücktritt aufforderte, leistete Pompili erneut Widerstand. „Ich werde laut dasselbe rufen, bis Sie es nicht mehr hören können: ‚Ich gehe nicht weg, ich gehe nicht weg, ich gehe nicht weg!‘“32 Schließlich löste sich das Problem des Papstes auf natürliche Weise: Pompili starb 1931.33
So wie Mussolini De Vecchi zu Italiens erstem Botschafter beim Heiligen Stuhl ernannt hatte, ernannte Pius XI. Francesco Borgongini Duca, Gasparris Protegé, zum ersten Nuntius des Heiligen Stuhls in Italien. Als Sekretär der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten war Borgongini einer von Gasparris beiden Unterstaatssekretären gewesen.
Bei Borgonginis Ernennung übertrug Pius dem anderen Unterstaatssekretär, dem 51 Jahre alten Substituten in der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten Giuseppe Pizzardo, den frei geworden Posten. Obwohl Pizzardo aus einer bescheidenen Familie kam, die bei Genua lebte, konnte er an der päpstlichen Diplomatenakademie studieren, der traditionellen Lehranstalt für die oberen Ränge der vatikanischen Diplomatie. Kurz nach der Priesterweihe kam er ins Staatssekretariat und wurde 1909 Sekretär der Päpstlichen Nuntiatur in München, fühlte sich dort aber fehl am Platz und konnte drei Jahre später in den Vatikan zurückkehren. Seine Freunde sahen den verzweifelten Wunsch nach einer schnellen Rückkehr laut dem Bericht eines Polizeiinformanten als Ausdruck seiner „morbiden und übersteigerten Gier nach Macht und Ämtern“.34
Bild 15: Monsignore Giuseppe Pizzardo.
Zur Zeit der Lateranverträge war Pizzardo das Mitglied des Staatssekretariats, das im engsten Verhältnis zum Papst stand. Ein Polizeiinformant beschrieb ihn im Sommer 1929 als führenden Kandidaten für die Nachfolge Gasparris. Nach diesem Bericht war der kleine, schmächtige Pizzardo, dessen dunkle Augen voll nervöser Energie umherblickten, „der wahre Lenker des päpstlichen Herzens und der Beherrscher aller vatikanischen Angelegenheiten“. Viele im Vatikan verübelten ihm seinen Einfluss. Seine Gegner nannten ihn ein Chamäleon, einen Mann, dem es an Charakter und Würde fehle und der nach oben buckle und nach unten trete. Er stand im Verdacht, zu intrigieren und den eigenen Vorteil zu suchen, und war wenig beliebt, am wenigsten bei seinen Untergebenen.35 Nach diesen Berichten schätzte Pius an Pizzardo vor allem dessen Unterwürfigkeit, wenn er „kauernd wie ein Hündchen“ die häufigen Tadel des Papstes ertrug.36
Als Kaplan der Kolumbusritter hatte Pizzardo Zugang zu amerikanischem Geld. Weil Pius XI. die wachsende Bedeutung der katholischen Kirche in den USA erkannte, hatte er 1924 die Zahl der amerikanischen Kardinäle verdoppelt, indem er Patrick Joseph Hayes, den Erzbischof von New York, und George Mundelein, den Erzbischof von Chicago, zu Kardinälen ernannte. „Amerikanisches Gold hatte etwa mit der Beförderung der beiden Erzbischöfe zu tun“, bemerkte damals Odo Russell, der britische Gesandte beim Heiligen Stuhl.37
Sobald sie Kardinäle waren, taten die beiden Erzbischöfe wenig, um Russells Meinung zu ändern. 1927 veranstaltete Kardinal Mundelein ein Spektakel von atemberaubendem Prunk, als er einen Eucharistischen Weltkongress in Chicago abhielt. Für den Transport der Kardinäle, die über den Atlantik gekommen waren, bestellte er einen Sonderzug aus New York, den er in Kardinalsrot anstreichen ließ und nach dem Papst benannte. Am 11. Juni traf der Zug mit zehn Kardinälen sowie verschiedenen Bischöfen, Erzbischöfen und dem Wohltäter, der alles bezahlte, in Chicago ein. Die beiden höchsten Kardinäle wollten aber nicht in Mundeleins „Pius XI.-Express“ fahren. Kardinal Dougherty aus Philadelphia hatte seinen eigenen Eisenbahnwagen, und Kardinal O’Donnell aus Boston legte mit 500 Pilgern auf einer Privatjacht an. Zur Krönung der Zeremonien schickte Kardinal Mundelein dem Papst ein Geschenk von einer Million Dollar.38
Bild 16: Mussolini besucht den neuen Nuntius, Monsignore Francesco Borgongini Duca, im Juli 1929.
Pizzardo wurde die wichtigste Verbindung des Papstes zu diesen amerikanischen Finanzquellen. Als er dabei half, die Schenkung eines Luxusautos an den Papst zu arrangieren, munkelte man, der amerikanische Autohändler habe ihm für seine Bemühungen 50.000 Lire gezahlt. Pizzardos zwei Schwestern wohnten im Vatikan bei ihm und fuhren im eigenen Cadillac durch die Straßen Roms, auch dies ein Geschenk aus Amerika. Ein wenig galanter Informant berichtete: „Im Wagen sitzen zwei hässliche, unverheiratete Frauen, das Gesicht mit Make-up zugekleistert, auf der Jagd nach einem Ehemann.“39
In dem 45 Jahre alten Borgongini, der sein ganzes Leben in Rom verbracht hatte, fand Cesare De Vecchi ein passendes Gegenstück, denn beide Männer verfügten über einen recht eingeschränkten Horizont. Der Papst ernannte ihn vermutlich, weil ihm seine Rechtgläubigkeit gefiel und er Gehorsam höher schätzte als Intelligenz. Für delikatere Dinge benutzte der Papst weiterhin seinen persönlichen Mittelsmann Tacchi Venturi, der den Attentatsskandal vom Vorjahr überstanden hatte.40 Ausländische Botschafter schätzten Borgonginis Höflichkeit und Hilfsbereitschaft, doch für die soziale Welt des diplomatischen Korps war er wenig geeignet. Er ging nicht zu Diplomatendiners mit der Begründung, dann bekomme er zu wenig Schlaf.41 Der etwas füllige, fromme und furchtlose Borgongini und der kleine, propere Faschist und Ex-Artilleriekommandant De Vecchi waren ein seltsames Paar, obwohl sie einander mit der Zeit schätzen lernten. „Im Grunde ist er ein guter Mann“, sagte der Nuntius über De Vecchi. „Solange er mit seinem Federhut und dem großen Orden herumlaufen darf, ist er glücklich!“42
Die erste Begegnung des neuen Nuntius mit Mussolini fand Anfang August statt, kurz nach dem Druck der Parlamentsreden, die den Papst so aufgeregt hatten. Mussolini begrüßte ihn lächelnd und fragte höflich, wie es ihm gehe.
„Mittelprächtig“, antwortete er und erklärte, der Papst sei über den Duce verärgert und habe angedeutet, er müsse vielleicht „etwas sehr Ernstes tun.“
„Was kann er denn tun?“, fragte Mussolini.
„Wenn sich die Lage nicht ändert, könnte es zu einem Bruch kommen, und das wäre sehr ernst, nur ein paar Wochen nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und so kurz vor der Ratifizierung.“
Mussolini war schockiert: „Lieber Gott! In einem Land, wo gerade die kirchliche Heirat anerkannt worden ist, der Religionsunterricht eingeführt wurde, die Ordensgemeinschaften gesetzlich anerkannt sind …“
Alles sei glatt gelaufen, erklärte Borgongini, bis der Duce seine Rede vor dem Parlament hielt: „Jeder war erstaunt. Der Heilige Vater fragte, wer eine solche Rede provoziert hätte. Niemand verstand, warum Eure Exzellenz so geredet haben.“ Der Papst sei so verärgert, dass er fast das Kardinalskollegium einberufen hätte, um zu verkünden, er werde die Verträge nicht ratifizieren. Und als die unangenehme Erinnerung an die Parlamentsreden des Duce gerade verblasste, habe der Papst erfahren, dass Mussolini sie drucken ließ. Er war außer sich.
„Aber der Papst weiß nicht, in welchen Schwierigkeiten ich mich befunden habe“, erwiderte Mussolini. Kritiker beschwerten sich, Cavour, Mazzini und Garibaldi – die Helden der italienischen Einigung und Verfechter der Trennung von Kirche und Staat – würden sich im Grab herumdrehen. Er habe keine Wahl gehabt, als zu zeigen, dass er den Staat nicht der Gnade der Kirche ausliefere, sagte er Borgongini.
Wenn nach der Hochstimmung der ersten Tage nach Unterzeichnung des Vertrags ein paar Unstimmigkeiten auftauchten, sei das normal, fuhr er fort. „Das ist wie der erste Streit von Jungvermählten nach der Hochzeitsreise.“43