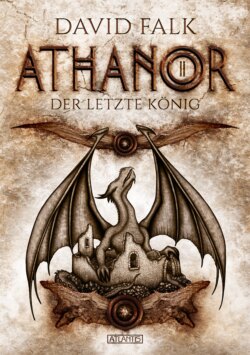Читать книгу Athanor 2: Der letzte König - David Falk - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDavaron kehrte erst vom Teich der Mondsteine zurück, als er sicher war, keine Feiernden mehr zu treffen. Im Lauf der Jahre hatte er eine Abneigung gegen Feste jeder Art entwickelt, und jedes Mal, wenn er doch wieder eines besuchte, langweilten ihn das sinnlose Geplauder und die schlecht maskierten Eitelkeiten. Lieber hatte er am Weiher gesessen und im Schein einer Laterne die alte Handschrift aus Omeons Bibliothek gelesen. Die Erzählung des Seefahrers begann so dröge, wie Davaron befürchtet hatte. Doch nachdem Eleagon auf eine unbekannte Küste gestoßen war, berichtete er von fremdartiger Magie. Von da an hatte Davaron jeden Satz verschlungen. Von so dunkler Zauberei war dort die Rede, dass dem Entdecker geschaudert hatte. Wenn auch nur die Hälfte dieser Andeutungen stimmte, war Davaron dieses Wissen jeden Preis wert. Jeden.
Ruhelos wanderte er durch das nächtliche Ardarea. Im Sternenlicht ragten die Waldhäuser der Abkömmlinge Ardas darin auf wie Bauminseln in der westlichen Steppe. Aus manchen drangen gedämpfte Stimmen und Licht, doch in den meisten war es dunkel und still. Auch im Gästehaus, das Athanor – und mit ihm Elanya – bewohnte. Natürlich, dachte Davaron verächtlich. Menschen brauchten so viel mehr Schlaf als Elfen und starben dennoch so jung.
Plötzlich raschelte etwas in den Schatten neben dem Haus. Davaron hielt inne. Ein Tier? Doch nach allem, was er während der letzten Monde erlebt hatte, regte sich Misstrauen in ihm. Die Grenzwache war durch Verrat und Verluste geschwächt, und seit dem Sieg über die Untoten wagten sich auch die Orks wieder aus ihren Verstecken.
Lautlos ging er hinter einem der Rosenbüsche in Deckung, die das Nachbarhaus umgaben. Hatte der Unbekannte ihn bemerkt? Nichts rührte sich mehr. Vergeblich versuchte Davaron, mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen. Gerade wollte er seine Magie zu Hilfe nehmen, als ein kaum wahrnehmbares Knacken ertönte. Es kam vom Rand des Schattens her, den das Gästehaus im Mondlicht warf.
Also doch! Eine Gestalt schlich zu einem Strauch, der sich knapp außerhalb der schützenden Dunkelheit befand. Auch wenn sie sich geduckt und seltsam steif bewegte, ging sie eindeutig auf zwei Beinen. Bocksbeine. Ein Faun? Was zum Ewigen Tod hat er des Nachts hier zu suchen?
Das Wesen bückte sich noch tiefer und machte sich an irgendetwas unter dem Strauch zu schaffen. Davaron glaubte, leise gemurmelte Worte zu hören. Schon immer hatten vereinzelte Faunfamilien in den Wäldern der Elfen gelebt, doch es waren viele Flüchtlinge aus Theroia hinzugekommen. Etliche blieben in den Elfenlanden, weil es hier weder Orks noch Trolle gab.
Ich hätte den Sitz im Rat annehmen und dagegen stimmen sollen. Faunen konnte man nicht trauen. Niemand wusste das besser als er.
Die Gestalt im Mondlicht sah sich hastig um und huschte weiter. Davaron wartete, bis sie um das Haus verschwunden war, dann eilte er zu dem Strauch hinüber. Vorsichtig, um sich nicht durch Rascheln zu verraten, bog er die untersten Zweige auseinander. Es war zu dunkel, um das Gebilde auf dem Boden genau zu erkennen, doch es schienen seltsame, aus Reisig und Ranken geflochtene Symbole zu sein. Sie erinnerten ihn an die verschlungenen Muster, mit denen die Fauninnen ihre nackten Oberkörper bemalten. Magie?
Davaron sprang auf und pirschte an der Hauswand entlang. Der Faun war nicht weit gekommen. Gerade beugte er sich über einen anderen Strauch und flüsterte beschwörend. Dass er es wagte, obwohl auf dieser Seite kein Schatten lag … Es musste ihm sehr wichtig sein. So wichtig, dass er in Kauf nahm, entdeckt zu werden. Wie weit hatte er seinen Bannkreis bereits um das Haus gezogen?
Der Faun richtete sich auf und blickte sich gehetzt um. Davaron war nun nah genug, um im Mondlicht Brüste und Taille zu erkennen. Warum überraschte ihn das? Die meisten Faunmänner waren gefallen, als sie ihren Heiligen Hain gegen die Untoten verteidigt hatten.
Plötzlich eilte die Faunin davon, trippelte auf steifen Beinen von Schatten zu Schatten. Davaron folgte ihr, zog im Laufen seinen Dolch. Sie einzuholen, war leicht, doch wie sollte er sie mit nur einer Hand festhalten und zugleich mit der Klinge bedrohen?
Schon hatte sie den Waldrand erreicht, wo sich Gärten und Wildnis zu einem kaum unterscheidbaren Ganzen vereinten. Dort konnte er sie aus den Augen verlieren. Tu’s einfach! Aus vollem Lauf stieß er gegen sie und rammte ihr seine Schulter in den Rücken. Sie schrie auf, stürzte, versuchte, sich mit den Armen abzufangen. Doch Davaron warf sich auf sie, drückte sie zu Boden. Zappelnd kämpfte sie gegen ihn an, bis er ihr die Klinge an den Hals legte.
»Was hast du gerade getrieben, Halbweib?« Innerlich verfluchte er die Zwerge dafür, dass er die Faunin nicht an den Haaren packen konnte.
Ihr Angstschweiß stank nach Schaf und der Kräuterpaste, mit der sie sich bemalten. »Gar nichts hab ich getan. Ich hab nur Bockshornblätter gesucht.«
»Mitten in der Nacht? Für wie dumm hältst du mich?«
»Bei Mondschein sind sie am besten. Als kluger Elf müsstest du das doch wissen.«
Davaron versetzte ihr mit dem Stumpf einen Schlag gegen den Kopf und biss die Zähne zusammen. Wahrscheinlich hatte es ihm mehr wehgetan als ihr. Umso wütender fuhr er sie an: »Lügnerin! Ich habe deine verdammten Zauberzeichen gesehen!«
»Ich bin keine Elfe, ich kann gar nicht zaubern.«
»Hör auf, mich für dumm zu verkaufen!« Davaron presste die Klinge fester an ihren Hals. »Es gibt Chimären, die zaubern können. Ich kenne eure verfluchten Geheimnisse.«
»Ich habe nichts Schlimmes getan. Es ist gute Magie. Sie schadet nicht.«
»Dann müsstest du sie wohl kaum verstecken!«
»Nein … ich …«
Gehen dir endlich die Ausflüchte aus? »Was sollen diese Zeichen bewirken? Rede!« Wieder drückte er den Dolch tiefer in ihre Haut. Lief bereits ein Tropfen Blut herunter? In der Dunkelheit konnte er es nicht deutlich sehen.
»Nichts Böses«, krächzte sie. »Nur ein Segen.«
Wusste ich’s doch. Es war genau wie damals. Seine Mutter hatte ihm alles erzählt, bevor ihre Seele zurück ins Ewige Licht gegangen war. Doch er konnte sich nicht vorstellen, dass Elanya darum gebeten hatte. Seine Mutter dagegen … »Segen.« Er spuckte das Wort aus wie einen Knochensplitter. »Imerons Frevel sind hier nicht erwünscht! Wer hat dich geschickt? Die verfluchte Harpyie?«
»Niemand«, beteuerte die Faunin.
»Lüg mich nicht schon wieder an! Bei allen Alfar, wenn du nicht redest, hänge ich dich an den Bockshufen auf und lass dich ausbluten wie einen Hammel!«
»Ich darf es nicht sagen. Sie bringen mich um.«
»Das werde ich auch!« Davaron zögerte. War sie lebend nicht mehr wert? Er konnte ihr folgen und sich direkt zu ihren Auftraggebern führen lassen. »Nein, hör zu. Ich lasse dich am Leben, wenn du mir alles andere erzählst. Aber ich warne dich. Wenn du wieder lügst, werde ich dich nicht töten, sondern mit meiner Magie versengen, bis dein Fleisch nach Festtagsbraten riecht.«
»Ich schwöre beim Heiligen Hain. Ich werde die Wahrheit sagen!«
»Gut. Ist dieser Segen ein Chimärenzauber Imerons?«
Die Faunin wirkte unsicher. »Magie von Chimären, ja.«
»Nein, ich meine, dient er dazu, Kinder zu bekommen, wo keine Kinder entstehen dürften?«
»Warum sollte jemand keine Kinder haben dürfen?«
»Weil es wider die Natur ist – wie du!«
»Ich bin …«
»Deine Meinung interessiert mich nicht!« Eine theologische Diskussion mit einer Chimäre hatte ihm gerade noch gefehlt. »Wie lange spinnst du diesen Fluch schon um ihr Haus?«
»Kein Fluch«, beharrte die Faunin. »Ein guter, ein starker Segen.«
»Wie lange!«, herrschte Davaron sie an.
»Seit dem letzten Neumond.«
Das ist schon fast ein ganzer Mond … »Du lügst! Nie hättest du so lange unbemerkt herumschleichen können.« Seine Hand zuckte vor Wut. Wieder glaubte er, Blut an der Klinge zu sehen.
Die Faunin sog angstvoll Luft ein. »Ich sage die Wahrheit. Wirklich. Ich musste nicht jede Nacht kommen, damit der Segen wirkt.«
Dann kann es längst zu spät sein … »Warum, du verdammtes Miststück? Was habt ihr davon, wenn sie Athanors …« Er brach ab. Falls er mit seinem Gebrüll jemanden angelockt hatte, musste es nicht gleich Stadtgespräch werden, dass Elanya womöglich den Bastard eines Menschen in sich trug.
»Ich weiß es nicht«, behauptete die Faunin. »Sie sagen, es ist für Imeron.«
Davaron war versucht, ihr doch noch den Dolch in den Hals zu jagen. Aber wahrscheinlich wusste sie wirklich nicht mehr. Sie war nur eine Figur, die von den Harpyien über das Spielbrett geschoben wurde.
»Ist da jemand?«, rief eine fremde Stimme.
Davaron hatte keine Lust, dämliche Fragen zu beantworten. Er drückte seine Gefangene mit dem Fuß auf den Boden, bis er aufgestanden war, dann gab er sie frei. »Verschwinde!«
Die Faunin sprang auf und rannte davon. Sobald es dämmerte, würde er ihrer Spur folgen.
* * *
»Heilige Götterschmiede!« Vindur warf einen besorgten Blick zum Himmel, obwohl durch die Baumkronen nur blaue Sprenkel zu sehen waren. »Unseren fröhlichen Jagdausflug hab ich mir anders vorgestellt. Du hast seit heute Morgen nur drei Sätze gesagt.«
»Drei?« Athanor erinnerte sich nicht daran. Vielleicht hatte er Vindur sogar eine Weile vergessen.
»Ja. Sie lauteten: Hör auf, ständig zum Himmel zu starren. Zum Dunklen mit allen Elfen. Und: Hör auf, ständig zum Himmel zu starren.«
»Ich glaube, den hattest du schon.«
»Nein, der kam zweimal.«
»Hm.«
Vindur schüttelte den Kopf. Vermutlich war er der einzige Jäger Ardaias, der auf der Pirsch einen Helm trug, aber vermutlich war er auch der einzige Zwerg, der unter freiem Himmel jagte.
»Ich habe mir das auch anders vorgestellt«, gab Athanor zu. »Eine Sauhatz ohne Spieß!« Anklagend hob er den Bogen, den er in der Hand hielt. Er hatte sich die Ausrüstung bei den Jägern Ardareas leihen wollen, doch nach dem Zwischenfall auf dem Fest schien es ihm kein guter Einfall zu sein, ausgerechnet nach Waffen zu fragen.
»Was soll’s? Du schießt den Keiler an, und ich gebe ihm den Rest. Das wird schon.« Zuversichtlich tätschelte Vindur seine Axt.
Hatte der Zwerg schon einmal ein Wildschwein gesehen? Athanor beschloss, lieber nicht danach zu fragen. Ein Krieger, der mit seinen Spießgesellen gegen einen Troll angerannt war, würde auch mit einem Keiler fertig werden.
Dass er schon wieder schweigend durch das Laub des Vorjahrs stapfte, merkte Athanor erst, als Vindur erneut das Wort ergriff.
»Elanya war wohl nicht bereit, den Streit beizulegen.«
»Sie war nicht da.« Als Athanor das Gästehaus am Morgen betreten hatte, um das Festgewand durch etwas Schlichteres zu ersetzen, war vom Herdfeuer noch etwas Rauch aufgestiegen. Sie musste kurz zuvor fortgegangen sein. »Das hat nichts zu bedeuten«, sagte er, als Vindur nichts erwiderte. »Sie ist Heilerin. Sie kann zu einem Kranken gerufen worden sein.«
Vindur brummte nur. Über ihnen rauschte ein leichter Wind in den Bäumen, woraufhin der Zwerg wieder sorgenvoll unter seinem Helm hervorlugte. Doch er ging tapfer weiter, ungeachtet dessen, was seine Ängste ihm einflüstern mochten.
Allmählich wurden die Schatten wieder länger. Athanor hatte nichts dagegen. Je näher der Abend rückte, desto eher würden sie wieder auf Wild stoßen.
»Glaubst du, wir hätten heute zu Peredin gehen und etwas Schmalz an die Pilze geben sollen?«, fragte Vindur nach einer Weile.
Athanor schnaubte. »Nichts da! Zuerst sollen sich die Dreckskerle entschuldigen, die uns beleidigt haben.« Sein Blick fiel auf eine dunkle Linie vor ihnen im Laub. »Da, ein Wildwechsel!« Er hörte selbst, dass der Ausruf übertrieben begeistert klang, aber alles war besser, als noch mehr Gedanken an das aufgeblasene Pack zu verschwenden.
»Sind das Wildschweinspuren?«, fragte Vindur. Vom Fährtenlesen verstand er offenbar so viel wie Athanor von Bergbau.
Athanor musterte den schmalen Pfad, den unzählige Hufe und Tatzen ausgetreten hatten. Da die Tiere diesen Wegen von guten Futterplätzen zu Salzlecken oder Wasserstellen folgten, wurden sie manchmal über Generationen genutzt. Deshalb war der Boden so festgetrampelt, dass es nur bei feuchter Witterung möglich war, einzelne Spuren zu erkennen. »Wir haben Glück. Hier kommt öfter eine Rotte vorbei.« Athanor deutete auf die länglichen, paarweisen Abdrücke, die jedoch in beide Richtungen verliefen und etwa gleich frisch aussahen. Wohin sollten sie sich wenden? Zur Linken fielen mehr Sonnenstrahlen durch die Bäume. Das Unterholz war dichter. Vielleicht versteckte sich die Rotte dort im Gestrüpp. Athanor legte einen Pfeil auf. »Sehen wir mal hinter diesen Büschen nach.«
Sofort zog Vindur die Axt und setzte eine grimmige Miene auf. Dank des Wildwechsels konnten sie sich beinahe lautlos durch das Dickicht schieben. Schon bald erkannte Athanor, warum es vor ihnen heller war. Das Gesträuch säumte das Ufer eines kleinen Flusses, an den das Wild zum Trinken kam. Murmelnd rann das klare Wasser über Äste und Steine und lud förmlich dazu ein, selbst einen Schluck zu nehmen. Enttäuscht steckte Athanor den Pfeil in den Köcher zurück.
»Keine Schweine?«, fragte Vindur erstaunt. »Wir haben doch noch gar nicht gesucht.«
»In der Nähe ihrer Wasserstelle ruhen sie nicht. Füllen wir unsere Vorräte auf und versuchen es in der anderen Richtung.«
Gemeinsam traten sie aus dem Unterholz, und sogleich zuckte Vindurs Blick wieder gen offenen Himmel. Athanor schüttelte stumm den Kopf. Der Zwerg kam einfach nicht dagegen an.
Wo der Wildwechsel auf das Wasser stieß, war das Ufer zertrampelt und schlammig, weshalb Athanor ein paar Schritte flussaufwärts ging.
»Firas Flamme!«, stieß Vindur hinter ihm aus. »Das ist ein Drache!«
Athanor fuhr herum, dass Flusskiesel spritzten. Sein Freund beschattete die Augen mit der Axt und deutete zum Himmel. Hoch oben, so hoch, dass er trügerisch klein und harmlos wirkte, zeichnete sich der Umriss eines Drachen vor dem leuchtenden Blau ab. Schnell und schnurgerade zog er gen Südwesten. Was lag in dieser Richtung? Seit wann zeigten sich Drachen über den Elfenlanden? Davaron hatte damit geprahlt, dass sie es seit Jahrtausenden nicht mehr wagten.
»Er will nicht nach Ardarea«, stellte Vindur erleichtert fest.
»Und Anvalon liegt südöstlich von hier«, sagte Athanor mehr zu sich selbst. Nicht, dass sie eine Chance gehabt hätten, irgendjemanden zu retten. Der Drache hätte Ardarea erreicht, bevor sie auch nur dem Wildwechsel zurückgefolgt wären. Schon verlor er sich am Horizont.
Vielleicht hatte Davaron in seinem Hochmut nur übertrieben. Vielleicht hatte es ebenso wenig zu bedeuten wie die gelegentlichen Drachensichtungen vor dem Krieg. Doch Athanor hatte zu viele brennende Städte gesehen, zu viele Schreie Sterbender gehört, um leichtfertig darüber hinwegzugehen. »Wir kehren um.« Wenn sie morgen Abend wieder nach Ardarea kamen, würde er sich beim Erhabenen entschuldigen – und ihn vor dem Ungeheuer warnen.
* * *
Die Spur der Faunin war nicht schwierig zu finden. Ihre gespaltenen Hufe hatten sich tief in den feuchten Waldboden gebohrt. Bald wusste Davaron, wohin sie geflohen war, und marschierte zielstrebig durch den spätsommerlichen Wald. Er trug die Rüstung aus schwarz lackierten Stahlplättchen, die graue Seidenbänder zu einem beweglichen und doch dichten Geflecht verknüpften. Es war die traditionelle Wahl der Abkömmlinge Piriths, weshalb er sie den Leinenpanzern der Söhne Ardas vorzog. An seiner Seite hing das Schwert, in dessen Knauf ein Stück Sternenglas eingelassen war. Ein Andenken an den Feldzug gegen die Untoten, das seinen Zaubern ungewohnte Macht verlieh. Nicht nur deshalb waren ihm bei seinem Aufbruch erstaunte Blicke gefolgt, doch sie kümmerten ihn nicht.
Von einer Anhöhe aus sah er die niedrigen, aber schroffen Berge, die er nur zu gut kannte. Auf der anderen Seite des Höhenzugs lag das Dorf, das seine Heimat gewesen war – bis die Harpyien sein Leben in blutige Fetzen gerissen hatten. Am Fuß des Hangs folgte er einem Bach, der sich in engen Bögen durch die steiler werdenden Hügel schlängelte. Es gefiel Davaron nicht, dass das Murmeln und Plätschern die meisten anderen Geräusche übertönte. Misstrauisch sah er sich von Zeit zu Zeit um.
Ein Trampelpfad führte vom Bach zum Lager der Faune. Sicher lebte das Miststück dort. Saß sie dort herum und wartete darauf, dass er sie fand? Vermutlich nicht. Wenn sie zu Imerons Getreuen gehörte, musste sie ihnen von dem Vorfall berichten.
Eine Bewegung auf dem Pfad zog Davarons Blick an. Unter den Bäumen kam eine alte Faunin auf ihn zu, die einen leeren Wasserschlauch trug. Ihre nackten Schultern und Brüste waren mit verschlungenen grünen Mustern bemalt.
Davaron blieb ebenso stehen wie sie.
»Ich kenne dich.« Der graue Ziegenbart an ihrem Kinn zitterte, als die Alte sprach. »Du hast beim Heiligen Hain an der Seite unserer Männer gekämpft.«
»Das ist wahr.« Auch wenn sie fast alle gefallen sind.
»Dafür schulden wir dir Dank.«
Davaron sah sie abwartend an.
»Ich weiß, wen du suchst«, sagte sie nach einer Weile. »Sie trägt das Mal deines Dolchs. Wirst du sie töten?«
»Nur, wenn sie mich angreift.«
Die Faunin nickte. »Folge dem Bach. Er wird dich zu jenen führen, denen sie hörig ist.« Ohne ihn weiter zu beachten, kniete sie sich ans Ufer, um ihren Wasserschlauch zu füllen.
Das alte Schaf hat mehr Würde im kleinen Finger als mancher Elf im ganzen Leib. Aber konnte er ihr vertrauen?
Eine Weile lauschte er auf Geräusche hinter seinem Rücken und sah sich immer wieder nach feindseligen Faunen um. Doch außer dem Krächzen eines Raben hörte er nichts, und im Unterholz regten sich nur kleine Tiere auf der Suche nach Beeren.
Allmählich stieg das Gelände an. Immer öfter trat am Boden blanker Fels zutage. Davaron folgte dem Bachlauf auf die Berge zu, die nun so nah waren, dass er zu ihren flachen, kantigen Gipfeln emporblicken musste. Zwischen ihnen klafften enge Schluchten, als hätte ein Gott sie mit riesigem Messer in den Fels geschnitten.
Der Anblick weckte Erinnerungen – und alten Zorn. Einst hatte die Wut wie glühendes Eisen in seinem Innern gebrannt, doch mit den Jahren war sie zu kaltem Stahl erstarrt. Zu einer Klinge, die er den Harpyien zwischen die Rippen treiben würde. Er wusste nur noch nicht, wann und wie.
Auf dem zunehmend steinigen Grund verlor sich die Spur der Faunin. »Wo bist du hingegangen?«, murmelte Davaron und musterte die steilen Hänge, an denen sich sture Bäume festkrallten, bis Sturm und Regen sie in die Tiefe rissen. Seit Imeron die verfluchte Chimärenbrut vor Jahrtausenden geschaffen hatte, lebten Harpyien auf diesen windigen Höhen. Sie hausten in Spalten der Felswände und hielten sich von Elfen fern, denen sie den Krieg gegen ihren Schöpfer nie verziehen hatten. Nur ein Schwarm weiblicher Harpyien lebte an der Steilwand unterhalb der Grenzfeste Uthariel und gab vor, den Elfen als Späher zu dienen.
Davaron wusste es besser. Viele Harpyien mochten nur dumme, kreischende Raubtiere sein, doch einige verfügten über die Intelligenz ihrer menschlichen Ahnen und trieben unter dem Deckmantel der Hilfe ein falsches Spiel. So gerissen waren sie, dass er es ihnen niemals nachweisen konnte. Ihm blieb nur, sie heimlich zu töten – wann immer ihm eine Harpyie allein begegnete.
Noch einmal ließ er den Blick über die nächstgelegenen Berge schweifen. Den ganzen Höhenzug abzusuchen, konnte Wochen dauern. Bis dahin hatte die Faunin ihre Auftraggeber längst gesprochen und war wieder fort. Verfluchte Chimärenbande!
Aber so schnell aufzugeben, kam nicht infrage. Wenn er schon hier war, konnte er wenigstens noch ein, zwei Tage umherstreifen. Vielleicht lief ihm die Faunin zufällig über den Weg oder er stieß wieder auf ihre Spur.
Wehmut überkam ihn, als er eine bestimmte Richtung einschlug. Bin ich in Wahrheit deshalb hergekommen? Hatte er die Sorge um einen künftigen Bastard nur als Vorwand gebraucht? Es war gleichgültig. Obwohl er den Schmerz fürchtete, trieb ihn die Sehnsucht weiter. Immer tiefer wanderte er in die Schlucht hinein, die er seit einem Jahr nicht mehr betreten hatte, und wie bei jedem Besuch fragte er sich, ob er alles unberührt vorfinden würde.
Der Steig an der Felswand, der zu dem breiten Absatz vor der Höhle hinaufführte, lag bereits im Schatten. Davaron nahm einen abgebrochenen dürren Ast mit hinauf, um ihn als Fackel zu verwenden. Baumhoch über dem Talgrund sah er sich ein letztes Mal um und konnte weder die Faunin noch eine Harpyie entdecken.
Zögernd betrat er die Höhle. Noch konnte er einfach umdrehen und erst wiederkommen, wenn er seinen Schwur erfüllt hatte. Doch dann entdeckte er den längst getrockneten Kot am Boden. Ein Bär! Das Tier hatte den Unterschlupf für den Winterschlaf genutzt. Wie weit war es eingedrungen? Hat es … Davaron rannte in das Gewirr aus niedrigen Gängen und verwinkelten Kammern. Die Spitze des Knüppels in seiner Hand in Brand zu setzen, kostete ihn nur ein kurzes Auflodern seiner Magie. Schatten sprangen in alle Richtungen davon und gaukelten fliehende Gestalten vor.
Atemlos hielt Davaron vor dem Spalt, den er mit aufgeschichteten Steinen verschlossen hatte. Die vormals obersten Brocken lagen zu seinen Füßen verstreut. Auf dem Fels prangten Kratzspuren, wo der Bär versucht hatte, den engen Durchlass zu erweitern. Davaron atmete auf. Das Biest war nicht eingedrungen.
Wieder zögerte er, bemüht, sich gegen den Anblick zu wappnen, der ihn erwartete. Dann stieg er über die verbliebenen Steine durch den Spalt. Im flackernden Schein seiner Fackel schälte sich die Bahre aus der Dunkelheit, die er vor so vielen Jahren gezimmert hatte. Er trat näher. Licht fiel auf die beiden hingestreckten Körper, den großen und den so viel kleineren. Egal, wie sehr er versuchte, sich dagegen zu verhärten, der Anblick traf ihn jedes Mal wie ein Speer in die Brust. Es war die Strafe für den Frevel, den er beging. Er hätte die Leichen dem Sein zurückgeben, sie als Nahrung für neues Leben hingeben sollen, wie es der Brauch verlangte. Stattdessen hatte er sie hier hergeschleppt. Wie ein erbärmlicher Mensch.
War es schlimmer geworden? Sein Blick suchte nach neuen Rissen in der ausgedörrten, bräunlich verfärbten Haut und wanderte langsam nach oben. Mevetha lag in Eretheyas Arm wie eine grausige Puppe. Die leeren Augenhöhlen standen weit offen, als reiße das Kind noch im Tod vor Angst die Lider auf. Noch immer hatte er den Schrei im Ohr, mit dem beide in den Abgrund gestürzt waren. Vermischt mit dem blutrünstigen Kreischen der Harpyien.
Er trat noch einen Schritt näher, streckte die Hand nach Eretheyas Gesicht aus und brachte es doch nicht über sich, die spröde Haut zu berühren. Stattdessen ließ er eine Strähne ihres Haars durch seine Finger gleiten. Es fühlte sich beinahe wie früher an, bevor der Tod ihr schönes Gesicht ins Gegenteil verkehrt hatte. Wie schnell waren die Lippen geschrumpft und hatten die Zähne zu einem ewigen Grinsen entblößt, das seinen Schwur verhöhnte. Der stete Luftzug, der durch die Felsritzen wehte, hatte die Verwesung verhindert, doch er hatte nicht bewahrt, was Davaron fehlte. Das Leben.
Ich werde einen Weg finden. Er hatte es ihr schon so oft versprochen, dass es selbst in seinen Ohren hohl klang.
Von der Einöde der Orks im Westen war er durch die Länder der Menschen bis zum Ende der Trollhügel im Osten gereist, hatte Schamanen befragt, alte Schriften studiert und alles versucht, was Hexen und Magier ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit rieten. Er hatte Dinge getan, für die sein Volk ihn verbannt hätte, wären sie ans Licht gelangt. Doch nichts davon hatte Eretheya Leben, echtes Leben zurückgebracht.
Es gibt neue Hoffnung. Vertrau mir! Er klammerte sich an den Strohhalm, den Omeon ihm gereicht hatte. Diese Schriften mussten endlich der Schlüssel sein.
Die Toten wieder in der kühlen Dunkelheit der Gruft zurückzulassen, kam ihm immer wie feige Flucht vor. Aber tagelang an ihrer Seite auszuharren, wie er es früher getan hatte, wandte auch nichts zum Besseren. Er warf einen letzten Blick zurück, dann verließ er die Kammer und legte die Fackel neben dem Eingang ab, um den Spalt wieder zu verschließen. Mit nur einer Hand konnte er die schweren Steine nicht mehr heben, also berührte er mit den Fingern das Sternenglas an seinem Schwert. Sofort war ihm, als flute die Magie seinen Körper und müsse aus ihm hervorbrechen wie das innere Licht aus einem Astar. Mit geistigen Händen nach den Felsbrocken zu greifen, und sie aufzuschichten, fiel ihm so leicht, als häufte er mit echten Händen ein paar Kiesel auf.
Widerstrebend löste er die Finger wieder vom Schwertknauf. Es kam ihm vor, als schrumpfe er, während die Magie dorthin zurückfloss, wo sie hergekommen war, und eine Leere hinterließ. Er war versucht, sogleich wieder nach dem Schwert zu greifen. Ob es den anderen Trägern dieser magischen Waffen ebenso ging?
Während der Ast am Boden gelegen hatte, waren die Flammen über seine ganze Länge gewandert. Davaron ließ ihn zurück. Der Weg war so kurz, dass er nur dem schwachen Licht folgen musste, um den Ausgang zu finden. Umso deutlicher sah er die gedrungene dunkle Gestalt, die auf dem Felsabsatz vor der Höhle auf ihn wartete. Chria. Die durchtriebenste Harpyie von allen.
Sie musterte ihn mit ihren unnatürlich weit auseinanderliegenden Menschenaugen und legte den Kopf schief. »Suchst du ’ich?«
Der Schnabel, der anstelle von Nase und Mund aus ihrem Gesicht ragte, hinderte sie daran, bestimmte Laute formen zu können. Wusste sie, was er hier verbarg? Davarons Hand legte sich von selbst um den Schwertgriff. Schon durchströmte ihn die berauschend starke Magie. »Wenn du die Faunhexe nach Ardarea geschickt hast.«
Als sie tadelnd den Kopf schüttelte, raschelte ihr Gefieder. »’ie kannst du ein so ’reundliches Mädchen eine Hexe nennen? Sie ’eint es nur gut ’it Elanya. ’ür ’aune gi’t es keinen größeren Segen als Kinder.«
Mühsam unterdrückte Davaron seinen Zorn und sah nur finster auf sie herab. »Erspar mir dein Geschwafel.« Sie wusste ebenso gut wie er, dass Elfen Chimärenmagie zutiefst verabscheuten. »Warum tut ihr ihr das an? Was bezweckt ihr damit?«
»Athanor ist kein El’. Er ’ird seinen Sohn lieben.« Je länger sie sprach, desto weniger fielen ihm die fehlenden Laute auf. »Wir haben Großes mit dem Jungen vor. Und ich bin sicher, dass er dankbarer sein wird als du.«
Beinahe hätte Davaron gelacht. »Für ein Leben als Bastard, der nirgends dazugehört? Für den Spott und die Beleidigungen?«
»Dein schweres Schicksal betrübt mich zutiefst«, höhnte die Harpyie. »Mit einem König zum Vater und Elfenblut in den Adern wird er für uns von hohem Wert sein. Manche Völker werden ihn wie einen Gott verehren.«
»Woher willst du das wissen?«
Das Rucken ihrer Flügel ging wohl als Schulterzucken durch. »Meine Verbindungen reichen weiter, viel weiter, als du dir vorstellen kannst. Und Athanor hat einen Pakt mit mir geschlossen, den er erfüllen muss.«
Wusste ich doch, dass sie ihm geholfen hat, die Trolle zu befreien. »Athanor wird sein Wort brechen – wie alle Menschen.«
Chria stieß krächzende Laute aus, die wohl ein Lachen sein sollten. »Du scheinst dir nicht viel aus deinem einzigen Freund zu machen.«
»Er ist nicht mein Freund.« Wenn er wüsste, was ich getan habe, würde er mich töten.
Wieder zuckte die Harpyie mit den Flügeln. »Warum willst du mich dann unbedingt aufhalten?«
»Für das Kind, das sich wünschen wird, niemals geboren worden zu sein.«
»Was willst du tun? Mir die Flügel stutzen? Das Gefieder versengen?«
Das und noch mehr. Davaron zog sein Schwert.
»Du würdest das Tal nicht lebend verlassen. Sieh hinauf!«
Er trat näher zum Rand, doch nicht so weit, dass sie ihn in den Abgrund stoßen konnte. Die Klinge auf sie gerichtet, blickte er zum Himmel über der Schlucht empor. Ein Dutzend Harpyien kreiste im Licht der Abendsonne. Als sie ihn bemerkten, kreischten sie wild durcheinander, und die Felswände warfen den Lärm zehnfach zurück.
»Du bist unser Geschöpf. Genau wie das Kind unser Geschöpf sein wird.«
* * *
Keuchend schreckte Aphaiya aus ihrem Tagtraum auf. Über ihr raschelte nur Wind in den Zweigen, doch in ihrem Innern brauste der Feuersturm ihrer Vision. Sie hörte das Brüllen der Flammen, spürte die Hitze, als hätte sie sich zu nah ans Herdfeuer gewagt. Mit seinen Schwingen verdunkelte der Drache die Sonne, doch im nächsten Augenblick war er eine Harpyie, und am Himmel tauchte eine zweite auf. Aphaiya mochte seit langer Zeit blind sein, doch sie sah die Leiber, die halb Mensch, halb Raubvogel waren. Immer mehr von ihnen kreisten kreischend über dem Fels, an dessen Fuß eine zerschmetterte Gestalt lag. Aphaiya spürte sich fallen. Schnäbel und Krallen hackten auf sie ein. Vor Schreck und Schmerz schrie sie auf und hörte doch das feuchte Reißen von rohem Fleisch.
Doch das Schlimmste war Elanya. Obwohl sie wusste, dass ihre Schwester mittlerweile eine erwachsene Frau war, sah Aphaiya noch immer das Mädchen aus ihrem Gedächtnis vor sich. Sie erblickte nur das Gesicht, leichenblass wie aus Marmor geformt. Gebrochene Augen sahen zu einem blutroten Himmel auf, an dem noch immer die Harpyien tanzten.
Sie wird sterben! Bei lebendigem Leib von Chimären zerrissen! Aphaiya rappelte sich auf, mühte sich, die Bilder abzuschütteln, die ihr die Orientierung raubten. Ihr Herz raste vor Angst um Elanya. Wo war der Weg? Sie musste so schnell es ging zum Gästehaus. Ihre Füße tasteten nach dem Pfad, der vom Teich der Mondsteine nach Hause führte. Bloße Erde unter ihren Sohlen. Das ist er. Mit ausgestreckten Händen lief sie los. Wann immer sie Grashalme spürte, wusste sie, dass sie vom Weg abzukommen drohte.
Wann wird es geschehen? Was hat der Drache damit zu tun? Doch ihre dunklen Ahnungen waren zunächst immer verwirrend. Oft blieben sie vage und wurden erst mit der Zeit greifbarer und verständlicher. Aphaiya ballte die Fäuste. War Elanya etwa Athanor auf seinen Jagdausflug gefolgt, um sich mit ihm zu versöhnen? Die Vision war so lebhaft, so eindringlich gewesen, als müsse es jeden Augenblick geschehen. Sie spürte Tränen aufsteigen, aber ihre Maske würde sie verbergen. Könnte ich doch nur sehen! Sie wäre sofort auf ein Pferd gesprungen. Vielleicht hätte sie Elanya noch einholen können. Noch ist nichts passiert, versuchte sie sich einzureden. Noch kannst du sie warnen. Doch sie glaubte sich nicht.
Das veränderte Geräusch des Winds in den Baumkronen verriet ihr, dass sie am Kiefernhain vorüberlief. Herabgefallene Nadeln waren bis auf den Weg geweht und stachen in ihre Zehen.
»Ist etwas passiert? Brauchst du Hilfe?«, rief ihr jemand nach.
Aphaiya schüttelte nur den Kopf. Ihr fehlte der Atem für Worte. Es musste Jahrzehnte her sein, dass sie gerannt war. Eine Spur Rauch in der Luft kündete die ersten Häuser Ardareas an. Der Geruch schnürte Aphaiya die Kehle zu. Wieder sah sie die Flammen, hörte ihr Prasseln, und der Qualm biss ihr in die Lunge.
»Aphaiya, was …« Die Stimme brach ab, als Aphaiya einfach vorbeihastete.
Rosenduft stieg ihr in die Nase, linderte ein wenig ihren Schmerz. Sie liebte Rosen, konnte alle Sorten am Duft unterscheiden. So wusste sie immer, wo sie sich in Ardarea befand.
»Vorsicht!«, rief jemand und wich ihr gerade noch aus.
Sie hörte das Rascheln des Gewands und empört ausgestoßenen Atem. »Entschuldigung!« Ein neuerliches, lauteres Rascheln von Laub im Wind kündigte die Halle der Acht an. Die acht Bäume, die die Ecken der Halle bildeten, waren so hoch, dass sie selbst dann rauschten, wenn sich am Boden kein Lufthauch regte. Von hier war es nicht mehr weit zum Gästehaus.
»Aphaiya!«, rief Peredin von irgendwoher, tadelnd und besorgt zugleich.
»Später!«, antwortete sie und hörte, wie vor ihr hastig Leute zur Seite traten. »Ich muss zu Elanya.«
Hinter ihr flüsterten sich die Passanten bange Fragen zu, doch über ihren pfeifenden Atem verstand sie die Worte nicht. Ihre Lungen brannten nun auch ohne Rauch. Wie eine Faust hämmerte ihr Herz gegen die Rippen. »Elanya!«, krächzte sie unerwartet leise und versuchte es gleich noch einmal. »Elanya!«
»Langsam, Kind, du wirst noch jemanden umrennen!«, mahnte ihre Mutter.
Aphaiya blieb keuchend stehen und lauschte. Wie nah war sie schon? Ihre Mutter nahm ihre Hand. »Aphaiya, was ist geschehen?«
»Ich muss Elanya warnen. Ich habe Schreckliches gesehen.«
Die Finger ihrer Mutter verkrampften sich. Sie hörte sie hart schlucken. »Sie ist nicht hier. Die Nachbarn sagen, sie ist mit Davaron fortgeritten.«
Aphaiyas Herz setzte einen Schlag aus. »Jemand muss ihr nacheilen! Sie wird sterben!«
* * *
Elanya ließ ihr Pferd hinter Davarons Grauschimmel hertrotten und genoss die Stille des Waldes. Nach dem Streit mit Athanor hatte sie sich Ablenkung gewünscht, doch stattdessen war sie am nächsten Morgen zum Erhabenen gerufen worden. Peredin mochte Athanor zwar aus Mitleid gewogen sein, weil er der Letzte seines Volks war, aber er verstand ihn nicht. Elanya bezweifelte, dass irgendein Elf – selbst sie – vollständig begriff, was in einem Menschen vorging. Konnten sie nicht einfach darüber hinwegsehen? Nicht einmal untereinander verstanden sie immer, was den anderen bewegte. Doch Peredin hatte ihr Ratschläge erteilt, wie sich Athanors Verhalten in angemessenere Bahnen lenken ließ. Als wäre er ein ungezogenes Kind, das ich erziehen soll.
Wieder griff die Empörung nach ihr und drohte, ihr den Ausritt zu verderben. Tief atmete sie die kühle Waldluft ein und lenkte ihren Blick zum lichten Gewölbe der Baumkronen empor. Wie sollte sie den ganzen Ärger vergessen, solange der Streit zwischen ihr und Athanor nicht beigelegt war? Und dass ihr Vater seit der Prügelei nicht mehr mit ihr sprechen wollte, bis sie sich von Athanor getrennt hatte, war kaum leichter zu ertragen als die Vorträge ihrer Mutter. Den ganzen Tag hatte ihr jemand mit Beschwerden über Athanor in den Ohren gelegen, bis sie die Tür verriegelt hatte. Konnten sie nicht endlich Ruhe geben und ihre Wahl akzeptieren?
Seufzend versuchte sie, nur noch den Stimmen der Vögel und dem Rascheln der Hufe im Laub zu lauschen.
»Denkst du schon wieder an Athanor?«, fragte Davaron spöttisch. Wie stets hatte er gewirkt, als ob er düster vor sich hinbrüte, aber heute stand sie ihm wohl in nichts nach.
Ich hätte allein ausreiten sollen. Doch wäre Davaron nicht aufgetaucht, hätte sie es nicht getan – aus Angst, Athanor zu begegnen. Er sollte nicht glauben, sie laufe ihm nach. »Das geht dich nichts an.«
»Ich frage mich nur, warum du das alles für einen Menschen auf dich nimmst.«
Ging das schon wieder los? »Seit wann darf eine erwachsene Frau nicht mehr lieben, wen sie will?«
Davaron zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, das hat sich meine Mutter damals auch gefragt.«
Grollend starrte Elanya seinen Rücken an. Wollte er ihr ein schlechtes Gewissen machen? Aber vielleicht tat sie ihm unrecht. Seine Mutter war eine Tochter Piriths gewesen und hatte gegen den Willen und den Brauch beider Stämme einen Sohn Ardas geheiratet. »Ist sie … Glaubst du …« Davarons Mutter war vor einigen Jahren zum Ewigen Licht gewandert und hatte sich dort das Leben genommen. Sein Vater lebte seitdem als Einsiedler fern von Freunden und Verwandten, die ihn vergebens baten, zurückzukehren.
»Dass sie sich umgebracht hat, weil sie die missbilligenden Blicke nicht mehr ertrug?«
Wie konnte ein Elf so barsch klingen, wenn er über das schreckliche Schicksal seiner Mutter sprach?
Davaron schüttelte den Kopf. »Nein, das war es nicht.«
»Woher willst du das wissen?«
»Erzähle ich dir später. Wenn wir angekommen sind.«
»Was willst du mir denn nun so Wichtiges zeigen? Hast du Fortschritte mit deiner Erdmagie gemacht?«
»Ich will hoffen, dass du niemandem davon erzählt hast.«
Elanya verdrehte die Augen. War es ihm immer noch so wichtig, den Anschein eines reinerbigen Sohn Piriths zu wahren, um die Vorurteile gegen Bastarde Lügen zu strafen? Sein Volk hatte ihn nach der siegreichen Rückkehr aus Theroia gefeiert und sogar in den Rat entsenden wollen. Wozu dann noch das Versteckspiel? »Dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Aber findest du nicht …«
»Ich habe Fortschritte gemacht. Nur leider nicht in dem Zauber, den du mir gezeigt hast.«
»Oh.« Sie verkniff sich die Bemerkung, dass er dann wohl kein Talent für diese Art Magie besaß. Ein Samenkorn zum Keimen zu bewegen, was im Grunde dem Wunsch des Samens entsprach, gehörte zu den einfachsten Zaubern, die Elanya kannte.
Davaron sagte nichts mehr, und nach einer Weile setzte er sein Pferd in Trab. Da er immer schweigsam war, vermochte Elanya nicht zu sagen, ob er sich ärgerte oder nur den üblichen Gedanken nachhing. Im Grunde war es ihr gleich. Auf ihrer gemeinsamen Reise zu den Zwergen hatte sie gelernt, seinen Launen keine Bedeutung beizumessen.
Lange Zeit folgten sie einem Bachlauf, und Davaron ritt erst wieder langsamer, als sie sich einer Kette schroffer, aber niedriger Berge näherten. Allmählich empfand Elanya das Schweigen als bedrückend. Es ließ zu viel Raum für Erinnerungen an die Streitereien der letzten Tage.
»Ich bleibe bei Athanor, weil er der Einzige ist, der keine Erwartungen an mich stellt«, sagte sie in die Stille hinein. »Er verurteilt nicht, dass ich mein Leben bei der Grenzwache riskiere. Er will mich nicht dazu bringen, in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten, nur weil sie uns eines Tages als große Heilerin fehlen wird. Und er schreibt mir nicht vor, wen ich zu lieben habe.«
»Über den letzten Punkt lässt sich streiten«, erwiderte Davaron belustigt.
Elanya musste selbst lachen. »Einverstanden. Das zählt nicht.«
Je näher sie den Anhöhen kamen, desto mehr fielen Elanya die steilen Hänge und Felsabbrüche auf. Sie war nicht zum ersten Mal in dieser Gegend, und sie verband sie mit irgendetwas, aber es wollte ihr gerade nicht einfallen. Warum führte Davaron sie ausgerechnet hier her? Hinter diesem Höhenzug lag seine Heimat, aber was hatte das mit ihr zu tun?
Davaron ritt in eine der engen Schluchten, an deren Grund ein Rinnsal dem Wald entgegenfloss. Es war kühl und schattig, während hoch über ihnen die Sonne auf die Felswände brannte. Hier ist seine Frau gestorben! Warum war sie nicht gleich darauf gekommen? Unwillkürlich sah sie zu dem schmalen Streifen Himmel auf, den sie vom Boden der Schlucht aus sehen konnte. Zwei Raben flogen an der Felskante entlang. Keine Harpyien. Elanya wischte ihre dunklen Ahnungen fort, doch sie bereute, ihr Schwert nicht mitgenommen zu haben. »Du hättest mir sagen können, dass wir in eine gefährliche Gegend reiten.«
»Würdest du weniger auf die Meinung anderer geben, hättest du Waffen und Rüstung angelegt«, gab Davaron selbstgefällig zurück.
Das sagt der Richtige. Wer von ihnen hatte sich jahrzehntelang gemüht, als vollwertiger Sohn Piriths anerkannt zu werden? Aber sie würde jetzt nicht mit ihm streiten. Sie herzuführen, konnte nur bedeuten, dass er ihr etwas anvertrauen wollte. Soweit sie wusste, hatte er bislang mit niemandem darüber gesprochen, was ihn seit seinem schrecklichen Verlust bewegte. Es rührte sie, dass nun ausgerechnet sie dazu auserkoren war.
Davaron brachte sein Pferd zum Stehen und sprang ab. »Wir sind fast da. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter.« Er deutete einen Hang hinauf, der zwar nicht senkrecht war, aber dennoch so steil, dass sich an seinem Fuß abgebrochene Steine gesammelt hatten.
»Ist das die Anhöhe, auf der …«
»Ja. Wir kamen damals von der anderen Seite. Dort ist der Aufstieg leichter.«
»Und du bist sicher, dass du an diesen Ort zurückkehren willst?«
»Warum nicht? Die Aussicht ist großartig.«
Also gut. Wenn er noch nicht darüber sprechen wollte, würde sie eben warten.
Davaron schob die Tasche, die er sich umgehängt hatte, auf seinen Rücken und ging voran. Es gab keinen Pfad, aber verglichen mit dem schwindelerregenden Steig zur Festung Uthariel kam Elanya der Aufstieg wie ein Spaziergang vor. Zwischen blankem Fels und Gesträuch suchten sie sich ihren Weg hinauf und erreichten bald den Gipfel, der kahl in der Sonne lag. Elanya sah sich um und bewunderte die Aussicht über die bewaldeten Hügel um Ardarea, die sich bis zum Horizont erstreckten. Es war ein wunderbarer Ort für ein junges Paar, um sich missliebigen Blicken zu entziehen. Denn davon hatte Eretheya, die Tochter eines der mächtigsten Magier unter den Abkömmlingen Piriths, mehr als genug auf sich gezogen, seit sie die Frau eines Bastards geworden war.
»Wir kamen oft hierher«, sagte Davaron. »Es war von Anfang an unser Rückzugsort.« Er ließ sich auf den aufgeheizten Felsen nieder, und Elanya setzte sich so, dass sie ihn und die Aussicht im Blick hatte.
»Warum hast du mich hier hergeführt?« Allmählich begriff sie, was sie mit seiner Mutter und seiner Frau gemeinsam hatte, aber worauf wollte er hinaus?
»Ich möchte dir erzählen, was damals wirklich hier geschehen ist.«
Elanya stutzte. »War es denn nicht so, wie es sich alle erzählen?« Dann musste er ihnen etwas verschwiegen oder gelogen haben.
»Oberflächlich betrachtet schon. Aber hast du dich nie gefragt, weshalb die Harpyien angriffen?« Schon ihre Erwähnung verdüsterte Davarons Gesicht.
»Ehrlich gesagt nicht«, gestand Elanya. »Die meisten Harpyien hassen uns, und es kam über die Jahrhunderte immer wieder zu solchen Überfällen.«
Davaron nickte. »Aber dieser Fall lag anders. An diesem Tag tauchte ein Schwarm der verdammten Biester auf und umkreiste uns – schweigend. Du weißt, welchen Lärm sie sonst machen. Ich ahnte, dass etwas Seltsames vorging. Eretheya bekam Angst und hob Mevetha auf, um sie zu beschützen. Plötzlich landete eine der Harpyien neben uns. Sie eröffnete mir, sie sei gekommen, um den Preis für den Gefallen einzufordern, den sie meinen Eltern einst erwiesen hatte.«
»Gütiger Alfar von Wey«, hauchte Elanya. Davarons Mutter war in den Tod gegangen, weil sie sich die Schuld für Eretheyas und Mevethas tragisches Schicksal gegeben hatte.
»Ich wusste, wovon sie sprach. Meine Eltern hatten mir zwar nie von diesem Geheimnis erzählt, aber als Kind hatte ich einmal einen Streit zwischen ihnen belauscht. Damals ergaben ihre Worte für mich keinen Sinn, aber sie gruben sich in mein Gedächtnis ein, und mit der Zeit kam ich hinter ihre Bedeutung.«
Was konnten Harpyien schon für Davarons Eltern getan haben? An der Grenze waren ihre Dienste als Späher nützlich, aber darüber hinaus …
»Du weißt es vielleicht nicht, aber einige Chimären haben etwas von Imerons verbotenen Künsten bewahrt«, eröffnete ihr Davaron.
»Sie beherrschen Magie?« Dabei waren sie doch nur halbe Menschen, und selbst unter den Menschen hatte es nur wenige Zauberer gegeben. Doch die Fähigkeit vererbte sich. Vielleicht waren die Ahnen der Harpyien Magier aus Imerons Anhängerschar gewesen. Die Macht des frevlerischen Astars hatte viele Verblendete angelockt, um von ihm zu lernen. Am Ende hatte Imeron den Zorn des Seins geweckt und war nach einer Reihe verheerender Schlachten an den Himmel verbannt worden.
»Vor allem beherrschen sie seine Magie. Und nicht nur die Harpyien, sondern auch einige Faune, Zentauren und andere Chimären. Sie können Nachkommen erschaffen, wo das Sein sie verwehrt.«
Elanya beschlich ein leises Unbehagen. »Aber was hat das mit dir zu tun?«
»Sicher ist dir bekannt, dass Ehen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Elfenvölker manchmal kinderlos bleiben«, rief Davaron ihr ins Gedächtnis. »Von den Gegnern solcher Verbindungen wird es als Beweis für deren Verwerflichkeit betrachtet.«
Und das ist milde ausgedrückt, fügte Elanya im Stillen hinzu.
»Auch bei meinen Eltern war es so. Wie alle neu Vermählten pilgerten sie zum Ewigen Licht, auf dass eine Seele durch sie wiedergeboren werde. Aber es geschah nichts. Meine Mutter wurde nicht schwanger, und … Ich muss dir nicht erzählen, wie über sie geredet wurde. Wie man sie angesehen und gemieden hat.«
Elanya nickte. Es geschah ihr schon jetzt, und es würde noch schlimmer werden.
»Als ein Faun an sie herantrat und meinen Eltern anbot, ihnen auf magische Weise ein Kind zu verschaffen, waren sie der ewigen Anfeindungen so müde, dass sie annahmen. Ich wurde geboren. Aber der Faun hatte meine Eltern gewarnt, dass die Chimären für ihre Hilfe eines Tages einen Preis fordern würden. Allerdings kamen sie damit nicht zu meinen Eltern, sondern zu mir.«
An jenem Tag … hier, an dieser Stelle.
»Sie verlangten, dass ich mich ihrer geheimen Bruderschaft anschließe und mit meiner Magie beim Erreichen ihrer Ziele unterstütze. Ich lehnte ab. Vielleicht war ich undankbar, aber ich hatte sie nicht um ihre Hilfe gebeten. Und ganz sicher hatte ich nicht vor, Eretheya zu verlassen, um mich für die verfluchten Chimären verbotener Magie zu widmen!« Zornig sprang Davaron auf und machte seiner Wut Luft, indem er herumlief.
»Deshalb griffen sie euch an«, folgerte Elanya.
»Noch nicht. Es ging ein Streit voraus. Die Harpyie drohte, dass diejenigen für meine Entscheidung bluten würden, die ich liebe. Ihre Schwestern umkreisten uns schneller und kreischten so, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Es war beängstigend, aber Eretheya besaß mehr Mut als ich. Sie war wütend, weil die Harpyien unser Kind bedrohten, und bereit, wie eine Löwin zu kämpfen.« Davaron war stehen geblieben und starrte in die Luft, als sehe er alles noch einmal vor sich. »Als eine Harpyie herabstieß, ließ Eretheya sie in Flammen aufgehen. Sie hatte so viel Macht. Das Erbe ihres Vaters. Und doch nützte es nichts. Es waren zu viele Harpyien und meine Zauber zu langsam. Ich tötete zwei mit dem Schwert, während sich immer mehr auf Eretheya stürzten. Mevetha schrie, und ich schlug auf die verfluchten Bestien ein wie von Sinnen. Eretheya geriet immer näher an den Abgrund.«
Davaron verstummte vor dem Grauen, das sie in seinem Gesicht sah. Auch wenn sie Athanor so oft um Verständnis für Davaron gebeten hatte, weil sie um die Gründe für seine Verbitterung wusste, waren sie Elanya nie so nahe gegangen wie hier. Wie von selbst schweifte ihr Blick über das Gestein, als müsste es Spuren des Kampfs bewahrt haben. Einen Blutfleck. Ruß. Versengte Federn. Doch nach so vielen Jahren wirkte der Gipfel wieder unberührt.
»Es tut mir leid, dass du etwas so Schreckliches erleben musstest. Du hattest endlich etwas Glück gefunden, und diese Harpyien …«
»Erzähl mir nicht, was ich schon weiß! Du drehst nur das Messer in der Wunde herum.«
Elanya biss sich auf die Lippe. »Entschuldige.«
»Ich habe dir die Geschichte nicht erzählt, um Mitleid zu erbetteln. Du sollst daraus lernen.«
Es hatte also doch mit Athanor und ihr zu tun.
»Du erwartest ein Kind von ihm?«
Erstaunt riss Elanya die Augen auf. »Woher weißt du das?«
Davaron zog spöttisch einen Mundwinkel hoch. »Eine Faunin hat’s mir geflüstert.«
»Aber das …«
»Hast du es ihm schon gesagt?«
»Nein«, antwortete sie überrumpelt. »Ich wollte erst ganz sicher sein.«
»Gut, das macht es leichter.« Er setzte sich wieder und holte einen Rindenbecher und eine kleine Feldflasche aus seiner Tasche. Der Geruch der milchigen Flüssigkeit, von der er einen Schluck einschenkte, kam Elanya bekannt vor. »Güldenfarn? Sadebeeren?«
»Und Wolfsblüte. Du bist Heilerin. Du weißt, was zu tun ist.« Davaron stellte den Becher vor ihr ab.
Elanya merkte, dass ihre Hände plötzlich zitterten. »Du willst, dass ich mein Kind töte?«
»Es wurde auf widernatürliche Weise empfangen. Die Faune haben ihre verfluchte Magie um euer Haus gewoben. Ich habe sie ertappt, als ich nachts vorbeikam.«
»Was kann das Kind dafür? Es hat dasselbe Recht zu leben wie du!«
»Hast du mir überhaupt zugehört? Dass ich geboren wurde, hat nichts als Leid und Tod erzeugt!«
»Mich hat niemand gefragt, ob ich diese Hilfe will. Mein Kind und ich schulden den Chimären nichts.«
»Es wird ihnen sein Leben verdanken«, beharrte Davaron wütend. »Seine Existenz!«
»Wenn du glaubst, dass ich mein Kind töte, nur weil du irgendetwas befürchtest, hast du den Verstand verloren.«
»Irgendetwas?«, fuhr Davaron auf. »Willst du unbedingt die Mutter von Imerons Befreier werden? Willst du einen neuen Krieg der Astare über diese Welt bringen? Dein Kind …«
»Bist du jetzt Aphaiya? Siehst du neuerdings die Zukunft voraus? Mein Kind …«
»Wird ein halber Mensch sein! Menschen sind gierig und unfassbar leicht zu manipulieren. Du kannst unser Schicksal nicht in ihre Hände legen wollen.«
»Ich werde das nicht trinken!« Elanya stieß den Becher um und sprang auf.
Davaron war fast ebenso schnell auf den Beinen und riss dabei noch das Schwert heraus. »Ich kann nicht zulassen, dass du den Chimären zum Triumph verhilfst. Merkst du nicht, dass sie dich zu ihrer Marionette machen? Heb die Flasche auf und beende es!«
Für einen Augenblick starrte Elanya entsetzt auf die gebogene Klinge, die Davaron drohend erhoben hatte. In seinem Blick loderte der Hass auf die Harpyien. Sie musste ihm entkommen, aber wie?
»Trink!«, brüllte er.
»Also gut.« Zum Schein beugte sie sich vor, ging ein wenig in die Knie, als ob sie den Gifttrank aufheben wollte. Mit der Linken langte sie nach der Flasche, während ihre Rechte verstohlen zum Griff ihres Messers glitt. Sobald sie das Heft in ihren Fingern spürte, warf sie sich zur Seite, rollte sich ab und zog die Waffe dabei heraus. Schon war sie wieder auf den Füßen und sprang auf. Doch sie sah nur noch das Aufblitzen der Klinge, die in ihren Hals fuhr.