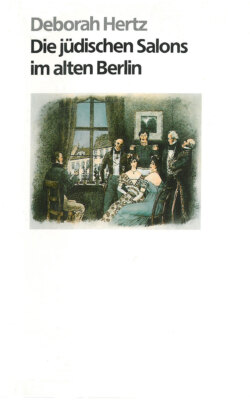Читать книгу Die jüdischen Salons im alten Berlin - Deborah Hertz - Страница 11
Preußische Widersprüche
ОглавлениеBerlinbesucher, die vor zwei Jahrhunderten ihre Reiseeindrücke publik machten, schildern die städtische Szenerie meist in enthusiastischen Farben. Die Fremden waren besonders beeindruckt von den stattlichen Palais, dem neuen Opernhaus und den geschmackvoll gekleideten Spaziergängern auf der großzügig angelegten Allee Unter den Linden oder im Tiergarten. Ihre Beobachtungen galten ihnen als hinreichende Beweise für das Wohlergehen der ganzen Stadt. Viele ihrer in Berlin lebenden Zeitgenossen stimmten mit ein in die Lobeshymnen, und Lokalberichterstatter, die sich mehr mit den sozialen Beziehungen als mit der äußeren Gestalt der Stadt beschäftigten, entwarfen ein Bild gesellschaftlicher Harmonie, demzufolge dem Adel gemeinhin mit unterwürfiger „Hochachtung und Liebe“ begegnet wurde und Adlige und Bürgerliche denselben Vergnügungen nachgingen. Von den Wohlhabenden heißt es, daß sie ihre Garderobe weniger als anderswo zur Schau stellten, und selbst wenn die Existenz einer „Classe reicher Müßiggänger“ eingeräumt wurde, so betonte man doch sogleich, daß deren Zahl eher „unbedeutend“ gewesen sei. Besonders überschwänglich wurde die angebliche soziale Gleichheit gelobt; das Gesellschaftsleben habe buchstäblich jedem, gleich welchen Standes, offengestanden. Und in Abgrenzung von den deutschen Handelsstädten heißt es: „Berlin unterscheidet sich auch von den Städten, wo nur der Gelehrte, der Künstler, der betitelte ... Mann gesucht, alle andern hingegegen vergessen, vernachlässigt oder herabgesetzt werden. Man weiß von keinem Vorzuge als von dem, welchen Tugend, Rechtschaffenheit und große und erhabene Einsichten gewähren. Des tugendhaften und rechtschaffenden Mannes Gesellschaft wird gesucht, er mag Jude oder Christ, Rat, Doktor, reich oder arm sein.“
Aber nicht alle Beobachter gaben sich damit zufrieden, daß die Stadt einen äußerlich guten Eindruck machte und das gesellschaftliche Leben oberflächlich intakt schien. Lakonisch urteilte ein Besucher: „Wo man hinblickt, ist Armuth und Noth, aber mit einem glänzenden Firniß überzogen.“ Und Georg Forster fand nach seinem Besuch 1779 bittere Worte: „Ich hatte mich in meinen mitgebrachten Begriffen von dieser großen Stadt sehr geirrt. Ich fand das Äußerliche viel schöner, das Innerliche viel schwärzer, als ich mir gedacht hatte. Berlin ist gewiß eine der schönsten Städte in Europa. Aber die Einwohner!“ Gutaussehende Häuser waren bei näherer Betrachtung oft heillos überfüllt, die breiten Straßen vor den imposanten Palais waren nachts schlecht beleuchtet und vor allem im Frühjahr mit Schlamm bedeckt, und kein schöner Anblick bot sich dem, der sich in die neuen Vorstädte begab, die zusammen mit Kasernen und Militärbaracken außerhalb der Stadtmauern aus dem Boden gestampft worden waren.
Daß sich die Verhaltensweisen der Menschen über Standesgrenzen hinweg einander annäherten, wurde, je nach Standpunkt des Beobachters, begrüßt oder bedauert. Schon 1760 klagte der Kammerherr der Königin, Graf von Lehndorff, darüber, daß der Konsum von Genußmitteln längst nicht mehr das alleinige Privileg der Aristokratie sei. Einen Stein des Anstoßes boten auch die Tiergartenpromenaden, die gerade jüdischen Frauen die Gelegenheit zur Begegnung mit nichtjüdischen Männern boten: Dieser „Lustgarten“, vormals der „Sammelplatz der sogenannten schönen und vornehmen Gesellschaft“, diene nunmehr den „galanten Jüdinnen ... denen zu gefallen mancher junge Stutzer hingeht“. Jüdische Frauen waren jedoch keineswegs die einzigen Berliner, die durch ihr Verhalten die traditionelle gesellschaftliche Rangordnung verletzten und deshalb angegriffen wurden. Bürgerliche Frauen, die durch luxuriöse Anschaffungen den Lebensstil der Oberschicht nachzuahmen suchten, wurden beschuldigt, ihre Familien zu ruinieren. Nicht mehr als achthundert Taler im Jahr verdienende Ehemänner beklagten sich über die von ihren Frauen gewünschten Reif röcke, Seidenkleider und Empfangszimmer. Von einfachen Perückenmachern und Schneidern hieß es, daß sie sich „in gestickten und betreßten Kleidern“, die einst nur ihren vornehmen Kunden vorbehalten waren, „unter Leute von Stand mischten“.
In solchen Kommentaren aus den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, die das Undeutlichwerden der sozialen Schranken entweder feierten oder denunzierten, spiegelten sich die Resultate einer zutiefst widersprüchlichen Politik des Staates. Im 17. und 18. Jahrhundert bestand das Hauptziel der preußischen Regenten darin, das Land in eine europäische Großmacht zu verwandeln – eine gewaltige Aufgabe, wenn man die begrenzten geographischen und gesellschaftlichen Ressourcen bedenkt, die dem Staat zunächst zur Verfügung standen. Um dieses Ziel zu erreichen, führte Friedrich der Große (1740–1786) zahlreiche Eroberungskriege und baute eine riesige Armee und einen funktionierenden Verwaltungsapparat auf. Die religiöse Toleranz der Könige ermöglichte eine flexible Einwanderungspolitik, die mit zum Aufstieg Preußens beitrug. Um die industrielle Entwicklung zu fördern, hatte das Land im Jahre 1685 aus Frankreich vertriebene hugenottische Handwerker aufgenommen. Gleichfalls wurden reiche Juden, die 1671 aus Wien vertrieben worden waren, nach dem kapitalbedüftigen Preußen gerufen, um sich dort als Händler niederzulassen. Doch waren dieselben tatkräftigen Monarchen, die Preußen zur Großmacht ausbauten, zugleich leidenschaftliche Anhänger und Bewahrer einer überkommenen Gesellschaftsordnung, deren Leitprinzip das uneingeschränkte Privileg des Adels auf Grundbesitz bildete.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen aktiver Erneuerung und sozialer Unbeweglichkeit gehörte wesentlich zur preußischen Politik in diesen beiden Jahrhunderten. Ironischerweise war es dieser Widerspruch zwischen Reform und Festhalten an Althergebrachtem, der jene geographische und soziale Mobilität hervorbrachte, welche eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung der Salons war. Bot die Zusammensetzung der Salongäste ein miniaturhaftes Abbild der außergewöhnlichen Heterogenität der Berliner sozialen und kulturellen Elite, so war dieselbe Heterogenität nicht zuletzt ein Ergebnis der Widersprüche preußischer Staatsräson.
Wäre Berlin nämlich nicht der Sitz des Hofes dieser tatkräftigen Monarchie gewesen, so hätten hier kaum so viele fremde und einheimische Staatsbeamte ihre neue Heimat gefunden. Hätte die Monarchie den Armee- und Staatsdienst für den Adel nicht attraktiver gemacht, so wären die preußischen Junker kaum aus der Provinz nach Berlin gezogen. Ohne die vom Großen Kurfürsten in Preußen aufgenommenen Hugenotten hätten sich die französiche Sprache und die verschiedenen französischen Moden, französisches Gedankengut und französische Bildungsideale nicht so leicht in Berlin ausbreiten können. Ohne die in Preußen angesiedelten jüdischen Familien hätten deren Nachkommen – die gebildeten jüdischen Salonières – nicht die Initiative zur Gründung von Salons ergreifen können. Und ohne die Aktivitäten des Königs und des Adels auf geistigem und kulturellem Gebiet wären nicht so viele aufstrebende Intellektuelle in die Stadt gekommen, um sich dort als Hofmeister oder Schreiber, als Hilfsprediger oder freie Schriftsteller, als Buchhändler oder Verleger niederzulassen.
Adlige und Hugenotten, Juden und Intellektuelle zogen nach Berlin. Die Stadt und Preußen insgesamt erlebten einen rapiden Bevölkerungszuwachs. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts schien die winzige Hauptstadt des armen und obskuren Kurfürstentum Brandenburg noch keines besonderen öffentlichen Kommentars für würdig befunden. Preußen erholte sich von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges; Berlin hatte im Jahr 1700 nicht mehr als 24000 Einwohner. Doch mit dem Zugewinn an politischer Macht wuchsen die Gebiete und die Bevölkerung. Das Kurfürstentum Brandenburg wurde zum Königreich erhoben, und durch Kriege und Annexionen dehnte der neue Staat sein Territorium beträchtlich aus. Mit dem Sieg über die österreichische Kaiserin Maria Theresia gewann Friedrich der Große 1740 Schlesien hinzu, und Preußen sicherte sich bei allen drei polnischen Teilungen einen gewichtigen Anteil. Als Ergebnis preußischer Einwanderungs- und Annexionspolitik stieg die Zahl der Einwohner von 2,5 Millionen im Jahre 1740 auf 5,5 Millionen im Jahre 1786. Noch gravierender war das Bevölkerungswachstum in Berlin, das sich zwischen 1700 und 1800 versechsfachte. In einer Zeit, in der auch viele zweitrangige Städte rapide anwuchsen und die Bevölkerungszahlen dort die 100000 überschritten, wuchs Berlin schneller als jede andere mitteleuropäische Stadt. Am Ende des Jahrhunderts brachte es Berlin auf 172000 Einwohner und war damit die größte Stadt Deutschlands.
Warum wuchs Berlin so rasend schnell? Hohe Geburtenraten waren in den Städten des 18. Jahrhunderts insofern keine entscheidenden Wachstumsfaktoren, als die Sterberaten gewöhnlich weitaus höher lagen. Schneller als durch die Zunahme der Geburten wurden diejenigen, die an den Mißständen städtischer Lebensweise – Hygienemangel, Infektionen und Überbevölkerung – starben, durch Zuzügler aus ländlichen Regionen ersetzt. Mit Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Lebensqualität versuchten die Preußenkönige die hohe Sterblichkeit einzudämmen. Die lokalen Verwaltungen wachten über die Einhaltung der Verordnungen zur Reinhaltung der Stadt, welche das Halten von Schweinen vor den Häusern, das Müllabladen in Marktvierteln sowie das Ausleeren von Nachttöpfen auf die Straße untersagten. Um 1770 hatten sich die staatlichen Anstrengungen, die Berliner von solchen Gewohnheiten abzubringen, offenbar bezahlt gemacht, denn endlich übertraf die Geburtenrate der Stadt ihre Sterblichkeitsrate. 1786, beim Tod Friedrichs des Großen, war die Bevölkerung so stark angewachsen, daß eine gravierende Wohnungsnot eintrat. Vielen zwei-und dreistöckigen Häusern wurde deshalb eine Etage hinzugefügt, während andere durch viergeschossige Häuser ersetzt wurden.
Berlin wuchs auch deswegen, weil es eine Hofstadt war. Ähnlich der Entwicklung in anderen deutschen Fürstentümern gelang es auch der preußischen Hohenzollern-Dynastie, die Macht der Zunft- und Handelsstädte zu brechen. Die Blüte der Hofstädte war mit dem Niedergang der freien Handelsstädte verbunden. Die Hofstädte Wien, Berlin, Dresden, München und Mannheim verzeichneten im 18. Jahrhundert viel höhere Wachstumsraten als die Handelsstädte, von denen manche sogar schrumpften. Stieg die Bevölkerungszahl in den genannten Hofstädten um durchschnittlich 340 Prozent, so sank sie in Nürnberg gleichzeitig um 33 Prozent, während sie in Hamburg, Frankfurt am Main und Leipzig im selben Zeitraum nur um durchschnittlich 52 Prozent wuchs.
Die administrativen Aufgaben des Staates und die Selbstdarstellungsbedürfnisse des Hofes zogen Beamte und Hofaspiranten an. Schreiber, Sekretäre, Hofmeister, Hausangestellte, Ladenbesitzer und Handwerker gingen in die Hofstädte, um in den Dienst von Regierungsbeamten und Höflingen zu treten. Aber warum wuchs Berlin so viel schneller als die übrigen mitteleuropäischen Hofstädte? Ein Grund dafür war, daß hier die Hauptgarnison der zahlenmäßig ungeheuer großen preußischen Armee stand, ein weiterer, daß Berlin sich zu einem Manufaktur- und Bildungszentrum entwickelte und sich somit als Magnet für manuelle wie für intellektuelle Arbeitskräfte erwies. Andere wichtige deutsche Städte konzentrierten sich zumeist auf eine einzige ökonomische Funktion und brachten deshalb nur eine relativ homogene Führungsschicht hervor. Lübeck, Hamburg und Bremen waren auf den Überseehandel spezialisiert, Frankfurt am Main, Nürnberg und Augsburg auf die Herstellung und den Verkauf von handwerklichen Produkten, und Städte wie Göttingen oder Leipzig waren vor allem für ihre Universitäten oder Verlage berühmt. In den Hofstädten München, Dresden und Mannheim setzte sich die lokale Elite vorrangig aus Regierungsbeamten zusammen. Berlin nahm eine Sonderstellung ein, weil die Stadt, neben Beamten und Finanziers, noch eine breite Intellektuellenschicht besaß.
Vor 1780 war die Bevölkerung Berlins nicht heterogen durchmischt. Jeder Stand, jede religiöse Minderheit und jede Berufsgruppe arbeitete, lebte und heiratete fast nur innerhalb des engeren Umkreises familiärer Bindungen. Die Heiratspraxis, derzufolge Ehen nur innerhalb einer ethnisch, religiös oder sozial homogenen Gruppe oder Kaste geschlossen wurden – Endogamie genannt –, entsprach der Staatsräson. Christen und nichtkonvertierte Juden konnten keine Ehen miteinander eingehen, weil es keine standesamtlichen Trauungen gab. Unter Beamten führten gemeinsame Bildungswege und gleiche Einkommensstufen zu kastenartigen Verhaltensweisen.
Das endogame Muster zeigt, daß der Thron die überkommene Gesellschaftsordnung mit Erfolg aufrechtzuerhalten vermochte. Eine kleine importierte jüdische Bourgeoisie beherrschte den merkantilen Sektor, sorgte für Verbesserungen im Bankwesen, im Handel und in der Manufaktur, ohne daß dadurch der Wohlstand des einheimischen Bürgertums wuchs. Während es der preußischen Monarchie so einerseits gelang, die ökonomische Entwicklung voranzutreiben, versuchte sie zugleich, jeglichen Wettbewerb innerhalb der nichtjüdischen Gesellschaft zu verhindern, weil dieser die Vormachtstellung des Adels gefährdet hätte. Solange der Grundbesitz die gewinnbringendste Einkommensquelle war und weiterhin ausschließlich dem Adel vorbehalten blieb, beruhte dessen privilegierter Status auf einer soliden finanziellen Basis. Und solange die Juden – die einzige verhältnismäßig reiche soziale Gruppierung neben dem Adel – gesellschaftlich verachtet, politisch entrechtet und dazu noch einer starren Kastenordnung unterworfen waren, gerieten ökonomische Entwicklung und gesellschaftliche Stabilität nicht miteinander in Widerstreit.
Dies änderte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Fortschritt und Reaktion – das monarchische Doppelziel – ließen sich immer weniger miteinander vereinbaren. Eine neuartige soziale Mobilität sorgte allmählich für die Auflösung der überkommenen Standesgrenzen. Der Adel stand vor schwerwiegenden Problemen, die sein ständisches Überleben in Frage stellten.