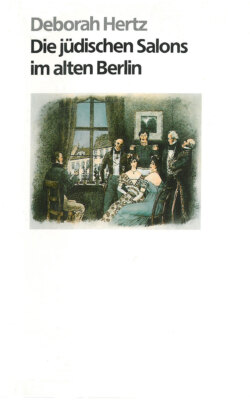Читать книгу Die jüdischen Salons im alten Berlin - Deborah Hertz - Страница 13
Die jüdische Gemeinde
ОглавлениеIm letzten Viertel des 18. Jahrhunderts ähnelten sich die Gemeinschaft der Adligen und der Juden in Größe, luxuriösem Lebensstil und Heiratsmuster, was enge, persönliche Bindungen zwischen Adligen und Juden begünstigte. In Europa wurde die glänzende, gesellschaftliche Stellung des Berliner Judentums mit Erstaunen registriert. 1801 schrieb Rahel Levin aus Paris an ihre Familie: „... ich versichere dich, ordentlich eine Art contenance giebt’s einem auch hier, aus Berlin zu sein und Jude, wenigstens mir ...“
Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ständen, die sich im Laufe des Jahrhunderts herausbildeten, ermöglichten Freundschaften zwischen einzelnen Adligen und Juden, die sich später wieder auflösten. Beide Gruppen waren sehr klein. Zwischen 1770 und 1800 lebten in Berlin rund 3500 Juden, das waren zwei Prozent der städtischen Gesamtbevölkerung. Der Anteil der Adligen lag ebenfalls bei ungefähr zwei Prozent. Daran änderte sich lange Zeit wenig, weil die Grenzen beider Gruppen dicht geschlossen waren. Die Nachfrage nach Adelstiteln war zwar groß, doch vergab Friedrich der Große Titel nur für besondere Verdienste oder als Gegenleistung für Einzahlungen in die königliche Schatzkammer. Anreize, den Adelsstand zu verlassen, fanden sich kaum, da die in Frage kommenden Berufe nur geringes gesellschaftliches Ansehen genossen oder wenig finanziellen Gewinn einbrachten. Es wollten also mehr Menschen in den Adelsstand eintreten als ihn verlassen. Anders bei der jüdischen Gemeinde. Außer einigen Rückkonversionen von reumütigen Juden gab es damals nur wenige, die zum jüdischen Glauben übertraten. Statt dessen gab es Austritte aus der jüdischen Gemeinde. Diese Austritte häuften sich ziemlich plötzlich in den letzten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, und zwar in den Kerngruppen der jüdischen Gemeinde, bei den Jungen, den Reichen und den Frauen. Doch vor dem 19. Jahrhundert verließen nur wenige Adlige und Juden ihre Gemeinschaften, um in eine andere einzutreten.
Beide Gruppen ähnelten sich auch darin, daß sie einen Großteil des Land- und Geldbesitzes in ihren Händen hielten. Zudem war bei reichen Juden und Adligen die Ansicht verbreitet, daß sie ökonomische und gesellschaftliche Vorteile davon hätten, wenn sie ihren Reichtum zur Schau stellten.
Sie war davon überzeugt, daß man Ansehen und Beziehungen gewinnen würde, wenn man ein oder mehrere Stadtpalais besaß, festliche Abendgesellschaften gab und sich in Seide kleidete. Da sie reich waren, konnten sich adlige und jüdische Familien einen großen Haushalt leisten: Diener, Angestellte, ledige Verwandte, durchreisende Gelehrte, Hauslehrer und viele Kinder füllten die Palais Unter den Linden und an der Spandauer Straße. Hinzu kam, daß die Töchter schon im jugendlichen Alter heirateten. Frühehen bedeuteten damals meistens mehr Kinder. Unter den Adligen und Juden wurden Ehen frühzeitig arrangiert, weil Heirat eine wichtige Voraussetzung war, Reichtum und Macht zu erhalten und zu vermehren. Zudem konnte die Jungfräulichkeit der Tochter garantiert und somit ihr Wert auf dem Heiratsmarkt gesteigert werden, wenn die Eheverhandlungen frühzeitig aufgenommen und eine Heirat in jungen Jahren in Aussicht gestellt wurde.
Ein Jahrhundert früher war es fast undenkbar gewesen, daß mehr Juden als einige ausgewählte Hofjuden mit ihren Familien einen aristokratischen Lebensstil erreichen könnten. Der Pessimismus der Juden in Europa hatte seinen realen Grund, hatte sich doch seit dem Spätmittelalter die Lage des westeuropäischen Judentums drastisch verschlechtert. Im 13. und 14. Jahrhundert waren die Juden aus Frankreich, England, Spanien und Portugal ganz oder teilweise vertrieben und eine Fluchtwelle nach Osten ausgelöst worden. Polen wurde für viele Juden zum Zufluchtsland. Hier konnten sie als Gutsverwalter, als Getreide- und Viehändler sowie als Gastwirte zu Wohlstand gelangen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Juden war hier stärker auf den Handel beschränkt als in Westeuropa. Da es keine Einwanderungsbeschränkung gab, erlebte Polen einen explosionsartigen Bevölkerungszuwachs.
Die Lage des Mittel- und westeuropäischen Judentums verschlechterte sich im Spätmittelalter, besonders zwischen 1490 und 1570. In allen deutschsprachigen Gebieten häuften sich die Klagen von nichtjüdischen Handwerkern und Kaufleuten darüber, daß das jüdische Geschäftsgebaren ihnen die Lebensgrundlage entziehen oder streitig machen würde. Aber auch wenn Stadträte, Fürsten oder der Kaiser erwogen hätten, die niedergelassenen Juden zu vertreiben oder die Zuwanderung aus dem Westen aufzuhalten: die Dezentralisierung war in den Ländern Mitteleuropas zu stark fortgeschritten, um eine Vertreibung im nationalen Rahmen durchführen zu können. Statt dessen wurde die Verbannung aus großen Städten, wo Handwerker und Händler die jüdische Konkurrenz fürchteten, zum typischen Verfahren in Mitteleuropa. Im 17. Jahrhundert waren deshalb Juden im deutschsprachigen Gebiet über eine größere Zahl von Kleinstädten verstreut als bisher. In den Dörfern dienten sie den Tauschbedürfnissen der ländlichen Umgebung, als Viehhändler, Händler, Hausierer, Geldwechsler, Geldverleiher und Gastwirte. Selten begegnete man ihnen in den Hofstädten. Wenn ein Fürst einen Kredit aufnehmen wollte, dann konnte er sich an die jüdischen Finanziers in den nahegelegenen Handelsstädten wenden oder an den kleinen Kreis von Juden, dem er gestattete, sich in der Nähe des Hofes niederzulassen. Die einzige große Handelsstadt, die eine dauerhafte Ansiedlung von Juden zuließ, war Frankfurt am Main. Aber auch hier drängten örtliche Gesetze die Juden aus dem Handwerksgewerbe hinaus und immer stärker in den Waren- und Geldhandel hinein.
Wo immer damals in Deutschland Juden lebten, wurden sie in der Wahl ihres Berufes und ihres Wohnsitzes stärker beschränkt und höher besteuert als in der Vergangenheit. Das mitteleuropäische Verfahren der örtlichen Verbannung wurde bis ins letzte Drittel des 17. Jahrhunderts angewendet, zuletzt 1670, als die jüdische Gemeinde aus Wien vertrieben wurde. Die Einladung des Großen Kurfürsten an einige der reichsten jüdischen Familien aus Wien, sich in Preußen niederzulassen, hob für Berlin das seit einem Jahrhundert bestehende Ansiedlungsverbot für Juden auf. Fast fünfhundert Jahre lang hatten Juden einst ununterbrochen im Kurfürstentum Brandenburg (der Provinz um Berlin) gelebt. Diese Ära der Toleranz endete im 16. Jahrhundert. 1446,1501 und 1571 kam es zu gewalttätigen Aktionen gegen die Berliner Juden; zwei Juden wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nach dem dritten Gewaltakt wurde die jüdische Gemeinde aus Berlin verbannt.
Friedrich Wilhelms Entscheidung, jüdische Familien aus Wien nach Preußen einzuladen, resultierte nicht aus einer judenfreundlichen Haltung; er und seine Nachfolger teilten einen häufig und heftig zum Ausdruck gebrachten Haß gegen die Juden. Der Kurfürst war aber der festen Überzeugung, daß einige sorgfältig ausgewählte, reiche Juden die Macht Preußens vermehren würden: Die Juden sollten die goldene Gans werden, die goldene Eier legt. Das war eine typisch preußische Entscheidung: Die preußischen Herrscher waren immer bereit, Konventionen über Bord zu werfen, wenn dies den Aufbau eines finanziell starken, militärisch erfolgreichen, autarken Staates förderte. Wie die hugenottischen Handwerker der preußischen Seidenproduktion zur Autarkie verhelfen sollten, so sollten die Wiener Finanziers flüssiges Kapital (und Auslandsbeziehungen) mitbringen, das nötig war, um die Armee auszustatten und zu ernähren, dem Hof Darlehen zu geben, neues Geld zu prägen und altes in Umlauf zu bringen sowie neue Manufakturen zu finanzieren.
Die preußische Entscheidung, so gewagt sie gewesen sein mag, war kein Einzelfall: Wien hieß Juden seit 1675 wieder willkommen. Als sich im 18. Jahrhundert die wirtschaftliche und politische Lage in Polen verschlechterte, setzte eine Auswanderungsbewegung in die entgegengesetzte Richtung ein. Mehr und mehr polnische Juden, darunter einige sehr reiche, suchten eine neue Heimat in den neuen aufstrebenden Staaten, die sich aus ihrem kleinstaatlichen Dasein zu lösen begannen. Einige polnische Juden gingen nach Preußen, und manche hatten das Glück, sich in Berlin niederlassen zu dürfen.
Berlin bot qualifizierten Juden viele Möglichkeiten. Es war die einzige deutsche Hofstadt, wo sich eine jüdische Gemeinde von beachtlicher Größe bilden durfte. Es gab dort kein ausgewiesenes Getto, die Wohnbeschränkungen waren minimal, und die wohlhabendsten Juden lebten im elegantesten Viertel der Stadt. Zudem entwickelte sich Berlin zum Zentrum des regionalen und überregionalen Handels und der Textilproduktion sowie zum Sammelort für Gebildete und Verleger. Nach und nach wurde ausgewählten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde gestattet, was den meisten europäischen Juden im 18. Jahrhundert verwehrt worden war. Als Gegenleistung für ihre finanziellen Verdienste räumte Berlin einer kleinen Gruppe von Juden die Möglichkeit ein, enorme Geldmengen zu erwerben – die notwendige materielle Voraussetzung für ihre kulturelle und gesellschaftliche Integration.
Wegen dieser besonderen Möglichkeiten in Berlin hatten weitaus mehr Juden den Wunsch, dort zu leben, als zugelassen wurden. Auch in Berlin waren Juden Repressionen ausgesetzt; doch den Zeitgenossen stellte sich das anders dar. Zu einer Zeit und an einem Ort, wo jeder Untertan und nicht freier Bürger war, war der Grad der Repression schwierig zu ermessen. Es lag im Wesen einer Ständegesellschaft, daß religiöse und soziale Gemeinschaften verschieden hoch besteuert wurden und ihre Mitglieder nur in bestimmten Berufen arbeiten durften. Mit Gesetzeskraft wurde dies durchgesetzt. In diesem Kontext gesehen, war die Tatsache als solche, daß im 18. Jahrhundert in Preußen bestimmte Regeln und Verfahren für die jüdische Gemeinde entwickelt wurden, kein Ausdruck einer Diskriminierung. Auch die französischen und die böhmischen Kolonien waren spezifischen Bestimmungen unterworfen. Doch waren die Vorschriften, die Steuerbelastung und die beruflichen Beschränkungen, die der jüdischen Gemeinde auferlegt wurden, in besonderem Maße drückend. Im Vergleich mit anderen Ständen, die ähnliche Absprachen mit der Krone hatten, zahlte die jüdische Gemeinde viel höhere Abgaben für das grundlegendste aller Rechte, nämlich vom König vor Verfolgung geschützt zu werden.
Die Situation der jüdischen Gemeinde war äußerst „anormal“. Die reichen Berliner Juden waren als Gruppe zu groß, um als Hofjuden bezeichnet zu werden. Doch teilten sie mit ihren Vorgängern im 17. Jahrhundert das Los der „mächtigen Sklaven“. Einige Berliner Juden gehörten zu den reichsten Männern Mitteleuropas. Wenn sie aber nicht das Glück hatten, von den gesetzlichen Vorschriften befreit zu werden, durften sie Berlin nur durch ein einziges Tor passieren, wo sie zudem noch Zoll bezahlen mußten. Moses Mendelssohn empfing seine berühmten Gäste unter den Augen von zwanzig Porzellanaffen: Sein intellektueller Ruhm hatte ihn nicht von der Zwangsabnahme dieser Affen aus der angeschlagenen Luxuswarenindustrie Friedrichs des Großen befreien können. Diese Affen waren so überbezahlt, daß man sie nicht weiterverkaufen konnte; sie waren ein Symbol für die privilegierte Machtlosigkeit der Gemeinde. Als mächtige Sklaven konnten die Berliner Juden aus ihrer „anormalen“ Lage nur dadurch Vorteile ziehen, daß sie ihresgleichen überwachten. Gemeindeälteste suchten regelmäßig den Gasthof außerhalb der Stadttore auf und entschieden, welche wandernden Juden in die Stadt einziehen durften und für wie lange. Aber bevor ein Jude ein „mächtiger Sklave“ werden konnte und als solcher dienen durfte, mußte das erste Hindernis überwunden werden, nämlich ein Niederlassungsrecht für Preußen zu erhalten. Das wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts immer schwieriger. Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) und Friedrich der Große beschränkten die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Juden nach und nach und erhöhten die Steuern für die jüdische Gemeinde erheblich. Ab 1730 war es Juden in Preußen verboten, Kleinhandel zu betreiben, und schließlich wurde ihr möglicher Tätigkeitsbereich auf den Fernhandel mit Luxusgütern, auf die Heeresausstattung und die Münzprägung eingeschränkt. Die königliche Verordnung von 1750 führte zu weiteren Einschränkungen des jüdischen Lebens: Nur noch ein Sohn durfte sich in Preußen niederlassen, und der Handel wurde noch mehr begrenzt. Diese Reglementierungen hatten eine Konzentration der jüdischen Aktivitäten zur Folge und verschafften den Juden Vorteile über die nichtjüdischen Kaufleute. Juden durften neue Waren, wie Schokolade und Kaffee, importieren, was nichtjüdischen Kaufleuten verboten war, und sich im Außenhandel betätigen, wo sie Kontakte besaßen, von denen nichtjüdische Kaufleute ausgeschlossen waren. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß viele Rechte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verlorengingen, aber es gab dafür entschädigende Regelungen.
Dem wirtschaftlichen Reglement, dem die jüdische Gemeinde unterworfen war, entsprach eine gleichermaßen komplexe rechtliche Hierarchie. An der Spitze standen Juden, die auf drei Arten geschützt waren. Ganz oben die „außerordentlich“ geschützten Familien, deren Oberhäupter ein Generalprivileg besaßen, das ihnen und ihren Kindern die gleichen Wohn- und Arbeitsrechte einräumte wie den nichtjüdischen Kaufleuten. Unter Friedrich dem Großen gab es etwa hundert Familien mit Generalprivileg. Auf der nächsten Stufe standen die 63 „gewöhnlich“ geschützten Juden und ihre Familien. Die dritte Gruppe von privilegierten jüdischen Familien stellten 203 geschützte Juden dar, die weniger Privilegien besaßen als die „gewöhnlich“ geschützten Juden. Insgesamt umfaßten die drei Gruppen von geschützten Familien ungefähr vierhundert Juden. Unterhalb der geschützten Juden standen drei Gruppen von ungeschützten Juden: die Gemeindebediensteten, die „geduldeten“ Juden und die Hausangestellten. Zu den Bediensteten gehörten Rabbiner, koschere Metzger, Friedhofswärter und Religionslehrer, die keine Schutzbriefe besaßen, sondern nur Aufenthaltsgenehmigungen, die nicht auf ihre Kinder übertragbar waren. Die „geduldeten“ Juden waren oft die zweit- und drittgeborenen Kinder der geschützten Juden oder Kinder von Gemeindebediensteten. Die dritte Gruppe ungeschützter Juden bildeten die Hausangestellten. Sie durften nicht heiraten, und ihre Aufenthaltsgenehmigung endete mit ihrer Anstellung. Da die entsprechenden Quellen darüber wenig Auskunft geben, kann man die rechtliche Hierarchisierung der Gemeinde nur schwer mit ihrer ökonomischen Gliederung in Beziehung setzen.
Auch die Struktur der Gemeinde läßt sich wegen der nahezu unüberschaubaren Beschränkungen, die vor allem Eheschließungen und Nachkommenschaft regelten, nur schwer rekonstruieren. Von diesen Beschränkungen waren Altersstruktur, Familiengröße und wahrscheinlich auch das Geschlechterverhältnis stark betroffen. Um die Sozialstruktur der Gemeinde skizzieren zu können, muß man zuallererst die Zahl der männlichen Erwachsenen schätzen, deren wirtschaftliche Aktivität die gesellschaftliche Position der Familien festlegte. Wenn wir davon ausgehen, daß alle männlichen Erwachsenen eine Familie versorgten und die jüdische Familie der Durchschnittsfamilie des 18. Jahrhunderts mit fünf Personen entsprach, dann kann man – bei einer durchschnittlichen Bevölkerungsgröße von 3535 zwischen 1770 und 1779 – mit 700 erwachsenen Männern rechnen. Die beiden veröffentlichten Schätzungen über die Anzahl jüdischer Familien in Berlin liegen etwas niedriger, da sie mehr als fünf Personen pro Familie annehmen. Ein Historiker ging von 600 jüdischen Familien in der Stadt aus, andere von ungefähr 450. Nimmt man die 600 Familien als Basis, dann würden die 300 bis 400 reichen Schutzjuden mit ihren Familien die Hälfte der Gemeinde ausmachen. Geht man von 450 Familien aus, läge ihr Anteil sogar bei zwei Drittel.
Die Entstehung einer solch großen Elite war unvermeidlich, bedenkt man, daß die Zusammensetzung der Juden, die sich in Berlin niederlassen durften, der streng eingehaltenen Vorschrift des Königs entsprach, nämlich möglichst viele wichtige wirtschaftliche Dienstleistungen von möglichst wenigen ortsansässigen Juden ausführen zu lassen. Zur jüdischen Gemeinde in Berlin zählten vergleichsweise viele Finanziers, die die hohen Steuern bezahlen und noch reicher werden konnten. Dementsprechend eng waren die Verflechtungen zwischen den Schutzjuden und den reichen Juden, was nicht erstaunlich ist, da manche „Freiheiten“ nur denen gewährt wurden, die dafür bezahlen konnten.
Im Vergleich mit der Sozialstruktur der nichtjüdischen Bevölkerung gab es in Berlin viele reiche Juden. Die nichtjüdische Oberschicht in Berlin stellte nicht mehr als ein Zehntel der Bevölkerung. Auch im Vergleich mit der Sozialstruktur der preußischen Juden insgesamt war die Elite der jüdischen Gemeinde in Berlin außergewöhnlich groß. Im Jahre 1800 war nur ein winziger Prozentsatz der preußischen Juden Bankiers, Finanziers und Unternehmer. Außerdem war die Oberschicht in anderen deutschen Städten mit reichen jüdischen Gemeinden nirgendwo so groß wie in Berlin. In Hamburg, der größten jüdischen Gemeinde, waren nur sechs Prozent der Gemeinde wohlhabend, in Frankfurt am Main höchstens zehn Prozent. In London, Paris und Amsterdam lebten reiche jüdische Finanziers, aber in keiner dieser drei Städte hatten die reichen Juden eine so starke zahlenmäßige Übermacht innerhalb der Gemeinde wie in Berlin, weil in allen drei Städten der Anteil der armen Juden besonders groß war. Im Osten, im nordwestlichen Teil Polens, das zwischen 1792 und 1807 zu Preußen gehörte, gab es keine großen Städte, und die Mehrzahl der jüdischen Männer dort waren arme Hausierer.
Doch die reichen Juden in Berlin hätten ihre Geschäfte mit Anleihen, Lieferungen, Verkäufen und Investitionen ohne die Hilfe der armen Juden in den kleinen Orten im Osten nicht erfolgreich durchführen können. Wirtschaftshistoriker und auch Antisemiten haben hervorgehoben, daß die Kooperation zwischen den jüdischen Finanziers aus verschiedenen europäischen Hauptstädten eine wichtige Voraussetzung für den damaligen finanziellen Erfolg der Juden war. Selten wurde erwähnt, daß diese internationalen Beziehungen ein integraler Bestandteil der jüdischen Sozialstruktur waren. Pfandleiher, Hausierer, Höker, kleine Geldmakler und Geldverleiher im Osten brachten die abgewerteten Münzen in Umlauf, kauften Rohstoffe und verkauften Waren auf Kommission für die reichen Juden in Berlin. Sie waren dadurch für den wirtschaftlichen Erfolg der Berliner Juden von entscheidender Bedeutung. In Berlin gab es deshalb so viele reiche Juden, weil die preußischen Herrscher vom Handel der reichen jüdischen Finanziers zu profitieren hofften und die armen Juden aus der Stadt fernhielten.
Obwohl es der jüdischen Elite erlaubt war, dem Staat zu dienen, agierte sie doch in einem Klima, das einer finanziellen und industriellen Entwicklung abträglich war. Historiker haben bezweifelt, daß Kaufleute, gleich welchen Glaubens, einen bedeutenden Beitrag zur industriellen Entwicklung Preußens geleistet haben. Dabei muß man in Betracht ziehen, daß die Nöte der Kaufleute vor allem durch Zwänge, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen, ausgelöst wurden. Preußen konnte keine Industrie aufbauen, solange das Landwirtschaftssystem feudal und die Standesgrenzen gesetzlich geschützt waren. Ein rigider, den preußischen Verhältnissen schlecht angepaßter Merkantilismus kam erschwerend hinzu. Daß ein schwacher kommerzieller Sektor den kapitalhungrigen Adel häufig mit Handelsgewinnen fütterte, löste einen gefährlichen Kreislauf aus. Der Import von ausländischen Fertigprodukten war verboten, und Investitionen in der heimischen Luxusgüterindustrie galten als schlechte Anlagen. Öffentliche Banken, in denen öffentliche Gelder zirkulieren konnten, gab es nicht. Es war auch nicht ratsam, Bargeld anzuhäufen, weil periodische Geldabwertungen zu einer Dauerinflation führten.
Berliner Kaufleute machten Geld, indem sie Rohstoffe an Handwerker verkauften, die Armee versorgten und Fernhandel betrieben. Aber ihre Gewinne landeten oft in adligen Händen, weil sie illegal adlige Ländereien aufkauften, Pfandbriefe auf adligen Besitz erwarben, verschwenderischen Adligen in der Stadt hohe private Kredite gaben oder eine großzügige Mitgift für ihre Töchter zahlten, wenn diese von Adligen geheiratet wurden.
Trotz dieser eher düsteren Fakten gibt es optimistische Interpretationen hinsichtlich der Rolle der Berliner Kaufleute, ob diese nun Juden waren oder nicht. Eine Einschätzung verlegt sogar die Anfänge der industriellen Revolution in Preußen in diese Ära. Der Handel mit und die Produktion von Gütern für die Armee brachten den französischen und jüdischen Unternehmern während des Siebenjährigen Krieges so große Gewinne, daß Privatbanken aus Handelsunternehmen hervorgingen, die die Kredite und Investitionen organisierten. Die neue, 1803 eröffnete Börse bestätigt, wie notwendig die organisierte und öffentliche Koordination von Investitionen war. Neue Manufakturen wurden gegründet, die Gebrauchsgüter wie Wolle, Kriegsausrüstung, Münzen und Zucker oder Luxusartikel wie Bänder, Samt, Seide und Porzellan herstellten. Auch wenn einige Banken und Luxusgütermanufakturen die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts nicht überlebten, so hinterließen sie doch ein beträchtliches Erbe: qualifizierte Facharbeiter, beschleunigter Warenumschlag, neue Techniken und eine große Kapitalakkumulation. Wie man das institutionelle Klima einschätzen soll, in dem Berliner Kaufleute arbeiteten, hängt davon ab, welchen Stellenwert man der Produktion und Distribution von Luxusgütern für die Entstehung des modernen Kapitalismus einräumt. Jüdische Kaufleute spielten eine zentrale Rolle im Berliner Luxusgüter-Handel; die Hauptabnehmer von Luxusartikeln waren adlige Mitglieder der Hofgesellschaft und reiche Kaufleute. In einer Zeit, in der es riskant war, in Manufakturen zu investieren, war es ökonomisch sinnvoll, Gemälde, Schmuck und Edelsteine zu kaufen. Diese Geldanlage war gerade für Bürger, die auf legalem Wege kein Land erwerben konnten, am sichersten. Natürlich waren nicht alle Berliner Kaufleute Juden. Die meisten erfolgreichen nichtjüdischen Kaufleute kamen aus hugenottischen und slawischen Immigrantenfamilien. Einige nichtjüdische Kaufleute handelten mit Edelmetallen. Doch sie wurden durch keine staatliche Verordnung auf Münzprägung verwiesen, und dadurch fehlte ihnen der Anreiz, sich auf den Fernhandel mit Gold und Silber zu konzentrieren. Der Silberhandel und die Münzprägung spielten eine zentrale Rolle beim ökonomischen Aufstieg Preußens. Die rasche Entwicklung der kommerziellen Wirtschaft in Europa hatte zu einem Silbermangel geführt. Die jüdischen Münzpräger waren zu unverzichtbaren Lieferanten des Metalls geworden. Den nichtjüdischen Kaufleuten fehlten auch die internationalen Beziehungen der Juden, die für den Handel mit Metallen und Münzen wichtig waren. Wenn jüdische Finanziers Familienbanken eröffneten, um die Gewinne aus der Münzprägung und dem Luxushandel zirkulieren zu lassen, dann taten sie der Krone und dem Adel damit einen Dienst. Ihre „privaten“ Banken erfüllten noch bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Funktion in Berlin. Nur wenige nichtjüdische Kaufmannsfamilien gründeten Banken, und die neue königliche Bank verfügte über zu wenig Kapital, um einflußreich zu werden. Im Verlauf des Jahrhunderts gerieten immer mehr Adlige in Geldnot, und folglich stieg von 1770 an die Zahl der Privatkredite, die jüdische Bankiers den verarmten Adligen gewährten. Da die Bankiers und Kaufleute ihre Büros zu Hause hatten und das Vergnügen an Luxusartikeln mit ihren Geschäftspartnern teilten, gestalteten sich die persönlichen Kontakte würdevoller und intimer.
Die damalige Rolle der jüdischen Stellvertreterbourgeoisie zeigt, wie stark die Macht des städtischen Handelskapitals durch die feudalen Strukturen begrenzt wurde. Im vorindustriellen Rahmen funktionierte die kleine Kaufmannsschicht eher wie eine geschlossene Kaste innerhalb des Adelsstandes, so daß von ihr keine Impulse für Industrialisierung oder soziale Umstrukturierung ausgehen konnten. Es ist zutreffend, vom kastenähnlichen Charakter der Kaufmannselite im Feudalismus zu sprechen, zumindest was Berlin anbetrifft. Denn sowohl die nichtjüdischen als auch die jüdischen Kaufleute waren durch einen breiten sozialen Graben von anderen gleicher Einkommensstufe getrennt, vor allem von Landbesitzern oder Beamten, aber auch von den unteren Schichten innerhalb ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft. Darüber hinaus war die Kluft, die nichtjüdische und jüdische Kaufleute – bedingt durch Sprache, Familiengröße und Lebensstil – voneinander trennte, genauso tief und breit wie die zwischen den Kaufmannseliten und den unteren Schichten.
Friedrich der Große hatte seine Vorstellungen durchgesetzt: Kaufleute beider Glaubensrichtungen ließen Kapital zirkulieren, ohne daß dadurch die Standesgrenzen tangiert wurden. Die reichen Kaufleute verursachten keine radikale Transformation der im wesentlichen starren Sozialstruktur. Trotz der absolutistischen und merkantilistischen Zwänge zahlte sich die Entscheidung, Juden im Land aufzunehmen, für die preußische Entwicklung aus. Indem sie Münzen prägten und in Umlauf brachten, das Heer mit Uniformen und Lebensmitteln versorgten, Adligen Kredite zu hohen Zinssätzen gewährten und örtliche Handwerker mit Rohmaterialien belieferten, förderten die reichen Juden Preußens die kommerzielle Entwicklung und taten sich dabei selbst einen guten Dienst.
Das Hauptparadoxon im jüdischen Leben während des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts war, daß die kulturelle und soziale Integration trotz der entwürdigenden und starken rechtlichen Beschränkungen rasch voranschritt. Der damalige jüdische Wohlstand ist weit weniger erstaunlich als die kulturelle Anpassung und soziale Integration, die dieser Reichtum ermöglichte. Juden durften nur deshalb in Berlin leben, weil sie bestimmte ökonomische Funktionen übernahmen. Reichtum war eine notwendige Voraussetzung für die Berliner jüdische Elite, um sich kulturell anpassen und sozial integrieren zu können. Doch um spezifische Entwicklungen zu erklären, um eine Antwort auf die Fragen zu finden, warum reiche Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Berlin Bücher auf deutsch schrieben, ihre Töchter Henriette nannten und Fürsten zum Tee einluden, müssen wir mehr über das Leben in Berlin erfahren.