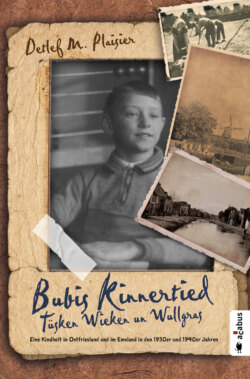Читать книгу Bubis Kinnertied. Tüsken Wieken un Wullgras - Detlef M. Plaisier - Страница 12
ОглавлениеMeine Kindheit auf dem Fehn
Meine Brüder, die acht und neun Jahre älter sind als ich, kümmerten sich wenig um mich. Sie hatten andere Interessen und waren bereits auf ihre Weise erwachsen.
Meine Eltern hatten meine Tierliebe erkannt und schenkten mir einen kleinen Ziegenbock. Er war lustig anzusehen, besonders sein Spitzbart. Zu unserem Haus in der 1. Südwieke gehörte, nach vorn zur Wieke gelegen, eine saftige Wiese. Neben Gras wuchs hier auch Löwenzahn. Zahlreiche Marienblümchen sorgten stets für eine bunte Mischung an Wiesenblumen, die noch durch Kuckucksblume10 und Vergissmeinnicht bereichert wurden. Grüner saftiger Klee blühte zweifarbig in weiß und rot.
Hier labte sich Fritzchen, wie ich meinen Spielgefährten nannte. Gemeinsam tobten wir und liefen um die Wette. Über Monate ging so das lustige Treiben, und Fritzchen hatte sich sehr an mich gewöhnt. Er merkte, dass ich ihn mochte, und wurde richtig anhänglich.
Doch eines Tages geschah es. Fritzchen war kräftig und somit für mich zu stark geworden. Er hatte Ansätze von Hörnern gebildet und wollte nun auch deren Wirkung ausprobieren. So rannte er an einem schönen Sommermorgen auf mich los. Nicht etwa, um mich wie bisher sanft zu begrüßen und zum Spielen aufzufordern. Nein, er hatte eine Kopfhaltung, die ich bisher von ihm nicht kannte. Lang gestreckt, mit zu den Vorderbeinen angewinkeltem Kinn, kam er angerannt. Wir stießen mit voller Wucht zusammen, und ich fiel rücklings auf den Boden. Fritzchen sprang mit allen vier Beinen auf mich und bohrte seinen Gehörnansatz in meine Brust. Zum Glück war er noch zu unausgebildet, um mich zu verletzen. Ich verspürte nur einen würgenden Druck am Halsansatz. Von der Attacke meines lieben Spielgefährten war ich so überrascht, dass ich in diesem Moment kein Wort über die Lippen brachte. Ich ergab mich in mein Schicksal. Meine Mutter hatte den Vorfall bemerkt und kam sogleich herbeigeeilt. Sie schimpfte mit Fritzchen, was ihn aber nicht beeindruckte. Natürlich zerrte sie ihn am Halsband zur Seite und befreite mich aus der Bodenlage. Ich rannte aus der Gefahrenzone und brachte mich, von dem Erlebten, aber besonders von der veränderten Verhaltensweise des ansonsten doch so anschmiegsamen Ziegenbocks ganz benommen, in Sicherheit.
Von diesem Tage war es vorbei mit dem Spiel und dem Umherlaufen. Fritzchen könne so nicht mehr bei uns gehalten werden, sagte mein Vater zu mir und fand damit die volle Zustimmung meiner Mutter. Meine Brüder, die abends von dem Ereignis mehr zufällig erfuhren, lachten und nannten ihren kleinen Bruder Schlappschwanz. Mit meinen vier Lebensjahren ließ mich das noch ziemlich kalt. Mehr beeindruckt, um nicht zu sagen beunruhigt war ich von den Folgen, die Fritzchen ausgelöst hatte. Er wurde von Vater am nächsten Morgen an einer langen Leine befestigt, und seine Freiheit auf der Wiese hatte ein Ende. Außer einem Streicheln immer in dem Moment, wo die Leine straff war und Fritzchen keinen Raum mehr hatte, um mich mit Anlauf niederzustrecken, blieb mir das Spielen untersagt. Aber das Streicheln war ja immerhin noch etwas, konnte ich doch mit einem lebendigen Spielgefährten auch kindliche Worte wechseln, und das meistens auf ostfriesischem Platt. Schließlich war es ja ein Zicklein, das in Ostfriesland geboren worden war.
Mein Vater kündigte alsbald an, dass der Ziegenbock zu kräftig geworden und nicht mehr als Spielgefährte für mich geeignet sei. Ich ahnte Schlimmes. Nur wenige Tage vergingen, und ich hatte Gewissheit: Ich musste mich von meinem Spielgefährten trennen. Vater teilte mir mit, dass er Fritzchen verkauft habe und er ihn gemeinsam mit mir fortbringen werde.
Ich durfte Fritzchen an einer kurzen Leine halten und langsam mit ihm auf dem Sandweg in Richtung Untenende gehen. Rechts lag die wasserführende Südwieke, linksseits standen Dornenhecken, die sich mit Unterbrechungen an den Einmündungen der Seitenwieken und den Hauszufahrten fortsetzten. Mein Vater ging längsseits und löste mich schon bald als Leinenführer ab. Ich redete ihm wohl zu viel mit dem Ziegenbock und er wollte die Sache schnell hinter sich bringen. So trabten wir stumm entlang der 1. Wieke. Nur Fritzchen ließ ab und zu ein zaghaftes Meckern ertönen.
Plötzlich änderte sich der monotone Schritt. Er klang härter, und auch Fritzchen erschrak, sprang seitwärts und ließ einige der typischen runden, wie Lakritz anmutenden Kügelchen auf den Straßenbelag fallen. Wir hatten die sandige Wieke verlassen und die mit Klinkern gepflasterte Straße in Westrhauderfehn Untenende erreicht. Es ging vorbei an Eden und Kolk, Fischhandlung Hündling und Holzhandel Artur Loger. Vor der Drogerie Prahm bogen wir in eine kleine Pforte ein, gingen um ein Haus, um es dann von hinten zu betreten. An der rechten Seite des Ganges befand sich ein leerer Stall, der aus Lehm gefertigt war. Hier konnten sowohl Schweine als auch Schafe und Ziegen heimisch gewesen sein.
Ich wartete, hielt mein Zicklein an der Leine, und wurde bald von einer netten Frau begrüßt. Ich durfte Fritzchen in den Stall bringen und ihm Strick und Halsband abnehmen. Die Frau, sie hatte schwarze glänzende Haare und große dunkle Augen, drückte mir einen großen Kandisbrocken in die Hand, strich mir mit der Hand über den Kopf und verabschiedete uns freundlich lächelnd. Mein Vater sagte noch, alles Weitere habe er bereits mit ihrem Mann erledigt. So gingen wir heim …
Dieses Erlebnis hatte ich zu Beginn der dreißiger Jahre. Ich konnte nicht ahnen, dass mir später das Zusammentreffen mit der netten Frau mehrfach wieder in Erinnerung gerufen werden würde.
Heute weiß ich, wie froh mein Vater war, für das kleine Zicklein fünf Reichsmark, sprichwörtlich einen Heiermann, bekommen zu haben. Es war die Zeit der großen Arbeitslosigkeit, und man musste jeden Pfennig umdrehen. Politisch war es die Zeit der Ungewissheit.
Einige Tage nach dem Abliefern von Fritzchen kam ein Herr bei uns in die Küche und legte fünf Reichsmark auf den Tisch mit dem Bemerken, das sei für das Ziegenlamm. Als er gegangen war, hörte ich meinen Vater sagen, der Jude sei als Viehhändler und auch als Mensch sehr zuverlässig.
Ich hatte natürlich von diesem ganzen Handel keine Ahnung und verstand auch von Juden nichts. Dass es schon damals wegen der Juden politisch Streit gab und sie als Volksfeinde verurteilt wurden, erfuhr ich erst später. Für mich war der Viehhändler, sein Name war Weinberg11, ein Onkel wie jeder andere auch. Hatte seine Frau mir nicht einen dicken Kluntje geschenkt? Der Gedanke an die nette Frau beruhigte mich. Hier war mein Fritzchen wohl gut aufgehoben.
Mein Vater war im Ersten Weltkrieg vier Jahre an der Front in Frankreich eingesetzt gewesen. Er musste als Sanitäter den Stellungskrieg in den Ardennen mitmachen, zog auch mit nach Sedan und in den Argonnerwald. Er nahm mich, wenn er abends bei Tisch saß und die Petroleumlampe einen angenehmen Schein verbreitete, auf seine Knie und sang mir mit kräftiger Stimme Lieder aus seiner Soldatenzeit vor. Ich erinnere mich, dass in vielen dieser Lieder die Sehnsucht der Frontsoldaten nach der Heimat besungen wurde. Aber es gab auch viele Texte, die das Soldatenleben verherrlichten, um die Jugend positiv im Sinne der Wehrmacht einzustimmen. Dies sind einige der Texte, an die ich mich erinnere:
Fern bei Sedan, wohl auf den Höhen,
ein Soldat auf Posten stand …
Argonnerwald, Argonnerwald, ein stiller Friedhof wirst du bald / In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut …12
Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr / Das muss er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer / Büblein, wirst du ein Rekrut, hau dem Hauptmann auf die Schnut …13
Meine Mutter sang mit mir alte deutsche Volkslieder. Dazu gehörten unter anderem „Am Brunnen vor dem Tore“, „Ännchen von Tharau“ und viele Weihnachtslieder.
Viele Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges waren damals, das hatte ich als Kind schnell mitbekommen, im Stahlhelmbund organisiert. Auch mein Vater gehörte dazu. Eines Tages bekam er ein Verwundetenabzeichen überreicht. Es war, unter dem Eindruck der aussichtslosen Wirtschaftslage mit sieben Millionen Arbeitslosen, eine Zeit der politischen Grabenkämpfe, in der sich radikale Parteien immer mehr Gehör verschafften. Die Parteien der Weimarer Republik wehrten sich verzweifelt, aber angesichts der schlechten Verhältnisse fehlten ihnen überzeugende Argumente und Rezepte.
Ich erinnere mich, dass eines Abends auf der 1. Südwieke, die in den dreißiger Jahren noch schiffbar war, ein Paddelboot mit vier Sportlern vorbeifuhr. Sie sangen gemeinsam:
Frisch, fromm, fröhlich, frei / Sei die deutsche Turnerei Heil Turnvater Jahn!
Eines Tages hörte ich, wie mein Vater zu meiner Mutter sagte, oben in der 1. Südwieke, am Wegesrand bei der Hahnentanger Mühle, habe die NSDAP ein Wahlplakat aufgestellt. Das Bild von Adolf Hitler habe man mit Eiern beworfen. Dies muss vor 1933 gewesen sein, als eine Wahl zum Reichstag anstand, also wahrscheinlich 1932.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein weiteres Erlebnis. Vom Untenende kommend, also an der rechten Seite der 1. Südwieke in Richtung Klostermoor marschierend, zogen Frauen und Männer an unserem Haus vorbei. Sie trugen Fackeln und sangen Lieder. Es waren vermutlich Kampflieder der NSDAP. Viele trugen Uniform, auch vom Stahlhelmbund. Sie sangen das Stahlhelmlied:
Hakenkreuz am Stahlhelm/Schwarz-weiss-rotes Band …14
Es musste etwas geschehen sein. Mein Vater verbot mir eindringlich, „Heil Moskau“ zu sagen. Auf meine Erwiderung, ob das auch gelte, wenn ich hinter dem Haus alleine sei, gab er zur Antwort: „Auch da nicht. Niemals mehr, hörst du!“. Damit war für mich der Fall erledigt. Wenn wir Besuch bekamen oder jemand an unserem Haus mit dem Fahrrad vorbeifuhr, war mein Gruß immer höflich ostfriesisch „Moin“. Das war schon immer so und gehörte sich für einen Bubi vom Fehn!
Mein Vater wie auch meine Mutter hatten sogleich erkannt, dass die neue starke Partei keinen Spaß verstand, und sie hatten wohl schon erfahren, dass die Uniformträger in den braunen Jacken dem nationalsozialistischen Gedankengut auch mit Prügel Geltung verschafften. Nur mein Onkel, der Bruder meines Vaters mit dem seltenen ostfriesischen Vornamen Sünke, passte sich nicht der neuen Zeit an. Wenn er uns besuchte, er wohnte in der 4. Südwieke, dann war sein Gruß unverändert „Rot Front! Heil Moskau!“. Dazu sang er dann das Lied „Freiheit, die ich meine“.15 Wie ich später erfuhr, war Onkel Sünke keineswegs ein Kommunist. Vielmehr war der verbotene Gruß sein persönlicher Protest gegen Hitler.
Unser Haus wurde zur linken Hälfte von einem Herrn Graf bewohnt. Seine Frau war verstorben. Meine Mutter hatte mit am Sterbebett gesessen. Als Frau Graf die Augen für immer geschlossen hatte, fragte ihr Mann: „Wo mag sie wohl das Geld versteckt haben?“ Er fand es dann unter der Matratze an ihrer Seite. Ich habe viele Münzen und Scheine einen Tag später hinter dem Haus neben dem Misthaufen entdeckt. Meine Brüder dämpften meine Freude über den Fund sogleich: Es waren Münzen und Scheine aus der Inflationszeit. Der Fund war also wertlos. Dafür konnte ich einen Wecker behalten, den Herr Graf weggeworfen hatte. Zwar war das Uhrwerk defekt, aber er weckte immer noch, wenn man ihn aufgezogen hatte. Es war ein richtiges Ungetüm: Im Umfang so groß wie eine kleine Suppenschüssel, schlugen an der Oberseite zwei kleine Hämmer gegen eine dicke Glocke. Das Wecksignal verursachte ohrenbetäubenden Lärm.
Bei Herrn Graf wohnte oft über mehrere Monate eine Frau namens Lisa, eine aus seiner Familie stammende Verwandte aus dem Ruhrgebiet. Sie war eine sehr christlich eingestellte Frau, die sonntags regelmäßig den Gottesdienst aufsuchte und sich auch am Gemeindeleben rege beteiligte. Für mich war sie einfach „Tante Lisa“. Von ihr bekam ich ein Kinderbuch geschenkt mit der Widmung „Für Bubi von Tante“. Ja, ich war eben für alle der kleine Bubi.
Eines Tages, als ich im Hof spielte, rief mir Tante Lisa zu: „Hörst du, der Reichspräsident, unser Paul von Hindenburg spricht.“ Ich muss bestimmt dumm geschaut haben, denn was wusste ich damals von Hindenburg und vom Reichspräsidenten. Rückblickend ist mir klar: Es war der 30. Januar 1933, der Tag der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler.
Mein ältester Bruder hieß Hermann. Mit ihm verstand ich mich besonders gut, er hatte immer Zeit für mich. Hermann war sehr musikalisch und spielte mit Vorliebe auf seiner Mundharmonika.
Eines Tages bekam mein Bruder Besuch von Herrn Watermann. Die Familie wohnte an dem Verbindungsweg zwischen der 1. und 2. Südwieke, im letzten Haus vor der Gaststätte Ammann. Ich kannte Herrn Watermann, weil er die Tageszeitung, das Fehntjer Blatt, austrug. Wir nannten unsere Zeitung so, weil darin täglich die Neuigkeiten vom Fehn zu lesen waren. Gedruckt wird die Tageszeitung von jeher in Westrhauderfehn im Untenende bei Siebe Ostendorp.
Abb. 3: Westrhauderfehn, Kreuzung 2. Südwieke / Papenburger Weg, rechts der Gasthof Ammann (1920er Jahre)
„Onkel Watermann“, wie ich ihn nannte, hatte ein besonderes Merkmal. Auf seinem Rücken befand sich ein leichter Buckel, den er geschickt unter der bauschigen Windjacke kaschierte. Apropos besondere Merkmale: Auf dem Fehn fuhr ein Mann mit dem Fahrrad, der keine Nase hatte. Die beiden Nasenlöcher im Gesicht waren schaurig anzusehen. Es waren einfach zwei Öffnungen zwischen den Augen, die er ab und zu zum Glück mit einem Verband abgedeckt hatte. Jan Sünnernöös, Jan ohne Nase, wurde er genannt, und er flößte mir als Kind immer Respekt ein.16
Zurück zu „Onkel Watermann“: Er kam zu meinem Bruder Hermann wegen eines besonderen Anlasses. Es hatte etwas mit einem „Bund“ zu tun. Wie Watermann, sollte auch Hermann dieser Vereinigung beitreten. Wie ich heraushörte, handelte es sich um den Kyffhäuserbund.
Der Kyffhäuserbund soll die Legende von Friedrich Barbarossa wachhalten, der im Kyffhäuser, so die Sage, für Deutschland Wache hält. Mein Bruder wurde in den Bund aufgenommen und erhielt als äußeres Zeichen seiner Zugehörigkeit eine Windjacke in hellgrauer Farbe überreicht. Das war praktisch seine Uniform. Er musste für den Bund Verpflichtungen übernehmen und an Treffen teilnehmen.
Die Ortsgruppe Westrhauderfehn des Kyffhäuserbundes gründete einen Spielmannszug, und mein Bruder Hermann sollte darin als Trommler mitwirken. Für diesen musikalischen Auftritt bekam er die Ausrüstung gestellt. Er begann sogleich mit den Übungen auf der Trommel, die er allein und abseits jeglicher Zuschauer auf unserer Wiese durchführte. Er trommelte in jeder freien Minute, was das Zeug hielt. Sein ständiges Üben und seine Ausdauer wurden belohnt. Er wurde in dem Spielmannszeug ein vorzüglicher Trommler. Seine Versuche auf der Flöte hatten dagegen schnell ein Ende. Mundharmonika und Trommel blieben seine Lieblingsinstrumente. Im Gegensatz zu Hermann war mein Bruder Johann unmusikalisch und brummte nur beim Singen17.
Auch sollte ich recht bald wieder vom Viehhändler Weinberg hören. Mein Vater erzählte meiner Mutter, dass der Jude von Deutschen kein Vieh mehr aufkaufen dürfe. Es bestehe praktisch ein Berufsverbot. An mein Fritzchen dachte ich da schon nicht mehr.
10 Gemeint ist die Kuckucks-Lichtnelke.
11 Bernhard Weinberg und seine Familie bewohnten das Haus in Westrhauderfehn von 1910 bis 1920 und bauten dort das Familiengeschäft auf. 1920 zogen Bernhard Weinberg und Frau Rahel mit Tochter Caroline Lilly nach Weener und übernahmen den Betrieb des verstorbenen Schwiegervaters Abraham Hartog Grünberg. In Westrhauderfehn wohnten jetzt Alfred Weinberg und Frau Flora geb. Grünberg mit den Kindern Dieter, Friedel und Albrecht. Sie hatten im Januar 1920 geheiratet und bezogen das Haus, das Abraham Hartog Grünberg, der Vater der Ehefrau, 1910 hatte errichten lassen. Das Grundstück am Untenende war ihm von Schmied Brunsema verkauft worden. Bernhard Weinberg war noch oft dort und pflegte seine Geschäftsbeziehungen auf dem Fehn. Alfred und Flora Weinberg zogen 1935 nach Leer, weil die Kinder dort die jüdische Schule besuchen mussten. Im Januar 1936 wurden Haus und Grundstück zwangsweise weit unter Wert an Reeder und Werftbesitzer Harm Schaa verkauft. 1940 mussten alle Juden Ostfriesland verlassen. Alfred und Flora wurden nach Berlin zwangsdeportiert, von da im März 1943 nach Theresienstadt und im April 1944 nach Auschwitz, wo sie umkamen. Dieter, Friedel und Albrecht, alle im jugendlichen Alter, kamen nach Auschwitz und überlebten. Dieter verunglückte im Oktober 1946 tödlich im Breinermoor Hammrich, Friedel und Albrecht wanderten in die USA aus. Wegen einer schweren Erkrankung von Friedel kehrten die beiden Geschwister 2011 nach Leer zurück, wo Friedel 2012 verstarb. Albrecht Weinberg lebt weiter in Leer (Stand Februar 2016). Als Zeitzeuge erzählt er auch in hohem Alter noch von den Leiden seiner Familie. Die Familie von Bernhard Weinberg wurde im Oktober 1938 nach Leer gebracht und von dort ins KZ Sachsenhausen deportiert. Wann sie zurückkamen, ist unklar. 1940 zog die Familie nach Bremen, von wo aus sie im November 1941 ins Ghetto Minsk deportiert wurden. Das Todesdatum von Bernhard und Lilly Weinberg ist ungeklärt. Bernhard Weinberg wurde 1949 mit Datum vom 8. Mai 1945 für tot erklärt. Seine Frau Rahel wurde im Juli 1942 im Ghetto Minsk erschossen.
12 Das Argonnerwaldlied wurde 1914/15 von Hermann Albert von Gordon gedichtet.
13 Dieses ursprüngliche Volkslied findet sich auch in Soldatenliederbüchern. In der Ursprungsfassung heißt der Text „Büblein, wirst du ein Rekrut / Merk dir dieses Liedlein gut“.
14 Richtig heißt es „Stahlhelm unser Zeichen / Schwarz-weiss-rotes Band …“
15 Der Text des Liedes entstand 1813 in den Befreiungskriegen gegen Napoleon.
16 Der bürgerliche Name war Edzard Sünnernöös (Auskunft von Follrich Poelmann, Westrhauderfehn, Jahrgang 1928).
17 Die Zeugnisse von Johann Plaisier aus der Volksschule sind noch erhalten. Tatsächlich wurde das Fach Singen mit 3 oder 4 benotet.