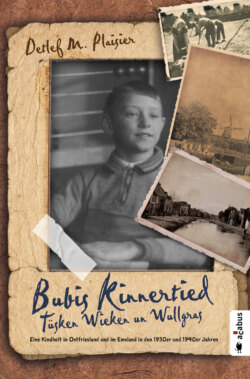Читать книгу Bubis Kinnertied. Tüsken Wieken un Wullgras - Detlef M. Plaisier - Страница 13
ОглавлениеNachbarn und Geschäfte auf dem Fehn
Auf Nachbarn, ostfriesisch Nabers genannt, wird in allen Dörfern des Fehns viel Wert gelegt. Die „Naberskupp“ muss gepflegt werden. Das hängt auch mit der Besiedlung des Fehns zusammen. Oft ist von Hof zu Hof eine lange Wegstrecke zurückzulegen. Man ist hier aufeinander angewiesen. Tritt ein Notfall ein und ein Arzt muss geholt werden oder sind aus der fernen Apotheke Heilmittel zu besorgen, dann ist „Nabershülp“ gefragt. Gleiches gilt für das liebe Vieh, wenn der Tierarzt geholt werden muss. Es ist in Ostfriesland selbstverständlich, dass die Nachbarn am Familiengeschehen teilnehmen, ohne sich in die persönlichen Belange einzumischen. Auch meine Eltern pflegten den nachbarschaftlichen Kontakt und legten großen Wert auf ein zuverlässiges Miteinander. Wir hatten aufmerksame Nachbarn. Einige sind mir in besonders guter Erinnerung:
Die erste Stelle nimmt dabei die Familie Vogelsang ein. Mama Vogelsang war besonders lieb. Sie hatte immer Zeit für mich. Zu jedem Heiligen Abend kam sie in unser Haus und brachte eine Weihnachtsüberraschung vorbei. An einem der Weihnachtsabende kam sie in großer Eile in die Weihnachtsstube und hatte unter der Schürze, die sie gern den ganzen Tag anlegte, etwas versteckt. Zum Vorschein kam ein bunt lackiertes Schaukelpferdchen mit angelegtem Geschirr in Form von Halfter und Zügel. „Das hier ist für Bubi“, sagte sie zu meiner Mutter und war schon verschwunden. Ich bekam von Frau Vogelsang öfter etwas geschenkt, und war es auch nur ein Keks. Ich begegnete ihr immer mit besonderer Würde und Höflichkeit. Ihr Sohn Weert und die Tochter Tini waren älter als ich. Sie gehören zu den Geburtsjahrgängen meiner Brüder. Tinis Vater hatte ein Baugeschäft und war selbständig. Ich habe ihn nur selten zu Gesicht bekommen.
Tini hatte mir, als ich im ersten Schuljahr bei der Lehrerin Frau Meentz18 Unterricht hatte, einmal eine Windmühle aus Papier gebastelt. Es war eine Hausaufgabe, die ich allein ohne Hilfe nicht lösen konnte. Die Mühle kam in der Schule gut an, wobei ich ehrlich bekannte, dass mich die Nachbarstochter Tini Vogelsang nach Kräften unterstützt hatte.
Tini spielte auch die Hauptrolle beim jährlichen Martinssingen. Fast überall hatte es sich eingebürgert, im Monat November Umzüge mit erleuchteten Laternen zu veranstalten und bereits ab dem 9. November von Haus zu Haus zu ziehen und dabei um Gaben zu bitten. Wir hielten uns streng an den Religionskalender. Zu Ehren des großen evangelischen Reformators Martin Luther wurde alljährlich an seinem Geburtstag, dem 11. November19, die Laterne angezündet. Die Kinder der Nachbarschaft trafen sich, um in einem wohlgeordneten Umzug dem Reformator ihre Reverenz zu erweisen. Es ging von Haustür zu Haustür, wobei kein Nachbar ausgelassen wurde. Wer keinen Besuch von den Martinisingern erhielt, fühlte sich übergangen.
Tini Vogelsang nahm mich jeweils mit, da meine Brüder für dieses evangelisch-lutherische Brauchtum keine Zeit übrig und als angehende Mannsleute schon viele andere Interessen hatten. Kirchenbesuche waren selbstverständlich. Ich sang immer das Lied, welches Tini anstimmte. Sie kannte sich ja aus. Bei den direkten Nachbarn und Verwandten der Martinisänger wurde vorzugsweise das evangelische Kirchenlied gesungen:
„Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann Weil heute sein Geburtstag ist, zünd’ ich mein Lichtlein an.“20
Klopften wir an anderen Türen als bei vertrauten Nachbarn oder Verwandten an, dann wurde dieses einfache Lied auf Platt gesungen:
„Kipp Kapp Kögel21, ich bün mien Mamas Vögel Ick bün mien Mamas lütje Maid, de mit Kipp Kapp Kögel geiht.“
Nach dem Singen bekamen die Kinder Obst und Süßigkeiten. Das Obst kam meistens aus dem eigenen Garten. Es waren in der Hauptsache Äpfel und Birnen. Um all die leckeren Sachen unbeschadet nach Hause zu transportieren, hatte jeder Sänger eine Tasche aus Leinen bei sich.
Schon Tage vor dem Martinsfest wurde an der Herstellung der Laternen gewerkelt. Ich habe immer eine ausgehöhlte Runkelrübe, in deren Schale ein Gesicht mit Mund, Nase und Augen eingeritzt war, stolz voran getragen. Durch eine obere Öffnung konnte eine Kerze aus Wachs in das Innere der Rübenlaterne eingebracht werden. Das Lichtlein, wie es in dem Lied hieß, wurde mit Beginn des Umzuges angezündet. Für meine Festbeleuchtung sorgte natürlich Tini, die auch Tage zuvor bei der Fertigstellung der Laterne geholfen, aus dem Garten ihrer Eltern von einem Zierteestrauch den Tragestock hergestellt und auf die entsprechende Länge gekürzt hatte. Sie hatte mehr Talent für solche Basteleien als meine Brüder.
Bei den Laternen gab es auch schon Papiermodelle aus dünnem gelblichem Material. Als Motive auf der Außenseite dienten die Gestirne des Himmels: Sonne, Mond und Sterne. Alles war schlicht und einfach gehalten. Bei aller Einfachheit war den Martinisängern, waren sie auch noch so klein, der Sinn und die christliche Bedeutung ihres Auftritts durchaus bewusst. Mit strahlenden Augen und dem Bemühen, ja den richtigen Ton zu treffen, waren sie bei der Sache. Schließlich ging es darum, Martin Luther zu ehren und gleichzeitig die Eltern nicht zu blamieren.
Dann gab es die Nachbarn Familie Arnold Coobs. Herr Coobs hatte ein schweres Asthmaleiden. Wenn er zu uns kam, das war auch später in Bockhorst noch so, nahm er ein Asthmapulver ein. Er faltete ein kleines Briefchen aus Papier auseinander, worin die Medizin eingepackt war, schüttete den Inhalt in ein Glas Wasser und schluckte die durch Rühren aufgelöste Medizin hinunter. Herr Coobs brachte uns die damals bekannte und beliebte Zeitschrift „Die Gartenlaube“.
Auch an die Familie Laaken erinnere ich mich recht gut. Onkel Laaken war ein schlanker, ja fast hagerer, aber dafür zu großer Mann. Ich musste schon den Kopf in den Nacken legen, um zu ihm aufschauen zu können. Er trug gerne eine blaue Schiffermütze mit einem kurzen Schirm. Die Tochter Renie war eine Klassenkameradin von mir. Auch sie kam ab und zu zum Spielen zu uns. Ihr sollte leider nur ein kurzes Leben vergönnt sein. Mit 12 Jahren ist sie verstorben.
Erwähnen muss ich unbedingt noch den Nachbarn Müller. Wegen seiner kleinen, zierlichen Körperform wurde er nur der „Lüttje Müller“ genannt. Die Familie hatte einen Sohn namens Hermann. Der Sohn hatte Gene des Vaters geerbt. Er war ebenfalls von kleinem Körperwuchs, seine Figur war zerbrechlich und zart ausgebildet. Er wäre von seinem Erscheinungsbild her eher als Schauspieler geeignet gewesen und hätte dabei sicher als zierlicher Liebhaber sogar die mehr auf sturmerprobte Seemänner blickenden Ostfriesenmädchen erobern können. Aber wie es im Leben so ist, er musste Bauer werden. „Lüttje Müllers Hermann“, wie er genannt wurde, war ein Schulfreund meiner Brüder; sie waren oft zusammen.
Zu uns kam auch ein Herr Cremer zu Besuch. Er wohnte in Westrhauderfehn Untenende in der Rajenwieke, zusammen mit seiner Frau und der Tochter.22 Herr Cremer sprach stets Hochdeutsch, konnte aber das Fehntjer Platt gut verstehen.
Was das „Platt proten“23 angeht, so flechte ich hier kurz eine Feststellung ein: Platt ist nicht gleich Platt. Ich habe lernen müssen, dass die Urform der plattdeutschen Sprache zwar grundsätzlich im Ostfriesischen verankert ist, aber keineswegs die alleinige Ausdrucksform der plattdeutschen Sprache im norddeutschen Raum ist. So musste ich die Erfahrung machen, dass Saterländer eine völlig andere niederdeutsche Mundart im täglichen Umgang miteinander gebrauchen. Es ist eine Ausdrucksweise, die ich als quasi Fremder gar nicht verstanden habe. Saterländisch hat einen Forscher aus Amerika24 so gefesselt, dass er der Urform dieser Sprache nachstellte und sie für die folgenden Generationen in seinen Aufzeichnungen verankerte. Auch fertigte er Lesebücher, und letztlich kamen Liedtexte hinzu. Geschichten und Lieder in der Heimatsprache der Saterländer werden seither von der Jugend vorgetragen und gesanglich dargebracht. Auch die Oldenburger haben ihre eigene Ausdrucksweise, was für verschiedene Formulierungen auch für das Ammerland zutrifft. Besonders krass habe ich den Sprachunterschied bei meinem Aufenthalt im Rheiderland empfunden. Ich dachte immer, ich sei der niederdeutschen Sprache mächtig. Doch im Rheiderland, das mit seinen Ländereien an die Niederlande grenzt, ist vieles anders. Hier gibt es Ausdrücke, die ich selbst bei bestem Willen nicht einordnen konnte. So bedeutet zum Beispiel „Hest du dien Büüsdook instoken?“ so viel wie „Hast du dein Taschentuch eingesteckt?“, wobei mit dem Ausdruck „Büüs“ die Hosentasche gemeint ist.
Doch zurück zu Herrn Cremer. Er ist für mich ein Beispiel für die Möglichkeit, das Plattdeutsche durch das Verwenden eines fremdländischen Akzentes leicht verändern, ja sogar verwässern zu können. Onkel Cremer kam aus den Weiten des russischen Zarenreiches als Wolgadeutscher. Da er für den Zaren gekämpft hatte, musste er nach der Ermordung der Zarenfamilie vor den neuen Machthabern flüchten. So war sein Sprachvokabular zum Teil noch mit der an der Wolga üblichen Sprache, bestehend aus Deutsch und Russisch, vermischt. Dazu kam der für mich seltsam klingende Akzent, was sich besonders auf die Aussprache einiger plattdeutscher Ausdrücke auswirkte, aber auch im Hochdeutschen sehr leicht zu Verständigungsschwierigkeiten führen konnte. Daher vermied es Herr Cremer weitestgehend, sich dem Fehntjer Platt anzuvertrauen.
Immer, wenn meine Eltern zusammen Besorgungen machen mussten und ich somit allein blieb, übte Onkel Cremer eine Art Aufpasserfunktion aus. Er las dann Geschichten aus Kinderbüchern vor. Besonders aufmerksam betrachtete ich dabei die Postkarten, die er aus meiner alten, schon abgegriffenen Zigarrenkiste nahm. Es waren Feldpostsendungen meines Vaters und von Verwandten dabei, die aus dem ersten Weltkrieg stammten, aber auch einige Karten aus fernen Ländern. Da mir Herr Cremer bei jedem Besuch die Kartengrüße vorlas, kannte ich die Texte schon auswendig. Onkel Cremer versuchte auch, mir Lieder aus der Soldatenzeit, die damals sehr verbreitet waren und von der Reichswehr übernommen wurden, vorzusingen. Sein Kauderwelsch klang zwar interessant, ging aber in Text und Melodie oft daneben. Ich kannte die Lieder ja von meinem Vater, der sie abends mit mir sang.
Zum Freundeskreis meiner Eltern gehörte auch die Familie Jan Poelmann, die ebenfalls in der 1. Südwieke wohnte. Das Haus stand unmittelbar in der Nähe der Hahnentanger Mühle. Die Familien besuchten einander unregelmäßig zum Nachmittagstee. Auch halfen sie sich gegenseitig. Herr Poelmann sollte Jahre später noch oft meinen Weg kreuzen, da er bei der Mooradministration im KZ Börgermoor Arbeit angenommen hatte. Das trifft auch auf Onkel Cremer zu, der dann nicht mehr in die Rolle eines Aufpassers für Bubi schlüpfen musste.25
Auf dem Gelände, wo heute die Opti-Fabrik vielen Fehntjern Arbeit und Brot sichert, befand sich in den dreißiger und vierziger Jahren noch eine grüne Wiese, dazu Ländereien mit halbhohem Baumbestand, aber auch vielerlei Gestrüpp. Hier stand ein kleines Fehnhaus, das von der Familie Hogelücht bewohnt wurde. Die Frau trug einen typisch ostfriesischen Vornamen: Sie hieß Renstina. Neben einer Tochter hatte die Familie einen Sohn, Johann, der in seiner geistigen Auffassungsgabe etwas zurückgeblieben war. Er lief oft mit einem Beil in der Hand in der Wiese herum, die an den Hauptweg grenzte, und flößte besonders den Kindern durch wilde Gebärden und Herumschwenken des Beils Angst ein.26
Johann strotzte geradezu vor Kraft. Das gesamte Holz für die Familie Hogelücht hackte er in ofenfertige Stücke, und er sorgte auch für den Wintervorrat, wobei das Brennmaterial in der Hauptsache aus schwarzem Torf bestand. Er muss aber nicht als gefährlich eingestuft worden sein, denn sonst wäre er nach den Euthanasie-Gesetzen des Dritten Reiches für immer abgeholt worden.
Eine Nebenwieke trennte das jetzige Fabrikgelände Opti, zu meiner Kinderzeit das vorstehend beschriebene Besitztum der Familie Hogelücht, von der Platze Garrelt Preyt. Onkel Garrelt war ein guter Freund der Familie. Er hatte einen beachtlichen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut. Bei ihm wohnte seine Tante Eta. Sie erledigte die hauswirtschaftlichen Arbeiten, versorgte Onkel Garrelt mit Wäsche und bestellte Haus und Hof. Für die schweren landwirtschaftlichen Arbeiten wurden Helfer eingestellt. Auch diese musste Tante Eta versorgen. Mein Bruder Hermann war auch bei Onkel Garrelt angestellt. Der ganze Stolz von Herrn Preyt war die für damalige Zeiten noch sehr seltene Dreschmaschine. Mein Bruder Hermann bediente die Maschine und arbeitete daran mit dem Nachbarssohn Peter Lind zusammen.
Getreide wurde damals nach der seit Jahrhunderten angewandten Methode gedroschen. Das Dreschen erfolgte mit der Hand und mit großem körperlichem Einsatz. Die Getreidegarben wurden dafür auf dem Dielenboden ausgelegt. Zur Mitte hin wurden die das Korn tragenden Ähren gelegt. Das Korn, noch in Garben gebunden, lag in zwei Reihen, wobei die Garbenenden nach außen zeigten. Bevor der Dreschvorgang begann, wurden die Garben aufgelockert, damit die Ähren nicht zu sehr eingeengt waren. Zum Dreschen des Korns wurden Dreschflegel verwendet. Das sind nicht etwa böse Buben, die man ja auch als Flegel bezeichnet. Flegel sind ein besonders konstruiertes Arbeitsgerät, das in folgender Bauweise hergestellt wird:
Aus einem Stück gut ausgetrockneten Buchen- oder Eichenholzes wird ein Klöppel von etwa 30 Zentimeter Länge und einem Durchmesser von rund acht Zentimeter gedrechselt. Wichtig ist, dass dieser runde, längliche Klöppel außen ganz glatt gearbeitet ist und alle Unebenheiten beseitigt werden. Am oberen Ende ist eine Öse durchgebohrt, die ebenfalls glatt gearbeitet sein muss. Durch diese Öse wird ein sechs Millimeter starker Lederstreifen gezogen und später an dem 1,50 Meter langen Stiel befestigt. Das Verbinden beider Elemente muss so erfolgen, dass der Klöppel, auch Schwengel genannt, locker hin und her baumeln kann. Dieses Stück Bewegungsfreiheit wird für den Dreschvorgang benötigt.
Das Dreschen selbst kann von einer Person durchgeführt werden, was allerdings sehr mühsam ist, oder es können im Gleichklang bis zu vier Personen dreschen. Dabei ist Teamarbeit unerlässlich. Beim Dreschen wird der Stiel mit beiden Händen erfasst und der Flegel über den Kopf geschwungen. Dann wird der Stiel nach unten zum Getreide abwärts gesenkt und der Dreschflegel schlägt kräftig an die Kopfseite der Garben, also in der Mitte der korntragenden Ähren auf. Dreschen mehrere Personen gleichzeitig, muss ein genau abgestimmter Takt entstehen. Es führen alle nacheinander in gleichen Zeitabständen die Dreschflegel aufs Korn. Das geschieht in Sekundenschnelle eins-zwei-drei-vier oder nach dem Geräusch des Dreschens Klipp Klapp Klipp Klapp. Dann wird gedroschen über die gesamte ausgebreitete Getreidefläche auf dem Dielenboden, drei- bis viermal hin und wieder zurück. Ein Dreschvorgang endet erst, wenn alle Ähren leer gedroschen sind und die Garben dann als Stroh von der Diele aufgenommen werden. Das so gewonnene Korn, welches als letztes auf dem Dielenboden liegt, wird in Säcke gefüllt und später mit dem Weiher27 nach dem Grundsatz „die Spreu vom Weizen trennen“ gereinigt.
Nach dem Ausflug zum Dreschen geht es nun zurück zur 1. Südwieke, und zwar ein Stück des Weges aufwärts in Richtung Klostermoor. Hier stand zu meiner Kinderzeit, ziemlich am Ende der Wieke, ein Fehnhaus. Darin wohnten zwei etwas seltsame junge Burschen. Sie waren Zwillingsbrüder. Man sah sie am Tage oft die 1. Südwieke entlangrennen. Dabei benutzten sie stets die obere Uferkante der Wieke. Ich habe nie erlebt, dass sie im Fußgängertempo zum Untenende gingen. Sie liefen hintereinander, verfielen auch manchmal in den olympischen Geherschritt. Die Fehntjer nannten die beiden nur „De Loopers“. Sie gehörten zum völlig normalen Tagesbild der 1. Südwieke. Keinesfalls musste man sich als Kind vor ihnen ängstigen, wie es bei dem Beil schwingenden Johann Hogelücht schon eher der Fall war.
Eigentlich waren die Brüder bedauernswerte Geschöpfe. Sie saßen abends allein in ihrer Wohnkammer und betrieben Körperpflege auf ihre Art. Waren sie auf ihrer täglichen Rennstrecke unterwegs, so wirkten sie sehr gepflegt und trugen saubere Kleidung. Da sie vor den Fenstern keine Gardinen angebracht hatten, konnte jeder im Vorbeigehen ins Innere des Zimmers schauen, das zur Wiekenseite gelegen war. Es wurde erzählt, die Loopers suchten dann gegenseitig ihre Kopfläuse ab.
Eines Morgens, es war sehr nebelig, kam mir als Bub der tolle Einfall, einen Ausflug zu unternehmen auf dem Wiesenrain, der an unserem Landbesitz entlangführte. Dies war für mich nicht ungefährlich, floss doch an der dem Land abgewandten Seite eine Nebenwieke entlang. Bei dem dichten norddeutschen Frühnebel war mein Gang besonders gewagt. Das war mir aber damals nicht bewusst. Vielmehr setzte ich meinen Weg fort und trällerte gut gelaunt ein Liedchen vor mich hin. Meine Mutter hatte ich abends immer diesen Weg gehen sehen. Sie ging zu unseren Weiden, um die Kühe zu melken. Die Milch trug sie in zwei Eimern mit einem Jück auf den Schultern nach Hause. Ein Jück ist eine spezielle, aus Holz gearbeitete Vorrichtung, um schwere Lasten gleichmäßig auf beide Körperhälften zu verteilen, auch Tragjoch genannt. Die Schultern waren in zwei Aushöhlungen eingepasst. An beiden Enden des Jücks war je eine Kette befestigt, die an den Körperseiten herunterhing. Wegen der unterschiedlichen Armlängen der Benutzer konnte die Kette verlängert oder gekürzt werden. Am unteren Ende der Kette waren Haken angebracht, in die dann die vollen Milcheimer eingehängt wurden. War die Trageeinrichtung nicht dem Körperbau angepasst oder oberflächlich angelegt worden, schmerzten bald Nacken und Schultern. Selbst bei korrekter Handhabung des Jücks waren Gesundheitsschäden, besonders am Skelettaufbau, unausweichlich. Schließlich betrug die getragene Last an jeder Seite bis zu 30 Kilogramm.
Ich setzte also meinen Weg auf dem Wiesenrain fort. Es dauerte eine ganze Weile, bis meine Mutter mein Fehlen bemerkt hatte. Aufgeregt und Böses ahnend, begann sie mit der Suche, wobei sie immer wieder laut „Bubi“ rief. Ich hörte sie nicht, sang ich doch laut vor mich hin. Das musste sie mitbekommen haben, denn sie näherte sich mit schnellen Schritten von hinten und schloss mich in ihre Arme. Auf dem Heimweg gab es eine verdiente Standpauke. Am Ende war aber alles wieder gut. Nur mein Ziel, den Herkunftsort der Milch auszumachen, hatte ich nicht erreicht.
An der anderen Wiekenseite, etwas in Richtung Untenende versetzt, wohnte unser Schneidermeister Ecken. Er hatte dort auch seine Werkstatt. Meister Ecken kümmerte sich um Neuanfertigungen und Änderungen großen Stils. Reparaturen des täglichen Lebens, wie etwa das Aufsetzen eines Flickens oder das Kürzen einer Hose, erledigte meine Mutter selbst. Sie setzte für solche Näharbeiten ihre Nähmaschine der Marke Singer in Gang. Die Inbetriebnahme erfolgte durch Treten auf dem unten befindlichen Tritt. Die so erzeugte Kraft wurde mittels eines Keilreimens nach oben übertragen und setzte die Nähmaschine in Gang. Meine Mutter achtete darauf, dass ihre Füße bei dieser Arbeit immer mit Strümpfen bekleidet waren.
Da unser Schneidermeister an der anderen Seite der 1. Südwieke wohnte, musste man zuerst von uns aus rund 500 Meter in Richtung Untenende gehen, eine Wiekenbrücke überqueren und die gleiche Wegstrecke auf der Wohnseite des Schneidermeisters wieder zurück wandern. Meister Ecken hatte diesem Umstand Rechnung getragen: Auf Zuruf oder nach vorheriger Absprache holte er seine Kunden von unserer Wiekenseite mit einem Floß ab.
War das Geschäftliche erledigt und hatte man den Tee getrunken, der von Frau Ecken serviert wurde, brachte der Schneidermeister seine Kunden mit dem Floß zur anderen Seite zurück. Das Floß war ein Eigenbau. Es bestand aus drei Ölfässern aus Blech, untereinander verbunden durch festen Bindedraht. Darauf lagen mehrere Bretter, die untereinander und mit den Fässern fest verzurrt waren. Auf dieser „Ladefläche“ konnte der Kunde sich setzen oder stehen bleiben. Schneidermeister Ecken bewegte das Gefährt mit einem langen Staaken voraus und steuerte zielsicher den Anlegeplatz vor seinem Haus an, wo sich sein Kunde mit einem Sprung ans Ufer in Sicherheit brachte. Dabei musste man genau den Zwischenraum zum rettenden Ufer mit einem verlässlichen Blick einschätzen können. Sprang man zu kurz, waren die Füße nass. Mir war dieses Übersetzen zu unsicher. Ich zog den sicheren Fußmarsch vor.
Nicht weit von Schneidermeister Ecken entfernt war zur damaligen Zeit noch ein Kolonialwarengeschäft in Betrieb. Hier wurden allerlei Gebrauchsgegenstände und, der Bezeichnung des Ladens entsprechend, Waren aus den Kolonien feilgeboten. Ich wurde auch schon zum Einkaufen (auf Plattdeutsch „Böskupp lopen“) geschickt, zum Beispiel Margarine der Marke „Schwan im Blauband“28. Waren Waschmittel fällig, so holte ich IMI, Ata und Persil sowie das Bleichmittel SIl für meine Mutter. Waren für meinen Vater oder meine Brüder Rasierklingen gefragt, so kam nur die Marke Rotbart Be-Be infrage.
Geraucht wurde bei uns nicht. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Von den Nachbarn und den größeren Jungs konnte ich bei Gesprächen ablauschen, dass sie die Marke Salem29 bevorzugten, eine Zigarette mit goldfarbenem Mundstück. Der Rauch, der mir in die Nase stieg, war süßlich. Es muss mit dieser Marke etwas Besonderes auf sich gehabt haben, denn man sang sogar ein Lied von dieser Reemtsma-Sorte:
Hallo MacBrown, was macht Ihr Harem?
Tanzt man noch Swing, raucht man noch Salem?
Denn Salem ist ‘ne gute Zigarette, die ist mir lieber
Als ‘ne nackte Frau im Bette
Zwar konnte ich mir unter dem Text nichts vorstellen, ich fand ihn aber lustig. Wenn meine Brüder das Lied anstimmten, wobei Johann nur ein Brummen vernehmen ließ, sang ich kräftig mit.
Unser täglich Brot wurde von meinen Eltern selbst gebacken. Auch den so beliebten und überall in ostfriesischen Haushalten verbreiteten Stuten, besser bekannt und besonders wohlschmeckend als Rosinen- oder Krintstuten, bereitete meine Mutter selbst. Wir kauften auch Backwaren bei Bäcker Buss, dessen Geschäft oben in der 1. Südwieke gelegen war. Beim Bäcker Wiese30 kaufte ich nicht gern ein.
Abb. 4: Bäcker Johann Wiese mit seinen Bienen
Mehr zum Untenende hin stand das Haus von Familie Abels31. Es hatte für die Fehntjer eine besondere Bedeutung: Es war so etwas wie eine Wetterstation. Oben auf dem Dach thronte ein Storchennest32. Kehrte das Storchenpaar zurück und nahm das Nest wieder in Besitz, endete der Winter und der Frühling war gekommen. Umgekehrt war es im Herbst. Zogen die Störche mit dem Nachwuchs gen Süden, so war die kalte Jahreszeit nicht mehr fern.
Das Storchenpaar hatte eine schwarz-weiße Federzeichnung. Man sah beide am Tage auf Wiesen und den ausgedehnten Feuchtgebieten des Fehns nach Nahrung suchen. Sie brauchten keinen Hunger zu leiden, denn die naturbelassene Landschaft und die ökologische Bewirtschaftung der Ländereien, die damals üblich war, deckten den Tisch reichlich. Die Störche, von denen es zu meiner Kinderzeit im Landkreis Leer noch etliche Paare gab, waren an den Menschen gewöhnt. Daher waren sie auch nicht scheu. Wurde eine Wiese gemäht, so ließen sich die Störche in gebührendem Abstand hinter den Mähern nieder und schnappten sich die als Leckerbissen geschätzten grünen Laubfrösche33. Von denen gab es reichlich. Bei einem so ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan gedieh auch der Nachwuchs prächtig, der bei dem Storchenpaar in der 1. Südwieke meistens aus zwei Pärchen bestand. Es war für alle Fehntjer ein großes Vergnügen, die Storchenfamilie einträchtig vereint schnäbeln zu sehen.
In meiner Kindheit waren diese Erlebnisse mit der Natur und der Vogelwelt nichts Besonderes. Mensch, Tier und Natur waren eine Einheit. Die Fehntjer begegneten den Elementen der Natur stets mit großem Respekt, war die Natur doch für sie ein Teil der Schöpfung im christlichen Sinn. Die Natur räumte den Friesen den notwendigen Raum ein, den sie für das Leben brauchten. Im Gegenzug achtete der Mensch die Bedürfnisse der Tier- und Pflanzenwelt und schuf so ein einträchtiges Miteinander.
Mein Bruder Hermann hatte mit Laubsägearbeiten begonnen. Er pauste die Motive mit einem Bogen Blaupapier von der Vorlage auf das Laubsägeholz ab. Dann sägte er fein säuberlich die einzelnen Stücke aus und setzte sie zusammen. Seine Lieblingsmotive waren zarte Gestalten von Carl Spitzweg. Die Motive wirkten dann als Schattenbilder, so zum Beispiel „Der einsame Poet“. Die von ihm gefertigte Kammablage, bestehend aus einem Kästchen mit Deckel, worin mehrere Kämme und eine Haarbürste Platz fanden, hat uns lange gute Dienste geleistet. Die Rückwand zeigte die erwähnten Motive von Spitzweg, die über dem Aufbewahrungskasten in einer Art Borte von 25 Zentimetern einen krönenden Abschluss bildeten. An der rückwärtigen Wand befand sich eine Aufhängevorrichtung. Der Kammkasten war mit einer dunklen, glanzlosen Farbe abgetönt worden, wobei sich die in hellbraun gehaltenen Spitzwegmotive geschmackvoll abhoben.
Wir bekamen wieder Besuch. Eines Tages kam ein Mann in die Küche, der mir fremd und seltsam erschien. Meine Mutter begrüßte ihn und bat ihn, wie in Ostfriesland üblich, zum Teetrinken am Küchentisch Platz zu nehmen. Der Mann nahm eine Kiepe aus Weidengeflecht vom Rücken und stellte sie auf den Fußboden. Dabei sah ich, dass er seine rechte Hand seltsam hielt. Er konnte damit nicht zufassen. Die Hand war leicht deformiert und steif. Jetzt erfuhr ich auch seinen Namen: Es war Heinrich Gerlach, dessen Frau eine Jugendfreundin meiner Mutter war. Die Familie wohnte in Flachsmeer, also gute 15 Kilometer von uns entfernt.
Neugierig wie Kinder nun mal sind, schaute ich auf seine Kiepe und entdeckte darin bunt gewürfelt alle möglichen Kurzwaren für den Haushalt. Herr Gerlach zog als Hausierer von Haus zu Haus und bot seine in der Kiepe mitgeführten Waren feil. Meine Mutter kaufte an diesem Tag einige Knöpfe für den Haushalt, dazu Sternzwirn in weiß und schwarz sowie Garn für die Nähmaschine. Herr Gerlach sagte, als sie ihm das Geld gab und den Betrag aufrundete, er habe wenigstens schon so viel verdient, dass er dafür ein ganzes Brot und ein halbes Pfund der guten Margarine „Schwan im Blauband“ kaufen könne. Meine Mutter gab ihm für seine Frau einige abgelegte Kleidungsstücke mit und ließ Grüße mit einer Einladung ausrichten.
Hausierer Gerlach teilte sich den langen Fußweg von seinem Wohnsitz nach Westrhauderfehn in mehrere Etappen ein. Er hatte besonders bei den großen Bauernhöfen schon Kunden, die auf ihn warteten. Bei den Bauern erhielt Herr Gerlach stets eine Mahlzeit, je nach Tageszeit. Er konnte dort auch über Nacht bleiben, denn auf fast jedem Hof war eine Knechte- oder Mägdekammer frei. So kam er gut zurecht. Mit einer Tageseinnahme von 90 Pfennigen, die er in sein Taschentuch einband, war der „Handlungsreisende zu Fuß“ vollauf zufrieden.
Für die Landfrauen führte Herr Gerlach die für kalte Witterung auf dem Land unverzichtbaren dicken Schlüpfer und Strümpfe mit. Für den Bauern und den Großknecht bot er Besuntjes an. Diese „unechten Lätzchen“ trugen sie über dem Unterhemd vor der Brust. Da auf dem Besuntje auch ein Schlips aufgearbeitet war, wirkte es im Halsausschnitt wie ein Oberhemd. Darüber wurde eine Jacke getragen. So mancher Großbauer hatte davon mehrere Modelle zum Wechseln im Schrank.
Nach langer Pause hörte ich auch mal wieder etwas von dem jüdischen Viehhändler, der mein Fritzchen gekauft hatte. Mein Vater erzählte beim Abendbrot, dass er sein Haus mit Garten verkauft habe. Er sei nach Amerika ausgewandert34. Das Besitztum im Untenende habe der Kapitän und Werftbesitzer Harm Schaa erworben.
Frau Gerlach hatte die Einladung meiner Mutter übermittelt bekommen und kam gern für einige Tage zu uns. Sie hatte ihren Sohn Heini mitgebracht, der in meinem Alter und wie ich im Oktober geboren war. Für Tante Gerlach war der lange Weg recht beschwerlich. Ihr rechtes Bein war amputiert und durch eine Holzprothese ersetzt worden. Die Techniken der Orthopädie waren zu dieser Zeit bei der Herstellung von künstlichen Gliedmaßen und deren Versorgung noch nicht auf einem modernen Stand. Die Holzprothese war ein von der rechten Hüfte bis in den Schuh durchgehendes rund geformtes Stück Holz, das im Kniebereich steif war und somit kein natürliches Einknicken erlaubte. Nur im Fußbereich war das Holzbein dicker geformt und hatte den Ansatz eines Fußes. Dadurch wurde das Tragen eines Schuhs möglich, wobei Form und Größe keine Rolle spielten. Wenn Tante Gerlach sich vorwärts bewegen wollte, musste sie bei dieser Konstruktion das Bein in voller Länge nach vorn stellen und sich so mühsam fortbewegen.
In Flachsmeer besaß Familie Gerlach ein Haus und einige Ländereien. Beides habe ich mir einige Jahre später ansehen können. Das Land reichte für den Anbau von Kartoffeln und Gemüse zur Selbstversorgung aus. Dazu kamen mehrere Ziegen und Schafe für die Milchgewinnung und der Deckung des Bedarfes an Wolle zum Herstellen von Garn. Die Wollbekleidung für den Winter strickte Frau Gerlach selbst. Auch das Winterfutter für das Vieh konnten die Eheleute selbst erzeugen.
Das tägliche Leben spielte sich in einer großen Wohnküche ab. Der Raum diente zum Aufenthalt, Wohnen und Kochen und beherbergte zugleich in einer Ecke, säuberlich gestapelt, die zum Handel notwendigen Utensilien. Die große Wohnküche wurde mit Torf beheizt. Der wurde wiederum aus dem Stück Moor gewonnen, das zur Besitzung gehörte.
In der Winterzeit fertigte „Kiepen-Gerlach“ feine Reisigbesen. Das Material wurde in der Nähe des Hauses geerntet. Außerdem stellte er aus Weidengeflecht Körbe für die Kartoffelernte her. Geschlafen wurde in Butzen, die an der Innenwand eingelassen waren. Dadurch waren die Schlafstellen auch bei winterlichen Temperaturen angenehm warm. Anstelle der Matratze war der Untergrund mit Stroh aufgefüllt, das zwei- bis dreimal im Jahr erneuert wurde. Ein Unterbett aus Federn bildete den weichen Abschluss. Der Kopf ruhte auf zwei mächtigen Kissen, und als Zudeck diente ein ebenso prall gefülltes Oberbett.
Meine Eltern unterstützten Familie Gerlach vor allem mit Kleidung. Sohn Heini bekam von mir Stücke, die ich nicht mehr benötigte. Dass Heini geistig nicht voll auf der Höhe war, fiel kaum auf. Er besuchte eine Schule, wenn auch nicht gerade sehr erfolgreich.
Frau Gerlach hieß mit Vornamen Anna. Dies war auch der Rufname meiner Mutter, die laut Geburtsurkunde Noentjeanna hieß. Tante Gerlach, wie ich sie ansprach, hatte eine besondere Fähigkeit: Sie konnte aus den Karten die Zukunft voraussagen. Das erfuhr ich erst von meiner Mutter, als ich älter war. Diese „Offenbarung“ erklärte nachträglich so manches Verhalten von Tante Gerlach. So öffnete sie bei einem Gewitter stets alle Türen des Hauses, damit sie schnell hinauslaufen konnte. Außerdem sollte so Menschen, die draußen den Gefahren der Blitze ausgesetzt waren, ungehinderter Zutritt in die Geborgenheit ermöglicht werden. Diese Tradition wird zum Teil heute noch in Ostfriesland gepflegt. Bei einem heftigen Sommergewitter ging Tante Gerlach mit mir auf die Diele und löste alle Verriegelungen der Scheunentüren. Zuckten die Blitze, betete sie um himmlischen Beistand. War ihr Küchenherd der Marke Küppersbusch einmal überhitzt, was selten vorkam, streute sie sogleich Kochsalz auf die Glut.
Frau Gerlach hatte als Kartenlegerin meine Mutter vor einem großen Feuer gewarnt. Es werde Haus und Hof und das gesamte Hab und Gut vernichten. Welcher Art das Feuer sein würde, sagte sie nicht. Meine Mutter nahm die Vorhersage sehr ernst. Der große Brand kam dennoch und ließ sich trotz aller Vorsicht nicht abwenden: 1945 schossen Panzer der Armee Poland Haus und Hof in Brand.
Der Besuch von Tante Gerlach dauerte drei Tage. Auf dem beschwerlichen Heimweg musste Heini das wenige Gepäck tragen, das neben einer Wegzehrung auch aus Geschenken bestand.
Weiter zum Fehntjer Mittelpunkt, dem Untenende, hin stand der Musterhof von Johann Loger. Er war weit und breit der größte und am besten geführte landwirtschaftliche Betrieb. Das betraf sowohl die Viehhaltung als auch die Herstellung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Auch die Feldbestellung erfolgte vorbildlich.
In diesem Musterbetrieb an der 1. Südwieke war meine Mutter als Magd und zugleich Hausgehilfin eingestellt gewesen. Sie hatte sich hier im 14. Lebensjahr aus eigenem Antrieb beworben und vorgestellt. Wie ich später erfahren habe, hat meine Mutter wegen der harten Arbeiten, die ihr Vater von allen Kindern ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand verlangte, das Elternhaus in Großwolderfeld nach Ende der Schulzeit verlassen. Die Kinder mussten manchmal in aller Frühe aufs Feld oder sogar zum schweren Torfstechen ins Moor. Widerspruch soll der Vater nicht geduldet haben, dann setzte es Prügel. So kam meine Mutter zu ihrer Lehrzeit bei Johann Loger.
Im täglichen Ablauf der Lehrzeit musste meine Mutter um vier Uhr morgens aufstehen, 40 Milchkühe melken und die Milch über die Zentrifuge weiterverarbeiten. Immerhin gab es auf dem Hof über 20 schwarz-bunte prämierte Stammbuchtiere. Die Herstellung der guten Landbutter wie auch der Käserollen war eine Tätigkeit ausschließlich für die weiblichen Bediensteten. Natürlich musste auch das Vieh in den Ställen versorgt werden. Stand das Schlachten an, so halfen die Mägde an erster Stelle. Ob Blutrühren oder Wursten, jede Arbeit musste von der Pike auf erlernt werden. Bei Loger wurde voller körperlicher Einsatz verlangt, der manchmal, wie damals in der Landwirtschaft üblich, die Grenzen des Zumutbaren überschritt. Am Ende ihrer Lehre als landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Gehilfin war meine Mutter eine perfekte Hausfrau, die Ihr Handwerk in allen Fragen der Land- und Hauswirtschaft meisterhaft beherrschte.
Abb. 5: Zeitungsreklame Artur Loger aus dem Jahr 1932
Im Untenende gab es auch die Holzhandlung Artur Loger. Vor dem Geschäft lagerten große, aufgestapelte Stämme, die ich sehr bewundert habe. In der freien Natur begegneten mir ja nur kleine Birkenstämme und Tannenbäume. Das Holz wurde auf dem Fehn und in der näheren Umgebung benötigt. Bauwirtschaft und Landwirtschaft hatten immer Bedarf an gutem Holz. In der Sägewerkstatt von Loger wurden die gewaltigen Stämme auf die gewünschte Länge und Breite zugeschnitten.
Gleich neben der Holzhandlung Loger hatte sich ein Gartenbaubetrieb angesiedelt. In den Auslagen der Landgärtnerei Meyer waren Schnittblumen nur selten zu finden. Das wäre auch vergebliche Liebesmüh gewesen. Schließlich sind die Ostfriesen bemüht, sowohl den Vorgarten als auch die Fensterbänke in Wohnstube und Küche zu jeder Jahreszeit mit reichlich Blumenschmuck zu verschönern. Was sie sich aus der Gärtnerei holten, waren Jungpflanzen für Gemüse und Salat. Auch mit Sämereien deckte man sich dort ein. Schließlich war es billiger, die eigenen Pflänzchen, besonders bei Gartenblumen, selbst zu ziehen, als diese käuflich zu erwerben. Bei den Hausblumen wurden Setzlinge gezogen. Hier spielte ein zusätzlicher Aspekt eine Rolle. Es war die Freude an langsam gedeihenden, selbst gesetzten Pflanzen. Natürlich führte die Gärtnerei auch Samen für Rüben, die als Viehfutter verwendet wurden. Daneben gab es Samen für Runkelrüben, einer der wichtigsten Futterknollen für alle Arten der Viehhaltung. Die Bauern achteten beim Kauf der Sämereien auf gute Qualität. Führend war hier mit Abstand die Marke Kiepenkerl. Das Firmenlogo, ein Mann mit einer Kiepe auf dem Rücken, war gesetzlich geschützt.
Konfirmationen waren und sind in Westrhauderfehn etwas Besonderes. Der Konfirmationssonntag ist seit jeher ein Ehrentag für alle Mädchen und Jungen, die dem Anlass entsprechend würdig und feierlich gekleidet sind. Wenn die Schar der Konfirmanden feierlich in das aus Backstein erbaute Gotteshaus einzieht, sind die Bänke voll besetzt.
Zum Fest der Konfirmation setzt die Gärtnerei Meyer Unmengen von Topfblumen um. Von jeher wird zu Konfirmationen eine bestimmte Sorte Blumen verschenkt: Fast jeder, der den Konfirmanden und den Eltern gratuliert, bringt eine Hortensie mit. Um die Zeit des Konfirmationssonntages stehen die Hortensien in voller Blüte. Eine große Farbenauswahl gibt dem Fest eine heitere bunte Note. Der Wurzelballen der Hortensie kann nach der Blüte in den eigenen Garten gepflanzt werden. Steht der Ballen etwas geschützt und wird bei strengem Frost abgedeckt, so erblüht die Hortensie im nächsten Jahr wieder in voller Pracht.
Abb. 6: Kaufhaus Hagius nach 1945, wahrscheinlich Ende der 1950er Jahre. Das Haus wurde im Jahr 1971 abgerissen.
Abb. 7: Zeitungsreklame Hagius aus dem Jahr 1932
Abb. 8: Gehaltsabrechnung der Firma Hagius für einen Beschäftigten für den Monat Oktober 1923. Die Inflation ist deutlich sichtbar: Die Auszahlung beträgt rund 70 Millionen Reichsmark.
Abb. 9: Blick auf das Untenende, etwa 1930er Jahre
In Westrhauderfehn Untenende war die Geschäftswelt des Fehns etabliert. Das größte Geschäft in Angebot und Umfang war Hagius Sohn, auch unter Graepel bekannt. Es war die Geburtsstunde des ersten Kaufhauses auf dem Fehn. Zwar war die Gliederung in den Abteilungen nicht so umfangreich wie heute, aber immerhin konnte man sich schon frei bewegen und die angebotenen Waren begutachten. Das war damals nicht gang und gäbe. In fast allen Geschäften stand sofort ein Verkäufer neben dem Kunden und schaute ihm auf die Finger.
Was für mich in der Kinderzeit noch ohne Bedeutung war, ist die Mitteilung meiner Eltern, dass die Inhaber des Geschäftes Hagius Sohn zu der deutschen Freimaurer-Loge gehörten. Dieser Loge sagte man besonders in den dreißiger Jahren ein unheimliches Bündnis mit den finsteren Mächten des Teufels nach; völlig zu Unrecht, wie ich heute weiß. Das aber tat dem Geschäft keinen Abbruch. Dafür waren die Inhaber den Fehntjern zu sehr als gute Christen und Wohltäter in so mancher Situation bekannt.
Nach dem Motto „Well schrifft, de blifft“35 gab es auch ein Schreibwarengeschäft. Es befand sich am Untenende und wurde von den Geschäftsleuten Eden & Kolk geleitet. Über dem Eingang prangte das Werbeschild der Firma Günther Wagner, besser bekannt unter den im Schreibwarenhandel erhältlichen Erzeugnissen der Marke Pelikan. Bei Eden & Kolk bekam man alles, was ein Schreiber für die Schule und für den Hausgebrauch benötigte. Nur Zeitschriften wurden noch nicht in größerer Zahl angeboten. Neben den Tageszeitungen der verschiedenen Verlage waren „Das Grüne Blatt“ und „Die Gartenlaube“ im Angebot. Bleistifte und Buntstifte lieferte die Firma Faber. Man schrieb noch mit dem Federhalter und der guten Tinte, ebenfalls von Pelikan oder Geha. Dazu gab es einen Löscher oder Löschpapier in einzelnen Bögen käuflich zu erwerben. Federn zum Schreiben stellte die Firma Brause her. Briefpapier für besondere Anlässe, einfach oder in Büttenausführung, lieferte die Firma Max Krause. Das Firmenmotto lautete
Schreibste mir, schreibste ihr, schreibste auf MK-Papier.
Neben Eden & Kolk befand sich ein kleiner Frisörladen. Als Kind brauchte ich keinen Frisör. Den Haarschnitt besorgten mein Vater oder Bruder Hermann. Am Geschäftseingang des Frisörs hing ein abnehmbares Blechschild. War der Frisörmeister Rosenfeld mit Messer und Schere am Werk, hing der runde Teller draußen. War das Geschäft geschlossen, fehlte der Teller. Auf der Fensterbank machte Herr Rosenfeld Werbung für Birkin Haarwasser und Pitralon gegen Pickel.
Und was wäre Westrhauderfehn ohne Fisch! Sicherlich versorgten die vielen zur See fahrenden Matrosen und auch die selbständigen Kapitäne so manche Fehntjer mit Fisch. Aber man wollte frischen Kabeljau und Schellfisch schließlich auch dann zubereiten können, wenn die Seefahrer gerade nicht an Land waren. Dafür sorgte die alteingesessene Fischhandlung Hündling. Besonders beliebt waren die frisch geräucherten Sprotten.
Weiter im Reigen der Geschäfte: Der Familienbetrieb Fischer betrieb ein fotografisches Atelier. Hier wurde so manches Erinnerungsfoto geschossen. Auch Ereignisse aus der Fehntjer Gegend hielt Fischer im Bild fest und manche Postkarte, heute Nostalgie, entstand unter den Händen des Meisters. Sein Geschäft ging gut. Er verkaufte so manche Kamera der damals führenden Marken. Besonders beliebt war die Kamera in Würfelform.
Ostfriesen sind zwar sparsam, aber nicht geizig. So gehörte es zum guten Ruf, von Fischer auch mal ein Familienfoto anfertigen zu lassen. Der Meister kam dann selbst vorbei. Besonders das Blitzlicht war eine tolle Sache. Sollte es hell werden, also blitzen, musste ein Beutelchen mit Chemikalien angesteckt werden. Wenig später hielt auch im Atelier Fischer die neue Technik Einzug. Gemütlich ging es aber immer zu. Das war auch seine Garantie für ein gelungenes Portrait.
Weiter abwärts führte die Straße im Untenende am Hotel der Familie Bahns vorbei. Der gut geführte Familienbetrieb war wegen der angenehmen Atmosphäre bei den Einheimischen und Handelsreisenden sehr beliebt. Auch die Bediensteten machten immer ein zufriedenes Gesicht. Die Menus waren der ostfriesischen Mentalität angepasst. Hotel und Restaurant wurden gut besucht. Das im Anbau untergebrachte Filmtheater war ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Eine Werbetafel an der Wand über dem Hoteleingang kündigte den in der laufenden Woche gezeigten UFA-Film an. Der Titel und auch ein Konterfei des Hauptdarstellers waren von einem Schriftenmaler des Fehns mit der Hand hergestellt worden. Jede Woche wechselte das Filmprogramm. In den dreißiger Jahren waren die Filmgrößen Willi Birgel, Hans Albers, Charlie Chaplin, Zarah Leander und Marlene Dietrich, aber auch die ewige Wasserleiche Kristina Söderbaum die Lieblinge der Nation. Und nicht zu vergessen: der humorvoll nuschelnde Hans Moser. Beliebte Sänger dieser Zeit waren die Tenöre Enrico Caruso und Joseph Schmidt. Letzterer musste wegen Hitlers Rassengesetzen seine Laufbahn aufgeben. Das erfuhr das einfache Volk aber nicht. Seine Stimme war einfach verstummt.
Abb. 10: Johann Brunsema vor seiner Schmiede
Abb. 11: Werftbesitzer und Reeder Harm Schaa
Nicht vergessen möchte ich die Dorfschmiede des Meisters Brunsema am Ende der Häuserzeile an der rechten Kanalseite. Kurz davor stand das Haus des Viehhändlers Weinberg, der ja ausgewandert war und sein Besitztum an Harm Schaa verkauft hatte36. Sowohl der Dorfschmied Brunsema als auch Harm Schaa sollten Jahre später für mich noch eine lehrreiche Rolle spielen.
Dort, wo der Kanal im Untenende einen Bogen nach links macht und der Wasserlauf zum Verlaat gerichtet ist, endet das Untenende. Genau in dem Schnittpunkt, wo sich die Straßen beidseits des Wasserlaufs vereinen, stand die Drogerie Prahm. Hier kaufte man gängige Pflegemittel und Kräutertees ein. Auch die Heilmittel von Pfarrer Heumann standen hoch im Kurs. An Knoblauchartikeln war die gängige Sorte „Immer Jünger“37, die in Drageeform in einer Papprolle im Handel war. Ich kenne die Sorte so gut, weil mein Vater sich dieser Naturmedizin verschrieben hatte.
Abb. 12: Färberei Deepen, rechts das alte Gebäude des Verlaatshus. Davor liegen drei Torfmutten. Postkarte echt gelaufen am 12. März 1910 von Potshausen nach Bremen
Nun führt mein Weg auf der anderen Wiekenseite des Untenendes in Richtung der Kirche zurück. Von der Drogerie Prahm aus musste man eine Brücke überqueren und stand zuerst vor der Verlaatsgaststätte, die ich von innen aber nie gesehen habe. Ging man weiter, so folgte die Blaufärberei Deepen. Hier war auch meine Mutter Kundin. Sie ließ dort die selbst geschorene Wolle unserer beiden ostfriesischen Milchschafe einfärben. Dabei war die Farbechtheit garantiert. Meister Deepen und seine Färbergehilfen lieferten nur beste Qualität ab. Aus der Wolle entstand dann Garn, das meine Mutter in so mancher Abendstunde zu dicken Wollstrümpfen und Unterjacken verarbeitete. Damals gab es schließlich noch einen echten Winter.
Weiter aufwärts in Richtung Kirche kam man an der Schlachterei Renken vorbei. Hier gab es stets frische Fleisch- und Wurstwaren. War die Kohlzeit gekommen, bereitete der Meister die entsprechenden Zutaten in seiner Fleischerei. Das Nationalgericht der Ostfriesen kann erst zubereitet werden, wenn der Grünkohl den ersten Frost abbekommen hat. Pinkel, Brägenwurst und Bauchfleisch, jeweils fein geräuchert oder frisch, hielt die Schlachterei Renken täglich in ausreichender Menge bereit. Da wir Selbstversorger waren, fiel unser Einkauf bei Renken gering aus. Gelegentlich erstanden wir dort für eine frische Rindfleischsuppe mal ein Stück Rindfleisch und Markknochen.
Damals konnte noch alles unbedenklich in den Kochtopf wandern oder gebraten werden. Neben den ständigen Kontrollen, die eine einwandfreie Ware garantierten, kannte man die Seuchen der Neuzeit noch nicht. Auch waren Viehhaltung und Aufzucht ehrlich und sauber. Reich werden um jeden Preis, und sei es auf Kosten der Gesundheit des Verbrauchers, war ein verwerflicher Gedanke. Tiergerechte Aufzucht und Achtung vor der Kreatur waren selbstverständlich.
Praktisch Nachbar der Fleischerei Renken war Dr. med. Peter Visher. Sein im Stil einer Villa erbautes, sehr geräumiges Wohnhaus war ein wahrhaft herrschaftlicher Besitz. Der Vorgarten der Villa war landschaftlich architektonisch angelegt und machte stets einen gepflegten Eindruck. Hier in seinem Wohnhaus hatte der Doktor auch seine Praxis eingerichtet.38
Abb. 13: Zeitungsreklame Luikenga aus dem Jahr 1932
Abb. 14: Apotheker Theodor Sarrazin
Meine Eltern kauften viele Gebrauchsgegenstände im Geschäft Luikenga ein. Mutter kannte den Inhaber aus ihrer Ausbildungszeit bei Johann Loger. So war der Einkauf bei Luikenga immer auch Vertrauenssache.
Einen wichtigen Platz nahm in Westrhauderfehn die Apotheke Sarrazin ein. Sie war auch für die angrenzenden Regionen bis ins Emsland hinein bedeutsam. Apotheker zu sein, war in dieser Zeit und dazu in einer so abgeschiedenen Fehnregion eine große Ehre und mit einer besonderen Verantwortung verknüpft. Neben dem Arzt war der Apotheker die Vertrauensperson in Sachen Gesundheit. Was die Heilkunst angeht, war und ist der Fehntjer sehr eigen. Apotheker Sarrazin verstand es in einfacher Art, auf Menschen einzugehen. Er sorgte stets dafür, dass die verordnete Medizin schnell zur Verfügung stand. Man sollte sich daran erinnern, dass die Pharmaindustrie und die Forschung in den dreißiger und vierziger Jahren noch auf fast allen Gebieten in den Kinderschuhen steckten. Da war noch bei manchem Krankheitsbild zur Heilung die Anwendung der Naturmedizin erforderlich. Hier war das Können des Apothekers in besonderem Maße gefordert. Auf dem Fehn machte das keine Schwierigkeiten. Apotheker Sarrazin beherrschte auch diese Kunst. Manche Heilsalbe und manchen Kräutertee mixte er in gewünschter Zusammensetzung und Stärke. Mit sicherer Hand zerkleinerte der Apotheker mit dem Mörser die Körner und rührte die Mixturen, bis die richtige Zusammensetzung und Geschmeidigkeit erreicht war. Die Fehn-Apotheke von Herrn Sarrazin war auch Hilfsstation für Kühe und Pferde mit einer schmerzhaften Kolik. Der Landwirt erhielt bei Sarrazin eine wirksame Medizin für sein erkranktes Vieh.
Apothekersohn Folkert war ein guter Freund meiner Brüder. Er gehörte jahrgangsmäßig zu meinem Bruder Johann. Familie Sarrazin wurde von uns mit frischen Erzeugnissen aus der Landwirtschaft versorgt. Sohn Folkert weilte oft auf unserem Hof. Johann und Folkert gehörten zusammen mit Tini Vogelsang zu einer Konfirmandenklasse. Sie wurden in der evangelisch-lutherischen Kirche Westrhauderfehn konfirmiert.
Neben der Fehnapotheke Sarrazin hatte Dr. med. Koken seine Praxis. Der Arzt, der eine Tochter des Apothekers geheiratet hatte, bewohnte hier ein Haus und übte dort auch seine ärztliche Tätigkeit aus.
Westrhauderfehn hatte von jeher ein Postamt. Wie bereits in der kurzen Schilderung zu meinem Geburtsort Holte angeführt, war es die Verbindungsstelle für Nah- und Ferngespräche der kleineren Posthaltereien. Auch wurde hier der Brief- und Paketdienst abgewickelt. Das Postgebäude fiel wegen seines Baustils mit kleinen abgesetzten Erkern jedem ins Auge. Als Baumaterial waren Klinker mit einer auffallend glänzenden Außenschicht verwendet worden. Das sorgte mit für eine bessere Haltbarkeit, Feuchtigkeit und Frost konnten nicht so schnell ins Mauerwerk eindringen. Baustil und die Klinkersteine, die in den ostfriesischen Ziegeleien, auf ostfriesisch Tichelwarken genannt, nach einer nur dort bekannten Methode gebrannt wurden, verliehen dem Postgebäude in Westrhauderfehn eine elegante Note. Die nächstgelegene Ziegelei befand sich in der Ortschaft Langholt, wo auch die Klinkersteine gebrannt wurden. Gegenüber der Ziegelei stand die Molkerei Langholt, dessen Betreiber Molkereimeister Buchwald war.
Abb. 15: Die Molkerei Langholt nach dem Totalumbau 1935. Links die Belegschaft, rechts Familie Buchwald mit Oskar und Grete, davor Menno
Neben der Post führte eine Straße direkt zum Bahnhof der Kleinbahn Ihrhove – Westrhauderfehn. Ausgangspunkt und zugleich wieder Endstation war Westrhauderfehn. Hier befanden sich der Sitz der Verwaltung sowie die Schuppen für Lokomotive und Zugwagen. Wer in die weite Welt wollte oder beruflich den Weg antreten musste, was bei Seeleuten immer der Fall war, benutzte diese Kleinbahn. Vom Endbahnhof Ihrhove hatte der Reisende dann Anschluss an den Fernverkehr der Reichsbahn.
Die Kleinbahn beförderte auch die Güter für den Weitertransport. Das war für die Geschäftswelt lebenswichtig, zumal auch die Waren für die Geschäfte den Weg über die Schienen der Kleinbahn nahmen. Mehrere Stationen ermöglichten den Reisenden der umliegenden Ortschaften die Benutzung des Schienenweges.
Ein Uhrmachergeschäft gab es natürlich auch. Er wurde vom Uhrmachermeister Bürger betrieben. Neben Uhren führte er auch Schmuck und Trauringe. Mein Vater, dessen Taschenuhr eine Überholung benötigte, nahm mich einmal mit. Ich kann mich an die vielen Standuhren erinnern, die im Geschäft tickten.
Abb. 16: Plümer Ecke, 1920er Jahre
Abb. 17: Postkarte Plümer Ecke
Bekannt war die Gaststätte Plümer Ecke. Der Name rührt daher, dass die Schankwirtschaft direkt an der Ecke 1. Südwieke/Untenende gelegen war. An Viehmarkttagen kehrten hier die Landwirte ein, um das Geschäft zu begießen oder erst mit dem Käufer den Preis auszuhandeln, was damals noch durch Handschlag besiegelt wurde. Zu besonderen Anlässen, wie zu Erntedankfeiern oder am 1. Mai, war auch Tanz angesagt. Das damals führende Tanzlokal war Jonny Billker39, was jedoch nicht in Westrhauderfehn ansässig war. Soweit ich mich erinnern kann, war das Lokal in Ostrhauderfehn oder auf dem Weg dorthin gelegen. Ich kenne beide Stätten der Freude nur von den Erzählungen meiner Brüder.
Abb. 18: Ansicht vom Gasthof Jonny Billker. Die Aufnahme stammt aus den 1930er Jahren, da die alte Zugbrücke noch steht.
Bei uns in der 1. Südwieke stellte der Postbote Claassen die Post zu40. Er legte alle Wege mit dem Fahrrad zurück. Zu meiner Kinderzeit war auf die Post, die damals Deutsche Reichspost hieß, noch Verlass. Nicht nur, dass die Zustellung immer exakt erfolgte. Sogar am 1. Weihnachtstag und am Neujahrstag kam der Bote mit der Post.
Oft stand ich bereits an der Einfahrt zu unserem Haus und nahm die Postsendung entgegen. Einmal kam eine Ansichtskarte, auf der hohe Gebäude abgebildet waren. Unter der Häuseransicht stand etwas geschrieben. Ich konnte noch nicht lesen, aber mir fiel auf, es waren andere Buchstaben, als ich bis dahin gesehen hatte. Es musste schon etwas Besonderes sein. Meine Mutter erklärte mir dann, dass diese Karte eine Bekannte, Frau Riemer aus Bremen, geschrieben habe. Sie besuche zurzeit Amerika und die hohen Häuser nenne man Wolkenkratzer.
Es gab auch eine Polizeistation in Westrhauderfehn. Ab und zu sah ich einen Wachtmeister in grüner Uniform auf dem Untenende zu Fuß gehen. Wenn ich noch alles richtig in Erinnerung habe, lag die Station in der Rajenwieke und der Polizist hieß Gendarmeriemeister Weber.
Das Fehntjer Blatt, die Tageszeitung, erstellte der Verlag Siebe Ostendorp. Das imposante Verlagsgebäude stand ebenfalls am Untenende.
Auch gab es eine Fahrschule. Der Inhaber, zugleich Fahrlehrer, hieß Schuver. Er betrieb auch ein kleines Taxiunternehmen. Das Gemischtwarengeschäft Wilhelm Olligs (später Olligs-Kramer) am Untenende war oft Einkaufsziel meiner Mutter. Der Auktionator und amtliche Versteigerer Heiko Athen41 hatte im Zentrum des Fehns sein Büro, zugleich Wohnhaus. Hier hat mein Bruder Johann eine Lehre als Lohnbuchhalter und Bürogehilfe abgeschlossen. Athen war ein strenger Lehrherr, der viel verlangte und keine Almosen verteilte. Seine Ehefrau stammte aus den Niederlanden.
Wer etwas Besonderes suchte und es in den Geschäften ringsum nicht fand, der suchte das Eisenwarengeschäft Gerd Lütter im Rajen am Beginn der 3. Wieke auf. Lütter war ein Geschäftsmann mit einem feinen Gespür für den kurzfristigen Bedarf seiner Kunden und für Ware, die auf Dauer benötigt wurde. Daher hatte er stets ausreichend Vorrat auf Lager. Die bei den übrigen Vertretern seiner Zunft vorhandenen Lücken im Versorgungsnetz hatte Gerd Lütter schnell erkannt und in seinem Geschäft geschlossen. Mit seinen geschäftlichen Fähigkeiten und seinem kaufmännischen Können konnte er mit den Großen der Hansestädte durchaus mithalten. Bevor ein Fehntjer in Leer, der Kreisstadt, einkaufen ging, wurde zuerst Lütter beehrt. Was er nicht hatte, besorgte er schnellstens. Das ersparte manchen Weg in die Kreisstadt. Ich war als Kind einige Male in dem Laden. Immer dann, wenn meine Eltern dort etwas zu besorgen hatten, nahmen sie mich mit.
Abb. 19: Zeitungsreklame von Duprée
Schuhe kaufte man als Fehntjer bei Duprée ein. Führend auf dem Markt war die Marke Salamander. Als kleiner Junge freute ich mich immer über die bunten Bilder mit dem Feuersalamander, den ich später in der freien Natur noch einige Male bewundern durfte.
18 Gemeint ist die Schule Hahnentange, die spätere Konke-Oltmanns-Schule. Dort unterrichtete ab dem 1. April 1928 auch das „Fräulein“ Marie Meentz, geb. am 6.2.1895 in Esens-Moorweg. Sie blieb bis zu ihrer Pensionierung am 1.4.1960 in der Hahnentanger Schule als „Lehrerin in der 3. Stelle“ und starb im Januar 1969 in Leer. Ihre Schwester Henny Meentz unterrichtete ab 1919 in der Schule Rajen. Sie heiratete in den 1930er Jahren den Textilkaufmann Meinhard Schoon (gest. 30.6.1986). Henny Schoon geb. Meentz starb am 6.3.1963. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Westrhauderfehn-Untenende. Der Lehrbetrieb an der Konke-Oltmanns-Schule wurde zum 31. Juli 2016 eingestellt.
19 Luther wurde am 10. November 1483 geboren und am folgenden Martinstag, dem 11. November, getauft. Während das evangelische Martinisingen in Ostfriesland am 10. November auf Martin Luther zurückgeht, ist das katholische Martinssingen am 11. November der Festtag des Heiligen Martin von Tours.
20 Das Lied wird gesungen nach der Melodie von „Üb’ immer Treu und Redlichkeit“. Es ist ein typisches Martinilied, jedoch kein evangelisches Kirchenlied.
21 Als „Kipp Kapp Kögel“ werden die Laternen beim Martinisingen bezeichnet. Der Originaltext lautet: „Kippkappkögel, Sünnermartens Vögel. Ich bün Moeders lüttje Maid, de mit Kippkappkögel geiht.“
22 „Onkel Cremer“ wohnte in der 1. Südwieke, nach Kriegsende dann in der Rhauderwieke. Er hatte zwei Kinder, Bertha und Viktor. Der Sohn kam als Lehrling bei einem Bombenangriff auf die Kriegsmarinewerft in Wilhelmshaven um.
23 Im nord-östlichen Ostfriesland, insbesondere im Harlingerland, heißt es „Platt snacken“.
24 Gemeint ist der amerikanische Germanist Marron Curtis Fort. Er begann in den 1970er Jahren seine Studien zum Saterfriesischen und leitete bis zum Jahr 2003 die Arbeitsstelle Niederdeutsch und Saterfriesisch an der Universität Oldenburg. Unter anderem erstellte er das Saterfriesische Wörterbuch, das 1980 erschien.
25 Jan Poelmann hatte eine Landwirtschaft gepachtet. Hier arbeiteten ab und zu Gefangene aus dem Lager, die dort auch verpflegt wurden.
26 Christoph Bohlmann aus Westrhauderfehn, Jahrgang 1927, erinnert sich 2016 an Johann Hogelücht: „Mein Bruder und ich besuchten häufiger meine Großeltern, die in Hahnentange eine Landstelle besaßen. Ein Onkel schnitt dann unser Haar. Dabei kamen wir auch an dem besagten kleinen Haus vorbei, das etwa sechzig Meter vom Weg entfernt lag. Plötzlich lief der Junge der Familie Richtung 1. Südwieke und schwang ein Beil in seiner Hand. Aber er konnte nur schlurfend vorankommen, weil er große Holzschuhe an den Füßen hatte. Die hatte man ihm extra so groß gekauft, damit er andere Kinder nicht erreichen konnte.“
27 Ein Kornweiher (plattdeutsch „Weih“) ist ein maschinelles Hilfsmittel, um Getreidekörner von der Spreu zu trennen. Dazu wird in der Maschine ein Luftstrom erzeugt und ein Rüttelsieb in Gang gesetzt. Christoph Bohlmann erinnert sich: „Vor Einführung der Maschinen wurde diese Arbeit per Hand mit einem flachen, korbähnlichen Weiher ausgeführt. Körner und Spreu wurden immer wieder mit Muskelkraft hochgeworfen und durch den Wind voneinander getrennt. Da waren Windstärken ab fünf schon nützlich. Die Körner fielen zurück in den Weiher, die Spreu verteilte sich in alle Winde.“
28 „Schwan im Blauband“ war der Vorläufer von „Rama im Blauband“, später „Rama“.
29 Die „Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik Yenidze“ wurde 1886 in Dresden gegründet. 1925 übernahm Reemtsma die „Yenidze Cigarettenfabrik“ und produzierte im Dresdner Werk die Salem-Marken „Salem Gold“, „Salem Auslese“ und „Salem No. 6“.
30 Bäcker Johann Wiese war auch Imker. Er verwendete den Honig in seiner Backstube. Der Helgen der Brüder Dirk und Thole Wiese (das ist die schräg abfallende Fläche, auf der ein Schiff beim Stapellauf zu Wasser gelassen wird, auch Helling genannt) lag auf der anderen Seite des Hauses (heute Werftstraße).
31 Gemeint ist das alte Fehnhaus Nr. 76a gegenüber der heutigen Werftstraße (Werft Wiese). Es gehörte Anton Abels und Ehefrau Therese, geb. Ficken. In der Familie Abels lebte der Junggeselle Berti, genannt Storke. Er wurde während der Zeit des Dritten Reiches zwangssterilisiert. Dies soll von Dr. Visher verfügt worden sein. Storke überlebte den Krieg. In seiner zweiten Lebenshälfte heiratete er Anni Temmen. Sie wohnte mit ihrer Familie zunächst in einer kleinen Holzbaracke, die 1926 von Gast- und Landwirt Harm Diekhoff errichtet worden war (Klostermoor, Siedlungsstraße 16, ehemals Nr. 46). Nach dem Tod der Eltern wurde die Baracke abgerissen, Anni zog mit ihrem Bruder in die 3. Südwieke. Anni und ihr Bruder sollen ebenfalls sterilisiert worden sein (Auskunft zu den Sterilisationen von Heinz Mayer, Klostermoor, 2016). Der Journalist Heinz J. Giermanns aus Westrhauderfehn geht in seinem Beitrag „Verstorbene nahm NS-Verbrechen an Eltern mit ins Grab“ (Zeitschrift „Fehntjer Zeitgeist“ vom 1. Februar 2015) auf die Position von Dr. Visher während der NS-Zeit ein: „Dr. Visher war Leiter des ‚Amtes für Volksgesundheit’ für den Kreis Leer und damit verantwortlich für die Umsetzung der Rassegesetze der NS-Regierung.“
32 Nach Erinnerung von Follrich Poelmann (Jahrgang 1928) befand sich das Nest nicht direkt auf dem Haus, sondern in einem Baum etwa zwanzig Meter vom Haus entfernt.
33 Es handelte sich um grüne Wasserfrösche oder olivfarbene Grasfrösche. Laubfrösche gab es auf dem Fehn nicht.
34 siehe Fußnote 11
35 Hochdeutsch: Wer schreibt, der bleibt.
36 siehe Fußnote 11
37 Gemeint sind die Knoblauchbeeren „Immer jünger“ der Firma Paul Knufinke aus Wuppertal-Barmen. In den 1930er Jahren wurde eine Monatspackung zum Preis von einer Reichsmark angeboten, die Drei-Monats-Packung kostete 2,65 Reichsmark. Heute gehört die Divapharma-Knufinke GmbH mit Sitz in Berlin zur Klosterfrau Healthcare Group.
38 Dr. Visher übernahm die Praxis von Dr. Johann Niklas Nellner, der über 40 Jahre in Westrhauderfehn praktizierte und 1919 starb.
39 Jonny Billker war ein Tanzlokal in Ostrhauderfehn. Heute befindet sich darin das Gebäude der Volksbank.
40 Landbriefträger Hinrich Claassen wohnte in Klostermoor an der heutigen Friesenstraße.
41 Heiko Athen, geb. 1889, verstarb 1984. Er war neben seiner Tätigkeit als Auktionator auch als Rechtsbeistand und später als Bank-Geschäftsstellenleiter tätig. Athen hatte während des Ersten Weltkrieges die Truppen beim Feldzug in Kroatien und Serbien als Heeresfotograf begleitet. Zuhause dokumentierte er das Leben auf dem Fehn in den 1920er bis 1940er Jahren. Apotheker Alwin Voßberger aus Ostrhauderfehn kaufte in den 1980er Jahren nach dem Tod Athens den Bilder- und Filmenachlass von dessen zweiter Ehefrau auf. Die Fotoplatten aus dem Ersten Weltkrieg lagern seit 2014 als Schenkung im Bayerischen Armeemuseum Ingolstadt.