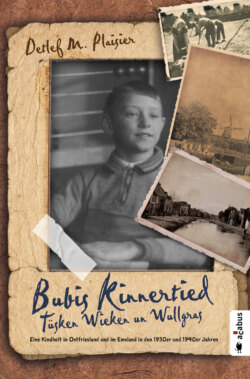Читать книгу Bubis Kinnertied. Tüsken Wieken un Wullgras - Detlef M. Plaisier - Страница 9
ОглавлениеVorwort: Der lange Weg zu dieser Biografie
„Vielleicht muss man erst in seinen Siebzigern sein, um sich einen möglichst unverstellten Blick auf sein eigenes Leben und das seiner Familie gestatten zu können.“ So analysiert es Olaf Ihlau in seinen autobiografischen Aufzeichnungen „Der Bollerwagen“, einem Rückblick auf die Flucht aus dem umkämpften ostpreußischen Königsberg im Jahr 19452.
Mir haben die Suche nach der eigenen Identität, die Rückbesinnung auf die Familie und der Wunsch, mit den unbewältigten Brüchen der eigenen Biografie Frieden zu schließen, den Mut für diesen Blick gegeben.
Als mein Vater im März 2006 in Hannover starb, lebte ich gerade einige Monate in Leipzig. Der Anruf erreichte mich im Lärm des Hauptbahnhofes. Wenige Tage später fuhr ich in meine Geburtsstadt. Ich wusste, es würde eine unangenehme Reise werden. Die zweite Frau meines Vaters hatte ich nie akzeptiert. Sie gehörte für mich nicht zur Familie, auch weil sie meinen Vater verändert und mir entfremdet hatte.
Ich wusste von einem gemeinsamen Testament. So galt es für mich nur, Erinnerungen zu sichern: einige Stücke aus der langen Dienstzeit meines Vaters als Polizist, einige Bilder für die Familienforschung. Und dann war da dieses Manuskript. Ich hatte nichts davon gewusst, mein Vater hatte es nie erwähnt. Vielleicht wollte er mir so erzählen, was in den Jahren vor seinem Tod ungesagt geblieben war. Als ich mich entschieden hatte, einen eigenen Weg zu gehen, einen Weg, der nicht mehr seinen übermächtigen väterlichen Ratschlägen folgte, waren wir nicht mehr Vater und Sohn. Ich kam nur noch zu Besuch.
Wir tranken dann Ostfriesentee, den mein Vater so zubereitete, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Er hatte sich, weit von seinem ostfriesischen Himmel entfernt, einige wenige Rituale bewahrt, und erst heute weiß ich, wie sehr er unter dem Verlust der Heimat gelitten hat.
Mit einem Psychotherapeuten arbeitete ich die Beziehung zu meinem Vater auf. Ich musste viele schmerzhafte Dinge zulassen, um Frieden zu schließen. Erst im Jahr 2013 entschloss ich mich, das Manuskript meines Vaters zu bearbeiten und als Biografie zu veröffentlichen. Es sollte der letzte Schritt sein, der Abschluss einer Versöhnung. Was ich las, war ein Faustschlag. Aus der Lokalbiografie wurde Zeitgeschichte: Meine Großeltern waren in die Maschinerie des NS-Staates verstrickt.
Wieder gab es Gespräche mit dem inzwischen vertrauten Psychotherapeuten. Wir sprachen über Glauben und über die Ursprünge von Angst. Zum ersten Mal wurde ich mit dem gesellschaftlichen Phänomen der Kriegsenkel konfrontiert. Ich spürte: Das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Warum bin ich so rastlos? Warum fehlt mir die innere Ruhe? Und warum sehe ich Neues zuerst immer negativ? Ich begann, mich in das Thema einzulesen, verschlang die grundlegenden Werke von Sabine Bode, konnte Katja Thimms „Vatertage“ nicht mehr aus der Hand legen, verschlang Kathleen Battkes „Trümmerkindheit“, fühlte mit Alexandra Senffts Familiengeschichte „Schweigen tut weh“ und informierte mich über die Möglichkeiten von Kriegskindern und Kriegsenkeln in der Psychotherapie. Den Roman „Bild des Vaters“ des sorbischen Schriftstellers Jurij Brězan, der im Jahr 2006 achtzehn Tage vor meinem Vater starb, fand ich in einer abgegriffenen Ausgabe in einem öffentlichen Bücherschrank. Er ist gewidmet „Den Enkeln meines Vaters“.
Ich brauchte lange, um zu verstehen, dass meinem Vater zeit seines Lebens der emotionale Zugang zu den Kriegserfahrungen und damit zu seinen wichtigsten Prägungen fehlte. Für ihn war alles normal, nichts Besonderes; Millionen andere Menschen hatten es doch auch so erlebt. Sein extremes Bedürfnis nach materieller Sicherheit und die Angst vor Veränderungen im gewohnten Ablauf des Lebens prägten meine Erziehung. Was ich oft als Zurückweisung und mangelnde Liebe empfand, war nichts anderes als verdrängte Aufarbeitung. Erst das Aufschreiben der Erinnerungen löste die Selbstbetäubung meines Vaters.
Es fehlte noch ein Schritt: Ich fuhr an die Orte des Geschehens, um mich zu stellen. Es war eine gute Entscheidung. Ich traf auf Wärme und Verständnis, fand neue Verwandte und brachte viele Bilder mit. Inzwischen hat sich der Kreis geschlossen: Ich bin ins Emsland gezogen, nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo mein Großvater in einem der Emslandlager Opfer des NS-Regimes beaufsichtigte.
Der Text meines Vaters entstand 50 Jahre nachdem er Ostfriesland als Lebensmittelpunkt verlassen hatte. Ich habe seine Aufzeichnungen behutsam sprachlich angepasst. Aufgrund der großen zeitlichen Distanz der Schreibzeit zur beschriebenen Zeit mussten sich zwangsläufig geografische und historische Ungenauigkeiten und auch Verklärungen einschleichen. Um dies einzuordnen und auszugleichen, habe ich dem Text Fußnoten angefügt und Kommentatoren unter der Rubrik „Nachgefragt“ gebeten, ihre Sicht der Dinge zu ergänzen. Ich habe als Herausgeber bewusst darauf verzichtet, einzelne Schilderungen oder Ereignisse der Zeitgeschichte zu werten.
Einige Fragen müssen im Bereich der Spekulation bleiben. Welche Rolle spielte mein Großvater im Lagerkomplex Esterwegen? Wie groß war seine Verantwortung oder gar Schuld? Die Bewacher waren je nach Lagerart, aber auch in den KZ im Jahr 1933, unterschiedlich: Eingesetzt waren SA, Polizei, SS oder Justiz, Freiwillige oder zuletzt ab 1942 überwiegend Abkommandierte. Wann genau also war mein Großvater in Esterwegen? Hätte er vor 1942 eine Tätigkeit als Wachmann aufgenommen, so müsste er Mitglied der SA gewesen sein. War er überhaupt Wachmann, ein „Blauer“ in der blauen SA-Uniform, oder ein „Grüner“ in der grünen Justizuniform? Oder war er Ziviler, „nur“ angestellt bei der Mooradministration?
Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen den Begriff des Gefangenenlagers eher mit einem Konzentrationslager denn mit einem Strafgefangenenlager verbinden. Die Unterscheidung zwischen beiden Lagerarten ist mir wichtig: Zu leicht entsteht der Eindruck, ich habe zwecks besserer Vermarktung von KZ und nicht von Strafgefangenenlagern gesprochen.
Hat mein Vater seinen Vater wirklich über das KZ Börgermoor oder Esterwegen sprechen hören, oder meinte er „nur“ das Strafgefangenenlager? Vielleicht hat sich erst beim Aufschreiben der Erinnerungen der Begriff KZ in seine Erinnerungen hineingedrängt. Aber auch das ist Spekulation und bleibt offen.
Und nun übergebe ich das Wort an meinen Vater.
Detlef M. Plaisier
Westrhauderfehn, im September 2016
2 Siedler Verlag, 2014