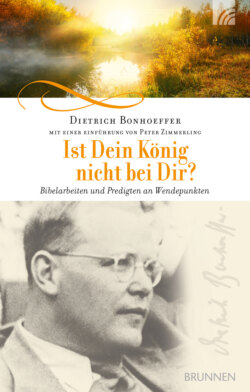Читать книгу Ist Dein König nicht bei Dir? - Dietrich Bonhoeffer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Zum Inhalt der Predigtlehre 9
ОглавлениеDie Predigt ist für Bonhoeffer motiviert durch den Auftrag Jesu Christi, konzentriert auf Bibelwort und Nachfolge und orientiert am Aufbau von Kirche. Unter der Überschrift „Wie entsteht eine Predigt?“ gibt Bonhoeffer sehr konkret einzelne Schritte auf dem Weg vom Bibeltext zur Predigt vor: Am Anfang der Ausarbeitung jeder Predigt steht das Gebet. Dieses ist für die Predigtvorbereitung unerlässlich, weil die Predigt nicht die Aufgabe hat, eigene Gedanken des Predigers weiterzugeben, sondern darin Gott selbst zu Wort kommen soll. Darauf folgt die Meditation: in einem ersten Schritt unter der Fragestellung, was der Text dem Prediger persönlich, in einem zweiten, was er der Gemeinde zu sagen hat. Bonhoeffer thematisiert auch den Zeitraum der Abfassung der Predigt: „Spätestens Dienstag anfangen, spätestens Freitag fertig sein! Es muss wenigstens zwölf Stunden daran gearbeitet werden“ (488). Die Predigt soll vor dem Vortrag memoriert werden, wobei die Vikare sich Gedankenzusammenhänge einzuprägen haben, nicht jedoch den gesamten ausgearbeiteten Text. Nur unter dieser Voraussetzung kann die Predigt auf der Kanzel wirklich gehalten werden: Sonst verkommt der Kanzelvortrag zum bloßen Vorlesen des Manuskripts: „Eine Predigt wird zweimal geboren, in der Pfarrstube und auf der Kanzel, die zweite ist die eigentliche Entstehung“ (488; Hervorhebungen im Text).
Bonhoeffer gibt auch Hinweise für die Gestaltung der Arbeitswoche, vor allem des Samstags: „Sonnabend Abend unter allen Umständen freihalten. Es ist schön, wer Sonnabend Nachmittag noch seelsorgerliche Besuche machen kann, die wirklich streng seelsorgerlich sind. Grundsätzlich jede Einladung in der Gemeinde absagen“ (488). Er spricht über das Verhalten des Predigers in der Sakristei und auf der Kanzel. Bonhoeffer verabscheut jedes Pathos, auch das religiöse: „Das Niederknien gehört nicht auf die Kanzel, sondern in die Sakristei“ (488f).
Ziel des Predigens ist es, dass die Gemeinde beginnt, selbstständig die Bibel zu lesen. Sie soll – gut reformatorisch – mündig werden in Gottes Wort. Die Predigt soll die Gemeinde deshalb zur Bibel hinführen, ihr Freude am Lesen des Wortes Gottes machen. Darum schlägt Bonhoeffer eine strenge Textpredigt vor und bevorzugt die Homilie, d.h. die Auslegung Vers für Vers. Entscheidend ist, dass der Text selbst zum Reden gebracht wird. Bonhoeffer geht von der Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes, seiner Eigenbewegung aus.10 Wenn nur der biblische Text selbst zu den Hörerinnen und Hörern zu reden beginnt, ist das Ziel einer Predigt erreicht. Deshalb lehnt Bonhoeffer jede Form von Einleitung ab: „Den Leuten mit dem Text ins Gesicht springen!“ (490). Einleitungen lenken einerseits vom Text ab, andererseits drängt sich bei den Hörern der Eindruck auf, als ob der Bibeltext nicht selbst etwas zu sagen hätte und ihm durch den Prediger erst nachgeholfen werden müsse.
Grundsätzlich ist nach Bonhoeffers Ansicht jeder biblische Text als Predigttext geeignet. Betont wirbt er für alttestamentliche Texte.11 Auch das stellte ein Novum gegenüber der liberalen Theologie dar, die, wie etwa Friedrich Schleiermacher, das Alte Testament für entbehrlich hielt. Bonhoeffer hat – wie Martin Luther – im Gegensatz dazu eine Vorliebe für das Alte Testament. In „Widerstand und Ergebung“ spricht er davon, er habe am Alten Testament gelernt, dass Gott den Menschen an sein Leben auf der Erde verweist. Im Gegensatz zu den altorientalischen Erlösungsmythen werde die Erlösung im Alten Testament nämlich streng geschichtlich, d. h. irdisch-diesseitig gedacht.12
Bonhoeffer thematisiert in seiner Predigtlehre auch formale Aspekte. Im Anschluss an Augustinus und Cicero soll sie Momente der Lehre, der Erbauung und der Bekehrung enthalten. Die Reformation entdeckte die Unverzichtbarkeit der Predigt für den Gottesdienst wieder. Das Proprium des protestantischen Gottesdienstes liegt in der Predigt. Das Wort der Predigt steht für Bonhoeffer nicht im Dienst von etwas anderem, sondern ist die Sache selbst (495). Er geht von ihrem performativen Charakter aus: Das Wort selbst ist es, das siegt und tröstet (495). Weil Gott das Subjekt des menschlichen Sprechens in der Predigt ist, kann der Prediger zuversichtlich sein, dass das Wort Gottes in der Predigt tatsächlich seine Kraft entfalten wird. Immer wieder macht Bonhoeffer seinen Vikaren Mut, auf die Kraft des Wortes Gottes zu vertrauen: „Größte Scheu und Zurückhaltung gegenüber dem Wort. Größte Zuversicht und Fröhlichkeit zu der alleinigen Kraft des Wortes“ (498; Hervorhebungen im Text).
Als Kirche des Wortes hat die Kirche der Reformation die Aufgabe, die Sprache der Predigt besonders zu pflegen. Sie soll nicht die wortreiche „Sprache Kanaans“ sein, sondern durch die Sprache der Lutherbibel bestimmt werden. Bonhoeffer meint, dass die Lutherbibel in vorbildlicher Weise jeden Wortüberfluss vermeidet: „Überfluss macht das Wort in den Wörtern unhörbar“ (499).
Am Ende der Vorlesung spricht Bonhoeffer über das Verhalten des Predigers nach der Predigt. Das Gebet in der Sakristei steht dabei an erster Stelle. Bonhoeffer empfiehlt dem Pfarrer auch den regelmäßigen Besuch des Abendmahls (eine Besonderheit, weil das Abendmahl in den Gemeinden meist nicht öfter als dreimal im Jahr gefeiert wurde). Der Prediger bedarf überdies der Seelsorge, d.h. geistlich geprägter Rückmeldungen zu seiner Predigt. Außerdem soll er den Text und die Predigt noch einmal für sich selber durchgehen. Schließlich hat er die Aufgabe, Fürbitte für seine Amtsbrüder zu üben.
Abschließend möchte ich von den durch Bonhoeffer im Lauf der Jahre vorgenommenen Erweiterungen der Homiletikvorlesung noch zwei Themenkreise aufgreifen, die mir im Hinblick auf die heutige Diskussion wesentlich erscheinen:
• Das Wort, das Predigtamt und das Pfarramt“ (502–507):
In diesem Vorlesungsabschnitt fällt der Gedanke ins Auge, dass Bonhoeffer die Predigt mit Christus identifiziert. „Als Wort schreitet er durch seine Gemeinde“ (503). „Das Wort ist der Inkarnierte als derjenige, der die Sünde der Welt trägt“ (a.a.O.). „Das Wort der Predigt will Menschen annehmen, will unsere sündige Natur tragen“ (a.a.O.). „Im verkündigten Wort tritt Christus in die Gemeinde hinein […]“ (506). Die Predigt hat also für Bonhoeffer eine Art sakramentalen Charakter.
• Der Pfarrer und die Bibel“ (510–513):
Bonhoeffer geht von einem dreifachen Gebrauch der Bibel durch den Pfarrer aus. Die Bibel gehört nicht nur auf die Kanzel, sondern genauso auf den Schreibtisch, aber eben auch auf das Betpult. Einerseits besitzt die Bibel eine jeweils eigenständige Aufgabe auf der Kanzel, auf dem Schreibtisch und auf dem Betpult. Andererseits stehen alle drei Arten des Schriftgebrauchs miteinander in Wechselwirkung und befruchten sich gegenseitig. Die ganze Existenz des Pfarrers soll durch die Schrift geprägt werden. Die unterschiedlichen Zugänge zur Bibel führen überdies zu einer der Auslegung zugute kommenden Multiperspektivität der Bibelbetrachtung.13