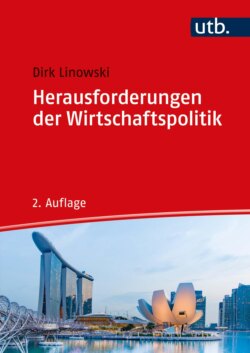Читать книгу Herausforderungen der Wirtschaftspolitik - Dirk Linowski - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1.1 Zur Entwicklung der Kosten im deutschen Gesundheitssystem
ОглавлениеDie Gesundheitsausgaben pro Person stiegen – vor der Corona-Krise! – in Deutschland von 2.407 Euro im Jahr 1996 auf 4.944 Euro im Jahr 2019. Die Gesamtausgaben des Gesundheitssystems pro Jahr ist hier die Gesundheitsausgaben pro Person multipliziert mit der jeweiligen Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland. Diese betrug im Jahr 1996 82,01 Mio. Menschen und im Jahr 2019 83,17 Mio. Menschen. Der relative Zuwachs der Bevölkerung Deutschlands betrug in diesen 25 Jahren also nur wenig mehr als 1%.
Abb. 3.1:
Entwicklung der Gesundheitsausgaben Deutschlands von 1996 – 2019. (Quelle: Statista[39]).
Unter Verwendung der allgemeinen Wachstumsformel erhalten wir mit Euro, Euro und T = 23 ein durchschnittliches geometrisches WachstumWachstum pro Jahr in Höhe von g = 0,03179, also etwa 3,2%. Wie bei sorgfältiger Betrachtung aus Abbildung 3.1 ersichtlich wird, sind die Wachstumsraten während des Betrachtungszeitraumes 25 Jahre; d.h. von 1996 - 2021, nicht konstant. So betrug die durchschnittliche Wachstumsrate von 2004 bis 2019 3,64%, die von 2009 bis 2019 4,1% und der letzte jährliche Zuwachs vor Ausbruch der Corona-Krise bereits 4,57%. Mit anderen Worten: Die Wachstumsraten der Ausgaben im deutschen Gesundheitssystem sind in den vergangenen 25 Jahren fast durchgängig gestiegen und alle Anstrengungen vor Ausbruch der Corona-Krise, die Kosten „im Griff zu behalten“, müssen als gescheitert betrachtet werden.
Welche Gesamtwirkung die Kostensteigerungen der Gesundheitsausgaben gesellschaftlich tatsächlich haben, erschließt sich, wenn der sich ändernde Anteil der Gesundheitsangaben ins Verhältnis zur Gesamtwirtschaftsleistung gesetzt wird.1 Dieser Anteil ist von 1996 bis 2019 von ca. 10% der Jahreswirtschaftsleistung auf ca. 12% gestiegen2, was zunächst einmal recht unwesentlich erscheint. Exponentielle Wachstumsprozesse verfügen indes über Tücken, insbesondere, dass es fast allen Menschen nicht möglich ist, deren Entwicklungen über mittlere oder größere Zeiträume vernünftig zu schätzen.
Tatsächlich waren die Jahre seit Ausbruch der FinanzkriseFinanzkrise im Jahr 2008 durch eine Kombination von niedrigen Wachstumsraten der Gesamtwirtschaft – im Durchschnitt betrug das WachstumWachstum des deutschen BIPBIPs von 2008 bis 2020 geringfügig mehr als 1% (s. Abb. 3.2) – und steigenden Wachstumsraten der Ausgaben im Gesundheitssektor gekennzeichnet.
Abb. 3.2:
Entwicklung des realen BIPs Deutschlands von 2008. (Quelle: Statista[40])
Es ist unmittelbar ersichtlich, dass der Anteil der Gesundheitsausgaben am „Gesamtkuchen“ stetig zunimmt, solange die Ausgaben im Gesundheitssystem stärker steigen als das BIP. Wenn wir wissen wollen, wann die Gesundheitsausgaben c.p. einen bestimmten Anteil der Wirtschaftsleistung „besetzen“ werden, genügt zur Beantwortung dieser Frage die oben erwähnte Schulmathematik. Es sei die WachstumWachstumsrate der Ausgaben im Gesundheitswesen und die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes. Ausgehend von einem Anteil der Gesundheitsausgaben am BIPBIP in Höhe von 12% im Jahr 2019 fragen wir, wann das Gesundheitssystem c.p. einen Anteil x der Jahreswirtschaftsleistung Deutschlands absorbiert. Gefragt wird nach der Anzahl der Jahre T.
Mit dieser allgemeinen Darstellung können wir nun „arbeiten“. Nehmen wir aus heutiger Sicht optimistisch an, dass und bleibt, so errechnet sich für x = 0,25 ein T von ca. 25 Jahren; gehen wir hingegen von zukünftigem Nullwachstum und durchschnittlichen jährlichen Steigerungen der Kosten im Gesundheitssytem in Höhe von 5% aus, so wird ein Viertel der Jahreswirtschaftsleistung Deutschlands bereits in 15 Jahren im Gesundheitswesen allokiert sein. Es sind schlimmere Szenarien denkbar.
Im Folgenden werden wir erörtern, wie die Entwicklung der nominalen Kosten im Gesundheitswesen pro Patient zu erklären ist. Dabei ist die Inflation – von 2009 bis 2019 betrug diese im Jahresmittel ca. 1,35% – nicht vernachlässigbar, aber untergeordnet. Die großen Kostenblöcke im Gesundheitswesen korresondieren mit dem medizinischen Personal (d.h. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger), technischen Gerätschaften (wie Magnetresonanztomographen und Computertomographen) sowie Medikamenten.
Im Jahr 1996 waren in Deutschland ca. 279.300 Ärzte in ihrem Beruf tätig. Bei 82,01 Mio. Einwohnern kam somit ein Arzt auf ca. 294 Einwohner. Im Jahr 2019 ermittelt sich ein Verhältnis von ca. 207 Einwohner pro Arzt. Adjustiert um den Bevölkerungszuwachs von etwas mehr als 1 Million Menschen verfügen wir heute also über ca. 120.000 Ärzte mehr als 1996.[41]
Wie zu Beginn von Abschnitt 3.1.1 bereits gesehen, stiegen die Gesundheitausgaben in Deutschland von 1996 bis 2019 um ca. 200 Mrd. Euro. Mit ca. 2% stieg auch der jährliche Zuwachs an Ärzten in den letzten 10 Jahren über der Gesamtwachstumsrate des BIPs, die von 1996 – 2019 bei ca. 1,5% lag.3 (Tatsächlich wird die Gesamtreduktion der Arbeitsstunden pro Arzt zu berücksichtigen sein, um den Gesamtzuwachs an Ärzten präziser zu erläutern).
Wie jedermann, der mit der Materie einigermaßen vertraut ist, stiegen in den vergangenen zehn Jahren die Gehälter bzw. Einkünfte der deutschen Ärzteschaft zwar ungleichmäßig, aber durchweg beträchtlich. Wenn wir nun vereinfacht davon ausgehen, dass ein Arzt – egal ob an einem Krankenhaus oder in einer Praxis tätig – die Kassen im Durchschnitt pro Jahr ca. 250.000 Euro kostet, können wir den Kostenbeitrag der hinzugekommenen deutschen Ärzteschaft schätzen. Die 120.000 „neuen“ Ärzte kosten ca. 30 Mrd. Euro pro Jahr. Zur Einordnung: Diese Summe korrespondiert zu etwa 365 Euro pro Bundesbürger und damit zur Summe, die vom deutschen Staat für die Opfer der Flutkatastrophe im Jahr 2021 im Ahrtal bereitgestellt wurden.
Obwohl die steigenden Kosten des bestehenden Ärztestammes zu berücksichtigen sind und unter Berücksichtigung der Kosten, die mit Krankenschwestern und –pflegern, der Verwaltung und der Kassenbürokratie verbunden sind, wird klar, dass die Explosion der Kosten im Gesundheitswesen primär nicht den mehr und teurer gewordenen Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern zuzuschreiben ist, sondern offensichtlich direkt auf Kosten für Medikamente und Apparate zurückzuführen sein muss. Hier ist zu notieren, dass die Pharmaindustrie in den vergangenen ca. 10 Jahren vermehrt Medikamente für seltenere Krankheiten entwickelt hat (Dies ist insoweit nicht erstaunlich, als dass es bereits lange wirksame Medikamente für Massenkrankheiten wie Bluthochdruck, Fettstoffwechsel, Bronchitis etc. gibt.)
Tatsächlich hat sich in den vergangenen 25 Jahren nicht nur die Anzahl der Ärzte in Deutschland erhöht, auch ist die geografische Verteilung ungleicher geworden. Auch wenn es in ländlichen Gegenden naturgemäß keine Universitätskrankenhäuser und große städtische Allgemeinkrankenhäuser gibt, so ist das Betreuungsverhältnis in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg, Köln, usw. auf ca. 75 Einwohner pro Arzt gefallen, während es in Orten mit bis zu 1.500 Einwohner vielfach keinen Arzt mehr gibt bzw. sich abzeichnet, dass Praxen keinen Nachfolger finden. Diese Entwicklung kommt nicht aus dem Nichts. Die Politik wird Anreize schaffen müssen, dass (junge) Ärzte sich zukünftig in „weniger attraktiven“ Regionen niederlassen, will sie dem Axiom des Grundgesetzes der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse näherungsweise genügen. Ebenso gefordert sind die Kultusbehörden und –ministerien der Länder sowie die Universitäten, Wege zu verbessern, junge Menschen auszuwählen, die nach Abschluss ihres Studiums den Menschen als Ärzte dienen wollen.