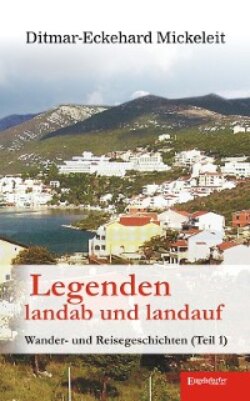Читать книгу Legenden landab und landauf - Ditmar-E. Mickeleit - Страница 7
Die Legende von Klaus (Claas) Störtebeker
ОглавлениеSchlachtgetümmel. Blitze zucken auf, Rauchwolken von Schwarzpulver machen das Atmen schwer, drüben auf der Kogge bricht ein Mast, auf einer anderen brennt es lichterloh.
„Entern!“ ertön ein laut gerufener Befehl und von den Schiffen mit der Piratenflagge, dem Totenkopf mit den gekreuzten Knochen darunter springen die Männer mit Enterhaken und Tauen rüber auf die Koggen der englischen, königlichen Handelsschifffahrt und ein nächstes Mal auf die der Hanse.
Ausgeraubt, geplündert, gebrandschatzt, so berichten es die Schiffsführer ihren Herren von den Vitalienbrüdern.
So kann es nicht weiter gehen. In der ohnehin schon unruhigen, kriegerischen Zeit zum Anbruch des 15. Jahrhunderts musste den Seeräuberhaufen ein Ende gesetzt werden.
Aber hatten nicht gerade die Schiffsführer des englischen Königshauses mit Kaperbriefen ihres Herrschers frei Hand bekommen, Handelsschiffe zu überfallen, zu kapern, auszurauben und zu versenken?
Konnte man es anderen dann verdenken, dass sie diesem Beispiel folgten?
Die britische Krone rüstete auf – nieder mit dem Seeräuberpack, diesen Vitalienbrüdern, Liekedelern, die erst als Helfer des schwedischen Königs Albrecht von Mecklenburg das von Königin Margarete von Dänemark belagerte Stockholm mit Lebensmitteln (Vitalen) versorgte, danach sich an Handelsschiffen selbst bereicherten.
Der deutsche Orden griff ein und vertrieb sie von ihrem Stützpunkt auf Gotland.
Viele Vitalienbrüder flüchteten nach Norwegen.
Zwei Anführer aber hielten sich weiterhin in der Nordsee als unbesiegbar: Godecke Michels und Claas Störtebeker. Doch auch sie wurden zur Strecke gebracht. Verrat sagt die eine Quelle, die andere spricht von einer militärischen Übermacht der Hanse, unterstützt von englischen Schiffen. Historisch belegt ist weder das eine noch das andere. Selbst die Festnahme Michels und Störtebekers und ihre Hinrichtung in Hamburg ist nebulös und kann sich zwischen 1400 und 1403 abgespielt haben.
Dessen ungeachtet sind die großen Piraten der Meere schon immer ein „Vorbild“ der Jugend gewesen, denn sie nahmen den Pfeffersäcken, also den Reichen, die durch den Handel mit Pfeffer, der mit Gold aufgewogen wurde, immer reicher wurden, die Grundlage und sie blieben nahezu überall die Sieger, bis sich ihre Spur in der Geschichte verlor.
Das mag auch der Anlass gewesen sein, dass der am 02.Mai 1901 in Hamburg geborene proletarische Schriftsteller Willi Bredel im Jahre 1950 seinen historischen Roman „Die Vitalienbrüder“ schrieb.
Willi Bredel starb 1964 in Berlin und in den nachfolgenden fünfzig Jahren wurde viel an der Störtebeker-Legende „herum geforscht“.
Theatralisch brachte erstmals der Intendant des Volkstheaters Rostock und Chef der damaligen
Schauspielschule in Warnemünde das Thema auf die Ostsee-Naturbühne in Ralswiek/Rügen.
Mit dem Ende der DDR verschwand auch diese hervorragende Inszenierung in der Versenkung.
Erst 1993 wurden die „Störtebeker-Festspiele“ in Ralswiek/Rügen, ich möchte sagen durch ein Familienunternehmen, neu begründet.
Seither sind jedes Jahr die Festspiele mit einem neuen Thema der Vitalienbrüder mit großem Aufwand und ganz sicher hohen Investitionen realisiert worden.
Und jetzt saßen wir im Autobus und waren unterwegs (man könnte meinen, wie im Mittelalter) um „Störtebekers Tod“ zu erleben.
Denn damals war eine Hinrichtung etwa das, was sich heute nahezu jeden Abend auf den unterschiedlichen Kanälen des TV als Krimi abspielt.
Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich hier keine Fotos einstellen, aber ich muss neidlos zugestehen, dass das, was der Regisseur, den ich noch aus den 70er Jahren vom „Hans-Otto-Theater Potsdam“ kenne, auf die Bühne gebracht hat, imposant und beeindruckend ist.
Ein Sänger, mit dem ich ebenfalls in verschiedenen Unterhaltungssendungen des DDR-TV zusammen war, überraschte mich als Balladensänger Abellin mit ganz neuer Facette.
Und Erika? Sie war überwältigt von diesem Erlebnis, das einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.
Es war eine „beredte Stille“, als wir mit dem Bus zu unserem Hotel in Stralsund fuhren.
Und auch hier hatten wir Glück, wie meist bei unseren Reisen, dass uns der Himmel mit Sonne satt empfing. Nicht des nachts, sondern am nächsten Morgen.
Auf dem Programm stand der Besuch des „Ozeaneums“, entstanden aus dem früheren „Meereskundlichem Museum“.
Ein beeindruckender Bau mit einer Vielfalt an Exponaten, die im Grunde keine Wünsche offen ließen. Erika fand sofort ihr passendes „Haustier“.
Und ich vermeinte die richtige Kopfbedeckung für alle Wetterlagen gefunden zu haben.
Freilich waren sie etwas schwerer, als Regenschirme, die messinghaften Taucherhelme. Und das Gesichtsfeld haben sie auch ganz schön eingeengt.
Vom Dach des Gebäudes ergab sich ein herrlicher Rundblick über die Altstadt auch ohne Taucherhelme.
Stralsund wurde um 1200 gegründet und erhielt bereits 34 Jahre später die Stadtrechte. 1293 kam die Stadt zur Hanse und gehörte zu Pommern.
Als es zum Überfall durch die Lübecker Flotte kam, errichtete die Stadt ab 1249 die Stadtmauer, von der einige Teile mit den alten Wachhäusern (Wiekhäusern)
noch erhalten sind.
Wallenstein belagerte 1628 im Dreißigjährigen Krieg vergeblich die Stadt Stralsund. Im gleichen Jahr kam sie nach dem Westfälischen Frieden mit Vorpommern zu Schweden und war ab 1720 Verwaltungssitz der schwedischen Regierung für Vorpommern.
In den vielen Auseinandersetzungen und Gebietsabtretungen wurde Stralsund 1815 preußisch.
Sechs Jahre zuvor war in der Stadt im Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft Ferdinand von Schill gefallen.
Als Verkehrsknotenpunkt zu den Bädern auf dem Darß, zur Insel Rügen und nach Skandinavien (Rügendamm) hat die Stadt Stralsund nichts von ihrem Flair und ihrer Bedeutung eingebüßt.
Als wir uns vor dem Ozeaneum auf einem Freisitz nieder ließen um ein Bierchen zu trinken, entdeckte ich die abgetakelte Gorch Fock, das Segelschulschiff der Bundesmarine direkt vor unserer Nase.
Leider reichte unsere Zeit nicht mehr für eine Besichtigung.
Es war aber auch abgetakelt schon ein imposanter Anblick dieses Schiff zu sehen, seine Ausmaße einmal direkt vor Augen zu haben und nicht immer nur in der gefilmten Teilversion einer Fernsehkamera.
Freilich tauchte auch hier die Frage auf: „Brauchen wir so etwas überhaupt?“
Kann eine Ausbildung auf einem SEGELSCHULSCHIFF die Erfahrungen auf dem Wege zu einem Schiffsoffizier, Nautiker, vielleicht Maschinisten befördern?
Ist nicht mehr oder weniger Abenteuer und Nostalgie dabei?
Wem also nützt es noch bei der heutigen modernen Technik? Ist da die Kunst der Havariebeherrschung nicht wichtiger, als die Segel zu reffen?