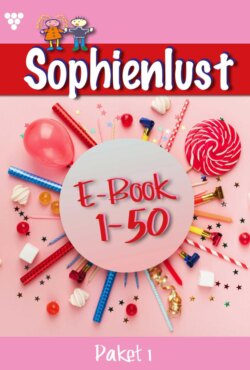Читать книгу Sophienlust Paket 1 – Familienroman - Diverse Autoren - Страница 12
ОглавлениеAuf Gut Sophienlust herrschte Sonntagsfrieden. Denise von Wellentin war mit den Kindern zur Kirche gefahren. Das Erntedankfest wurde gefeiert. Beladen mit Blumen und Früchten, hatten selbst die Kleinen Gefallen an diesem Kirchenbesuch gefunden, der sonst ihre Ungeduld manchmal auf eine so harte Probe stellte.
Nur Justus war im Hause.
Mit einem Besuch war heute nicht zu rechnen, denn nach der Kirche fanden sich alle im »Grünen Baum« zum Festtagsschmaus zusammen, an dem auch die Schoeneckers teilnahmen.
So wunderte sich Justus sehr, als ein Wagen vorfuhr, dem ein Herr und eine Dame entstiegen. Aber ein freundliches Lächeln ging über sein Gesicht, als er Dr. Günther Berkin erkannte.
»Hier ist es aber ruhig«, meinte Günther Berkin verwundert.
Justus erstattete Bericht. Dr. Berkin hatte seinen Besuch nicht angekündigt. Er hatte seine kleine Tochter Susanne überraschen wollen.
Da er geschäftlich in Deutschland zu tun hatte, wollte er die Gelegenheit wahrnehmen, Ines Jakobus, die nicht mehr nur seine Sekretärin war, mit Susanne bekannt zu machen.
Ines, die sich während der letzten Wochen sehr zu ihrem Vorteil verändert hatte und sehr weiblich und anmutig wirkte, sah dieser ersten Begegnung mit dem Kind allerdings recht besorgt entgegen.
»Sie werden sich schon zum ›Grünen Baum‹ begeben müssen«, meinte Justus höflich. »Sie werden erst nachmittags zurückkommen und abends ist dann Erntetanz. Da werden Sie auch Ihren Spaß haben.«
Nach solchem Spaß war es den beiden nicht so recht zumute. Sie hatten den weiten Flug von Johannesburg hinter sich, und morgen musste Günther Berkin schon zu seinen geschäftlichen Besprechungen weiterreisen. Es blieb ihnen nicht viel Zeit, Susanne darauf vorzubereiten, was sich auch in ihrem Leben ändern würde, denn Günther und Ines hatten den Entschluss gefasst, zu heiraten und Susanne zu sich zu nehmen.
Aber Ines sank das Herz jetzt ganz tief, wenn sie dieses wunderschöne Haus sah, die wundervolle Umgebung, in die dieses große Gut eingebettet war.
Würde sich die kleine Susanne, die so sehr an ihrem Freund Nick hing, von hier trennen wollen, fragte sie sich. Mit mütterlicher Güte hatte Denise von Wellentin das mutterlose Kind zu sich genommen und es behutsam mit ihrem Vater zusammengeführt.
Ines liebte Günther Berkin, aber sie machte sich keine Illusionen, dass für ihn vorerst das Wohl seines Töchterchens über allem stand, dessen Liebe er sich hatte erringen müssen.
»Es hat sich allerlei getan bei uns«, erzählte Justus weiter, aber das Meiste wusste Günther Berkin schon aus den Briefen, die sein Töchterchen Claudia oder Denise von Wellentin diktiert hatte. Günther Berkin war auch bereits informiert, dass Irene von Wellentin, Dominiks Großmutter, den Weg zum Herzen ihres Enkels gefunden hatte, während ihr Mann, von dem sie seit einigen Wochen getrennt lebte, noch immer hochmütig darauf beharrte, dass Denise, die frühere Tänzerin, nicht als eine Wellentin anerkannt werden dürfe.
»Sie wollen doch Susi nicht jetzt schon holen«, meinte Justus erschrocken. »Das wird uns aber hart ankommen.«
Günter Berkin und Ines Jakobus blickten sich an. Sie wussten nicht, wie sich das Kind entscheiden würde.
»Die Kinder fühlen sich ja so wohl hier«, fuhr Justus fort. »Neulich hat Frau von Wellentin, die Großmama, noch die kleine Marlies gebracht, und nächste Woche kommen wieder zwei Kinder. Das Haus wird langsam voll, aber schön ist es und zufrieden sind alle, die Kleinen und die Großen. Und die neue Schule müssen Sie sich ansehen, Herr Doktor. Das alles haben wir unserer verehrten jungen gnädigen Frau zu verdanken.«
*
Fast die gleichen Worte musste Denise von Wellentin eben aus dem Mund des Pfarrers vernehmen. Es war ihr gar nicht recht, so in den Blickpunkt gerückt zu werden, aber der Erntedanktag bot einen willkommenen Anlass, ihre Verdienste zu würdigen.
Sie hatte Liebe und Güte gesät, und nun konnte auch sie erstmals reiche Ernte halten. Von überall wurden ihre Beweise der Dankbarkeit, Verehrung, Bewunderung und Liebe zuteil.
Sie saß zwischen Dominik und Susanne Berkin, auf dem Platz der verstorbenen Sophie von Wellentin, deren Vermächtnis sie verwaltete. Hinter ihnen saßen Claudia und ihr Verlobter Dr. Lutz Brachmann mit den Kindern Mario und Roli, mit Frau Trenk und ihrem Sohn Robby. Auf der hintersten Bank des Seitenflügels hatten Irene von Wellentin mit Edith Gerlach und der kleinen Petra Platz genommen. Sie zeigte sich heute zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit, ohne ihren Mann, aber an der Seite ihres Schützlings.
Denise gegenüber saßen Alexander von Schoenecker und seine Kinder Sascha und Andrea. Immer wieder trafen sich ihre Blicke, als der Pfarrer von der großen Aufgabe sprach, die Denise auf sich genommen hatte, zum Wohle heimatloser Kinder, zum Wohle eines ganzen Dorfes, das sich glücklich schätzte, sie in ihrer Mitte zu wissen.
»Schön hat er gesprochen, Mami«, stellte Nick fest.
Was Denise verlegen machte, erfreute ihn. Er hatte es gern, wenn seine Mami bewundert wurde, denn sie verdiente es. Dominik konnte das schon ganz genau beurteilen, denn er hatte ja alles von Anfang an mitgemacht. Sie hatte das Baby Petra aufgenommen und nun auch Edith Gerlach, die es in tiefster Not vor die Tür gelegt hatte. Seine Mami hatte Robby mitgebracht und dafür gesorgt, dass seine Mutter wieder gesund wurde und nun auch bei ihnen bleiben konnte. Susanne und Mario gehörten sowieso schon zur Familie und Roli hatte sogar das Lachen wieder gelernt. Von der Großmama und Onkel Alexander ganz zu schweigen. Man musste seine Mami lieb haben, fand Dominik, und er verstand es auch, dass Sascha und Andrea viel lieber hier waren als bei ihrer Großmutter.
Bald gingen sie gemeinsam zum »Grünen Baum«, wo die Festtafel gedeckt war.
Vorerst galt das Interesse der Kinder jedoch den Karussells, die auf der Wiese vor dem Gasthof aufgebaut worden waren.
»Komm, Susi, wir fahren mit dem roten Auto«, schlug Dominik seiner kleinen Freundin vor, als diese sich plötzlich umdrehte, weil jemand ihren Namen gerufen hatte.
»Papi!«, rief sie atemlos. Mit einem Jubelruf stürzte sie dem schlanken sonnengebräunten Mann in die Arme.
Er fing sie auf und drückte sie an sich, während Ines schnell ein paar Schritte zurückgewichen war, um diese Wiedersehensfreude nicht zu stören.
»Du hast gar nicht geschrieben, dass du kommst«, meinte Susanne vorwurfsvoll. »Jetzt muss ich Tante Isi erst einmal fragen, ob es für dich auch etwas zu essen gibt.«
»Das Essen ist mir nicht so wichtig, Susi«, erwiderte er zärtlich. »Da ist noch jemand, der dir guten Tag sagen möchte. Tante Ines.«
Der Name Ines war Susanne mittlerweile schon vertraut. Er kam in allen Briefen vor, die ihr Papi ihr geschrieben hatte.
Schüchtern lächelnd streckte sie ihr die Hand entgegen. »Fein, dass ich dich auch kennenlerne«, meinte sie zutraulich. »Ich dachte, du würdest erst nächstes Jahr Urlaub bekommen, Papi«, wandte sie sich an ihren Vater.
»Ich bin geschäftlich hier, und da mussten wir dich doch besuchen«, meinte er.
»Das will ich meinen«, rief Susanne. »Bis zum nächsten Jahr ist es sowieso noch so lange. Jetzt muss Tante Isi aber Ines auch kennenlernen.«
Denise brauchte nur einen langen Blick auf Ines Jakobus zu werfen, um zu wissen, dass Dr. Berkin eine gute Wahl getroffen hatte. Allerdings fürchtete sie gleich, dass sie Susanne mitnehmen wollten. Daran schien das Kind jedoch nicht zu denken.
»Dann werde ich euch jetzt gleich mit den anderen Kindern bekannt machen«, schlug Susanne vor. »Jetzt sind wir schon sieben und wenn wir Sascha und Andrea dazurechnen, neun. Wir sind froh, dass wir Frau Trenk und Edith haben. Wie lange bleibt ihr?«, sprudelte es über ihre Lippen.
»Darüber sprechen wir später«, meinte Günther Berkin ausweichend.
Das Auto war Dominik nicht mehr wichtig. Er ging zu seiner Mutter.
»Susis Vater ist gekommen«, stellte er sinnend fest, »und eine Frau hat er auch mitgebracht. Wollen sie Susi etwa holen?«
»Du bist doch ein vernünftiger Junge, Nick«, begann sie, aber er fiel ihr gleich ins Wort: »Immer wenn du so anfängst, willst du, dass ich etwas einsehe, was ich gar nicht gern möchte, Mami.«
»Aber Susi hat jetzt ihren Vati, und sie hat ihn doch auch lieb. Es wäre doch zu verstehen, wenn er sie mit sich nehmen will.«
Dominik schob die Unterlippe vor. »Ich will nicht, dass wir Kinder aufnehmen, die wir dann wieder hergeben müssen«, brummte er. »Wir haben uns dann alle schon lieb und sollen wieder auseinandergerissen werden. Daran kann ich mich nicht gewöhnen.«
Zum Glück kamen jetzt Sascha und Andrea herbei und brachten Dominik auf andere Gedanken.
»Wo steckt ihr denn? Wir haben euch schon so lange gesucht«, riefen sie. »Papi verdreht schon die Augen, weil die Frau Bürgermeister so auf ihn einredet. Hilf ihm doch mal ein bisschen, Tante Isi.«
Man passt sowieso schon viel zu sehr auf uns auf, dachte Denise. So gern sie auch mit Alexander von Schoenecker beisammen war, inmitten der Dorfbevölkerung vermied sie es doch lieber.
Aber beim Essen saßen sie dann doch nebeneinander, und Alexander stieß einen erleichterten Seufzer aus.
»Ich dachte schon, ich würde dich heute gar nicht mehr zu Gesicht bekommen«, raunte er ihr zu. Unauffällig streifte er ihre Hand, aber schon diese flüchtige Berührung ließ das Blut schneller durch ihre Adern fließen.
Die Kinder hatten einen Tisch für sich. Da ging es lebhaft zu. Nur Susanne war heute stiller als sonst. Immer wieder blickte sie zu ihrem Papi und Ines hinüber.
Sie war nett, sie gefiel ihr, es kam ihr nur ein bisschen komisch vor, dass ihr Papi sie mitgebracht hatte.
»Ob er sie heiraten will?«, raunte sie Dominik zu. Der war durch das Essen abgelenkt und fragte:
»Wer? Wen?«
»Papi – die Ines«, erwiderte sie. »Wie gefällt sie dir?«
»Wenn sie dich mitnehmen wollen, gefällt sie mir nicht«, erwiderte Dominik ziemlich laut. Seine Mutter drehte sich zu ihm um und warf ihm einen mahnenden Blick zu.
Aber auch Ines hatte seine Bemerkung vernommen und wusste, dass diese sie betraf, denn Susanne blickte zu ihr hinüber.
Susanne senkte den Blick. »Ich weiß nicht«, murmelte sie. »Mir gefällt sie eigentlich, auch wenn sie mich mitnehmen wollen.«
»Sie haben uns den ganzen schönen Tag verdorben«, erklärte Dominik mürrisch.
»Nein, das haben sie nicht«, protestierte Susanne. »Du würdest dich auch freuen, wenn dein Papi dich besucht.«
»Ich habe keinen und will keinen haben«, trumpfte Dominik auf. »Ich habe Onkel Alexander, und das genügt mir.«
Denise hatte Dominiks heftige Bemerkung vernommen, aber auch Alexander hatte sie gehört. Er schüttelte verneinend den Kopf, als sie zu den Kindern gehen wollte, und schon hatte er sich erhoben und ging zu ihnen.
»Na, worum geht es denn, ihr beiden?«, fragte er beiläufig.
»Um den Papi«, erwiderte Susanne rasch. »Ich freue mich, dass er gekommen ist, und Nick freut sich nicht.«
»Das verstehst du sicher falsch, bestimmt freut er sich auch.«
»Nein, ich freue mich nicht«, sagte Dominik trotzig.
»Er will keinen Papi haben«, erklärte Susanne aggressiv. »Ihm genügt es, dass er dich hat.«
Alexander wusste nicht recht, ob es ihn freuen oder traurig stimmen sollte. Ein Problem warf sich auf jeden Fall für die Zukunft auf. Ein Problem, das bewältigt werden musste, wenn er und Denise an ein gemeinsames Leben denken wollten.
Dominik äußerte sich nicht. Er lief einfach weg, und Susanne sah ihm verdutzt nach.
»Sonst ist er doch so gescheit, Onkel Alexander«, stellte sie fest. »Was soll ich nur tun, dass er wieder lieb ist?«
»Gar nichts einstweilen«, meinte er. »Er wird schon einsehen, dass er diesmal nicht im Recht ist. Geh nur zu deinem Papi. Er ist doch zu dir gekommen.«
»Tante Isi versteht das doch auch?«, fragte sie ängstlich.
»Natürlich versteht sie dich, Susi.«
*
Indessen hatten sich Sascha und Andrea zu Dominik gestellt. »Hast du dich mit Susi gestritten?«, erkundigte sich Andrea teilnahmsvoll.
»Nein, wir haben nur nicht die gleiche Meinung«, erwiderte Dominik. »Soll sie doch mit ihrem Papi gehen, wenn sie meint, dass es in Johannesburg schöner ist als hier.«
»Das meint sie bestimmt nicht«, versicherte Andrea, »aber jedes Kind will doch dort sein, wo es einen Papi oder eine Mami hat.«
Sie hatte mehr Verständnis dafür, denn bis vor Kurzem hatten sie auch nicht so recht gewusst, wohin sie gehörten.
»Ich glaube, sie hat noch nicht mal was dagegen, wenn ihr Papi die Ines heiratet«, sagte Dominik ungehalten.
»Bist du etwa böse, dass Dr. Berkin nicht deine Mami heiraten will?«, fragte nun Sascha.
Dominik sah ihn entgeistert an. »Nein, natürlich nicht«, erwiderte er aufgeregt.
»Na, siehst du. Dann brauchst du doch auch nicht böse zu sein, wenn er eine andere Frau heiraten will. Und dann ist es doch ganz klar, dass sie Susi mitnehmen wollen.«
»Ich bin ja nicht mehr böse«, gestand Dominik kleinlaut, »ich bin froh, dass ich euch habe.«
»Und wir bleiben ja immer hier«, versicherte Andrea. »Wenn wir auch in Schoeneich wohnen, wir können uns doch jeden Tag sehen. Du darfst es Susi nicht so schwer machen, sonst geht sie traurig fort.«
Für sie stand nun schon fast fest, dass Susi sie verlassen würde, und darüber sprach eben Günther Berkin mit seiner kleinen Tochter.
*
»So recht zu freuen scheinst du dich gar nicht, Susi, dass wir gekommen sind«, hatte Günther Berkin das Gespräch eröffnet.
»Doch, schon, ich freue mich sehr. Es ist etwas anderes, was mich traurig macht«, hatte sie darauf erwidert.
»Was macht dich traurig?«
»Dass Nick nicht versteht, wie sehr ich mich freue«, erwiderte sie. »Ich kann doch nichts dafür. Ich habe dich sehr vermisst, Papi, wenn es auch schön ist in Sophienlust. Ich habe dich doch nur so ganz kurze Zeit gehabt bisher.«
Es war seine Schuld gewesen, aber es rührte ihn unsagbar, dass sie es ihm nicht nachtrug und ihm ihr kleines Herz schenkte.
»Ich hatte auch große Sehnsucht nach dir, Susikind. Und ich möchte so gern, dass wir uns nicht mehr trennen müssen. Ich habe ein hübsches Haus in Johannesburg gefunden. Ines hat mir dabei geholfen, und sie würde auch sehr gern«, er unterbrach sich, weil er nicht wusste, wie er es ihr sagen sollte.
»Was möchte sie sehr gern?«, fragte Susanne sinnend.
»Ich möchte Ines heiraten, damit du eine Mami hast«, entgegnete er.
»Nur damit ich eine Mami habe?«, fragte sie beklommen. »Nicht auch, weil du sie lieb hast?«
Von dem Kind vor eine solche Gewissensfrage gestellt, sah sich Günther Berkin arg in Bedrängnis gebracht. Ines war ein feiner Mensch. Er wusste, dass sie ihn niemals enttäuschen würde. Aber so tiefe Gefühle, wie ein Mann wohl empfinden sollte in einer solchen Situation, wollte er gar nicht mehr empfinden. Alle Liebe wollte er Susanne geben, seinem Kind, das diese Liebe fünf Jahre hatte entbehren müssen. Sein Schuldbewusstsein gegenüber seinem Kind war stärker als seine eigenen Erwartungen von einer Ehe.
»Du musst sie doch lieb haben, wenn sie meine Mami werden soll«, drängte Susanne. »Wir müssen uns dann alle lieb haben. Tante Claudia hat neulich zu Tante Isi gesagt, dass man eine Ehe gar nicht erst beginnen sollte, wenn man nicht genau weiß, dass man sich sehr liebt.«
Günther Berkin starrte seine kleine Tochter an. Ein fünfjähriges Kind erteilte ihm eine Lektion in Sachen Liebe und Ehe.
»Natürlich werde ich Ines lieb haben«, erwiderte er gedankenverloren. »Sie ist ein Mensch, der es verdient. Würdest du mitkommen, mein Kleines?«, fragte er beklommen.
»Wenn du ein Haus hast und eine Frau und ich eine Mami – o ja, ich würde schon ganz gern mitkommen, wenn Nick und Tante Isi mir nicht böse sind. Sie waren alle schrecklich lieb zu mir, Papi, du musst das verstehen.«
»Ich verstehe es ja«, erwiderte er leise und streichelte behutsam ihre Wange. »Ich wollte dir nur die Entscheidung überlassen, mein Kleines. Wenn du lieber doch bis zum nächsten Jahr bleiben willst, werde ich es akzeptieren.«
Sie dachte nach. »Nein, ich glaube, ich würde dann doch lieber gleich mitkommen, Papi.«
»Dann ist ja alles gut«, erwiderte er erleichtert. »Jetzt sagen wir es Ines – oder was meinst du?«
»Ich möchte gern mal allein mit ihr reden«, erklärte Susanne zu seiner Überraschung.
*
Nun stand es fest. Susanne würde sie schon in ein paar Tagen verlassen, wenn Dr. Berkin seine geschäftlichen Angelegenheiten erledigt hatte.
Dominik bemühte sich, eine gleichmütige Miene zu zeigen. Leicht wurde es ihm nicht, denn er dachte an die Jahre, die er mit Susanne im Haus Bernadette verbracht hatte.
Roli war es, die ihm das nötige Verständnis beibrachte. »Was meinst du, wie sehr wir dich alle beneidet haben, wenn deine Mami kam und dich besuchte«, sagte sie. »Du hast immer davon geredet, dass sie dich eines Tages holen würde. Das konnten wir anderen nie. Und mich haben sie dann auch noch in ein Waisenhaus gesteckt. Das war schrecklich. Du glaubst gar nicht, wie oft ich gedacht habe: Der Nick wird eines Tages von seiner Mami abgeholt und kann bei ihr bleiben. Aber ich wusste doch nicht, dass Susi einen Vater hat, der sie auch gern bei sich haben möchte. Es ist das Schönste, Nick, wenn man wenigstens einen Menschen ganz für sich allein hat.«
Nick dachte nach, und er kam zu der Überlegung, dass Roli, Mario und Marlies eigentlich ganz traurig dran waren, weil sie überhaupt keine Angehörigen mehr hatten. Keine Mami, keinen Papi und auch keine Großeltern.
Sascha und Andrea hatten ihren Vater. Sie hatten auch eine Großmutter, wenngleich diese Dominik nicht so ganz geheuer war. Robby und Petra hatten eine liebe Mutter. Und er selbst? Er hatte Mami, Tante Claudia und Onkel Lutz, eine liebe Omi und nicht zuletzt Onkel Alexander, Sascha und Andrea. Dazu noch Justus, Urban, Lena und Magda und wen man alles sonst noch einbeziehen wollte. Die Ponies und Sentas junge Hunde. Die schönen Pferde und Kühe und ganz Sophienlust, das ihm gehörte, wie Mami ihm immer wieder versicherte.
Wenn er einmal groß war, würde er noch viel reicher sein als Hubert von Wellentin, dieser eigenartige Großvater! Das hatte ihm Omi gestern erst gesagt.
Ungerecht durfte man nie sein, man musste Verständnis für den anderen haben. Und nun sah er den Zeitpunkt für gekommen, sich ganz mit Susanne auszusöhnen.
Er ging in ihr Zimmer, es war ganz dunkel.
»Schläfst du schon, Susi?«, raunte er.
»Nein, ich kann nicht schlafen«, kam die Antwort. »Du warst böse mit mir, Nick. Das tut mir weh.«
»Du darfst nicht böse sein. Ich habe über alles nachgedacht«, wisperte er. »Wenn wir uns lieb behalten, können keine Grenzen trennen. Weißt du, wie Mami uns das mal gesagt hat?«
»Ich weiß es noch ganz genau. Ich kann doch nichts dafür, dass Johannesburg so schrecklich weit weg liegt, Nick. Aber dort hat Papi eine so gute Stellung, und ein Haus hat er auch schon für uns. Und Ines ist doch wirklich lieb. Du hattest deine Mami immer, Nick. Ines hat gesagt, dass das für ein Kind viel wichtiger ist als alles andere. Sie weiß es, weil sie auch keine Mutter gehabt hat. Ich werde dich schon sehr vermissen, Nick, aber wir können uns ja schreiben.«
Täppisch streichelte Nick ihre Hände, und so nahmen sie eigentlich schon in dieser Stunde voneinander Abschied.
Tränen flossen erst, als Dr. Berkin und Ines eine Woche später kamen, um Susanne zu holen.
Ob sie Freunde fürs Leben bleiben würden? Es stand wohl außer Frage, denn Dr. Berkin würde es Denise niemals vergessen, was sie für sein Kind und auch für ihn getan hatte.
*
Irene von Wellentin schickte sich an, ihren täglichen Besuch in Sophienlust zu machen, als der Wagen ihres Mannes vorfuhr.
Von Scheidung wurde einstweilen nicht mehr gesprochen, obgleich sie fest entschlossen dazu gewesen war. Er nahm das in seiner Selbstüberheblichkeit jedoch als Zeichen ihrer Nachgiebigkeit und wollte sie wieder ganz auf seine Seite bringen.
Sein Ansehen hatte unter der Trennung gelitten. Er hatte erkennen müssen, dass man sich auf die Seite seiner Frau geschlagen hatte, und das wurmte ihn maßlos.
»Ich hoffe, du wirst eine Stunde Zeit für mich haben«, erklärte er unwillig, als sie keine Anstalten machte, sich in ein Gespräch mit ihm einzulassen.
»Meine Zeit ist kostbar geworden«, erwiderte sie kühl.
»Ja, ja, ich weiß, du musst sie mit der Betreuung von diesen Kindern in Sophienlust verbringen«, meinte er sarkastisch. »Mach dich doch nicht lächerlich, Irene. Damit polierst du unseren angeknacksten Ruf auch nicht mehr auf.«
»Ich tue es, weil es mir Freude macht und weil ich endlich zu etwas nützlich bin.«
Er runzelte unwillig die Stirn. »So kann es doch nicht weitergehen«, brummte er. »Du lebst hier, ich in der Stadt. Ich bin gekommen, um mit dir über eine vernünftigte Lösung zu diskutieren.«
»Was verstehst du schon unter einer vernünftigen Lösung. Du wirst mir Bedingungen auferlegen, die ich nicht erfüllen kann und will. Ich fühle mich ganz wohl so.«
Er sah sie irritiert an. Eigentlich hatte er gehofft, dass sie mit fliegenden Fahnen zu ihm zurückkehren würde, wenn er den ersten Schritt tat.
»Ich muss schon sagen, du hast dich sehr verändert«, fuhr er fort. »Musste es sein, dass du dich sogar eines Arbeiterkindes annimmst? Die Sorge, welche Kinder nach Sophienlust kommen, könntest du doch zumindest der Initiatorin dieses seltsamen Unternehmens überlassen.«
»Du vergisst wohl, dass die eigentliche Initiatorin deine Mutter war, Hubert«, erklärte sie gelassen. »Denise führt nur aus, was sie gewollt hat.«
»Aber sie scheut sich nicht, schon wenige Monate nach dem Tode dieser großherzigen Frau, der sie alles zu verdanken hat, auf dem Erntefest mit Schoenecker zu tanzen. Ich muss schon sagen, dass ich das recht eigenartig finde.«
Nun geriet er doch wieder in sein altes Fahrwasser, und Irene von Wellentin setzte eine abweisende Miene auf.
»Du hast den wenigsten Grund, Denise anzugreifen«, erklärte sie eisig. »Wenn sie mir nicht zugeredet hätte, wäre die Scheidung längst eingereicht. Ich dulde nicht, dass du sie beleidigst. Ich habe sie kennengelernt und bereue tief, dass ich ihr nicht sofort die Hand geboten habe. Ich bin durch sie und Dominik auf dem Wege, ein glücklicher Mensch zu werden. Das lasse ich mir nicht zerstören. Und nun möchte ich fahren. Dr. Baumgarten kommt heute und untersucht die Kinder.«
»Irene, noch auf ein Wort, bitte. Glaubst du, dass du dem Ruf des Heimes einen Gefallen tust, wenn du ein Kind aus asozialen Verhältnissen, wie es Marlies Nickel ist, dort unterbringst?«
Sie wich seinem Blick nicht aus. »Was meinst du mit asozialen Verhältnissen? Dass Nickel nicht genug verdient hat, um seine Familie anständig zu ernähren, ist doch auch deine Schuld. Die Kinder können nichts dafür, wenn ihre Eltern ihnen nicht mehr bieten können.«
»Jeder wird nach Leistung bezahlt«, knurrte er. »Mich wundert, dass ihr nicht gleich die ganze Familie in Sophienlust eingenistet habt«, höhnte er.
»Denise hat gewisse Richtlinien, außerdem kommen die anderen Nickel-Kinder schon altersmäßig nicht mehr infrage.«
Er zuckte mit den Schultern. Das Thema Nickel war ihm nicht sympathisch. Er hatte schon von anderer Seite deswegen Vorwürfe vernehmen müssen.
»Ich wollte dir vorschlagen, Irene, dass wir ein paar Wochen gemeinsam verreisen«, lenkte er ab.
»Ich war lange genug verreist. Du solltest dich lieber mehr um die Fabrik kümmern. Ich bin daran interessiert, dass mein Vermögen erhalten bleibt, wenn ich es schon in der Firma lasse.«
»Damit du es eines Tages auch dem Kinderheim Sophienlust hinterlassen kannst?«, fragte er anzüglich.
»Dort wäre es besser angelegt«, erwiderte sie unberührt. »Ich will dir nicht den Stuhl vor die Tür setzen. Du kannst wiederkommen, wenn du anderen Sinnes geworden bist. Aber nur dann!«
Und damit sah er sich verabschiedet.
*
Der ärztlichen Untersuchung, die mit einer Grippeschutzimpfung verbunden war, sahen die Kinder mit gemischten Gefühlen entgegen. Aber Dr. Baumgarten brachte seine Frau und seine beiden Söhne Friedel und Axel mit, die sich langsam mit dem Kinderheim Sophienlust vertraut machen sollten, denn auch sie sollten hier bald für einige Wochen sein, wenn Barbara Baumgarten ihr drittes Kind zur Welt brachte.
Dr. Werner Baumgarten verstand es, mit Kindern umzugehen. Er war ein guter Arzt, ein Universalgenie, wie Alexander von Schoenecker den Mann seiner Cousine Barbara bezeichnete. Wald- und Wiesendoktor wurde er von Hubert von Wellentin allerdings genannt.
Ihm machte das nichts aus, wenn es ihm zu Ohren kam. Er hatte Humor, und von Hubert von Wellentin hielt er ohnehin nichts. Er wunderte sich nur über Irene von Wellentin, die sich so energisch gegen ihren Mann gestellt hatte.
Sie war es jetzt auch, die die Kinder beschwichtigte und dem Arzt gemeinsam mit Claudia zur Hand ging.
Barbara nutzte die Gelegenheit, mit Denise zu sprechen.
»Wollte Xander nicht auch Sascha und Andrea bringen?«, fragte Barbara lächelnd. »Für ihn sind die Stunden in Sophienlust doch die schönsten seines Lebens.«
Glühende Röte schoss Denise in die Wangen. Sie sah sich bereits durchschaut, und dabei dachte sie doch, dass sie ihre Gefühle für Alexander von Schoenecker so gut zu verbergen verstünde.
»Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen, Isi«, meinte Barbara. »Ich weiß längst, dass Xander Sie liebt. Und zum ersten Mal in seinem Leben ganz bewusst liebt. Sybille hat ihn betört, aber Sie haben alle die Gefühle in ihm geweckt, die er ihr nicht geben konnte. Er ist es wert, geliebt zu werden, Isi. Ich sehe keinen Grund, dass Sie sich und Ihre Gefühle vor der Welt verstecken sollten.«
»Grund?«, fragte Denise gedankenvoll. »Ist dies hier kein Grund? Ich habe doch erst begonnen und kann nicht alles hinwerfen. Und dann sind da auch die Kinder. Seine und Dominik. Und nicht zu vergessen die Baronin Klee.«
»Nun, die dürfen Sie ruhig Xander überlassen«, meinte Barbara gelassen. »Sie wird sich nicht mehr einmischen.«
Denise sah die junge hübsche Frau gedankenvoll an. »Ja, ich liebe Alexander«, gab sie zu. »Warum soll ich es leugnen, da Sie es doch ohnehin wissen, aber wir wissen auch, dass wir uns gedulden müssen.«
»Schön, zugegeben, aber wartet nicht gar zu lange. Denkt auch an eure Kinder. Für diese kleinen Trabanten hier wird sich dann schon jemand finden, der das Begonnene fortsetzt.«
Sie schob ihre Hand unter Denises Arm und ging mit ihr weiter in den Park hinein.
»Ja, es ist ein Paradies«, stellte sie fest. »Schoeneich kann damit nicht Schritt halten.«
»Oh, ich finde es dort auch sehr hübsch«, stellte Denise mit einem flüchtigen Lächeln fest.
»Das höre ich gern, und jetzt, nachdem es renoviert ist, ist auch Sybilles Geist aus seinen Räumen verbannt. Zugleich mit ihrem Bild. Das hat Sie doch belastet, Isi.«
Es war keine Frage, sondern eine ganz schlichte Feststellung. Denise blickte zu Boden. Buntes Laub bedeckte die Parkwege. Es raschelte unter jedem Schritt. Herbst war es geworden, und der Winter stand vor der Tür.
»Sie werden mich vielleicht nicht verstehen, Babs«, erklärte sie verhalten, »aber ich fühle mich Sophie von Wellentin so zu Dank verpflichtet, dass ich meine persönlichen Wünsche zurückstellen muss.«
Barbar blickte bekümmert drein. Da waren zwei Menschen, die wie füreinander geschaffen waren. Aber selbstlos auf ein Glück verzichten wollten, das ihnen doch die schönste Erfüllung bringen konnte. Aber sie spürte auch, dass sie jetzt nicht mehr dazu sagen durfte.
Denise wollte ihren Weg gehen, und Alexander respektierte dies. »Ich bin so beruhigt, meine beiden Rangen hier so gut untergebracht zu wissen, wenn sich unser Nesthäkchen anmeldet«, lenkte sie ab. »Aber da kommt ja Alexander.«
Er hatte sie bereits gesucht. Denise merkte sofort, dass er niedergeschlagen war, und auch Barbara entging es nicht.
»Ärger gehabt?«, fragte sie ihn.
»Reden wir nicht davon«, brummte er. »Wie geht es dir, Babs?«
»Blendend, wie du siehst. Ich wünschte, aus deinem Munde das Gleiche zu hören.«
»Und wie geht es Ihnen, Denise?«, fragte er dann leise.
»Sie hat Angst vor der Spritze«, lächelte Barbara, »aber tut euch keinen Zwang an. Vor mir braucht ihr euch nicht zu siezen.«
Da kam jedoch Andrea schon angesprungen. »Schon vorbei mit dem Impfen«, schmetterte sie. »Tag, Tante Baby, guten Tag, Tante Isi.«
»Wo steckt Sascha?«, fragte Barbara.
»Hat Papi es noch nicht gesagt? Großmama hat ihn von der Schule abgeholt. Nach Schoeneich kommt sie aber nicht. Sie bleibt in der Stadt. Na, erbaut war Sascha nicht, aber sie wollte mit ihm seinen Geburtstag noch nachfeiern, hat sie gesagt.«
Deswegen war Alexanders Miene also so düster.
»Einfach so ohne Ankündigung?«, brummte Barbara. »Das finde ich aber schon ein bisschen komisch.«
»Ich sollte natürlich auch in der Stadt bleiben«, erzählte Andrea unbekümmert weiter, »aber ich habe gleich gesagt, dass ich keine Lust habe. Sascha hat doch sonst so eine große Klappe. Aber vor Großmama hat er scheinbar richtig Angst.«
»Er will sie nur nicht verletzen«, lenkte Denise ein. Sie erträgt es nicht, dass er sich bei seinem Vater wohlfühlt, dachte sie.
»Nun bist du an der Reihe, Mami«, kam Dominik angestürmt. »Wir hatten gar keine Angst, nicht wahr, Andrea? Nur Marlies hat ein bisschen geweint.«
Denise durfte den Kindern unmöglich zeigen, dass sie ängstlich war. Aber nach ihrem schweren Sturz hatte sie so viele schmerzhafte Spritzen bekommen, dass sie einfach Furcht hatte.
Doch dann war alles so schnell vorüber, dass sie nur staunen konnte.
»Papi ist eben doch der beste Doktor«, schrie Frieder.
»Eine Stimme hat der Bengel, furchtbar«, stöhnte Barbara. »Nimm dich zusammen, Frieder, sonst darfst du nicht nach Sophienlust.«
»Ich möchte aber hin«, säuselte er. »Ich schreie ja nicht immer. Kann ich nicht gleich hierbleiben, Mami?«
»Da siehst du es«, sagte Barbara zu ihrem Mann. »Denise muss einen Zauber an sich haben, dass kein Kind mehr weg mag.«
Sie sah dabei Alexander an. Ihn hatte sie jedenfalls restlos verzaubert.
*
»Du darfst dir wünschen, was du willst, Sascha«, sagte Baronin Klees immer wieder zu dem Jungen.
»Ich wünsche mir eigentlich gar nichts«, erwiderte Sascha scheu. »Ich habe doch alles.«
»Hast du denn so viele Geschenke bekommen?«, fragte sie im beleidigten Ton.
»Nein, viel eigentlich nicht, aber schöne Sachen. Von Papi einen Sattel …«
»So ein großer Junge sagt doch nicht mehr Papi«, fiel sie ihm ins Wort. »Früher hast du es doch auch nicht gesagt«, meinte sie vorwurfsvoll.
»Früher haben wir uns auch lange nicht so gut verstanden«, erwiderte er. »Da war ich ja immer bei dir oder im Internat.«
»Aber als deine liebe Mutti noch lebte, warst du daheim. War es da nicht schöner?«
»Warum musst du mich immer wieder daran erinnern, Großmama?«, fragte er. »Ich wüsste es doch gar nicht mehr, wenn du nicht dauernd von ihr gesprochen hättest.«
»Einer muss doch die Erinnerung an eure Mutter aufrechterhalten, die euch so sehr geliebt hat«, sagte die Baronin gereizt. »Euer Vater tut das ja nicht.«
»Und Marie sagt, dass sich unsere Mutter gar nicht um uns gekümmert hat«, erwiderte er trotzig. »Marie muss es ja wissen. Sie war immer da und hat auf uns aufgepasst.«
»Es wird also alles getan, um die Erinnerung an eure Mutter in euch zu töten«, stieß sie heftig hervor.
»So ist es doch auch nicht«, meinte Sascha. »Es wird nur nicht dauernd über sie gesprochen. Tante Isi erzählt Nick ja auch nicht dauernd was von seinem Vater.«
»Tante Isi«, fauchte die Baronin wütend. »Ich finde es ungeheuerlich, dass euer Vater von euch verlangt, dass ihr sie so nennt, diese billige kleine Tänzerin.«
Sascha starrte sie bestürzt an. »Das darfst du nicht sagen«, begehrte er auf. »Tante Isi ist eine wunderbare Frau. Der Pfarrer hat es sogar am Erntedanktag von der Kanzel gesagt, und alle anderen Leute sagen es auch. Ich will nicht, dass du so über sie redest, Großmama. Sie hat so viel Gutes getan. Du bist ungerecht. Ich will gar nichts mehr von dir geschenkt haben. Ich möchte nach Hause.«
»Wie du willst«, rief sie zornig. »Ich habe ja geahnt, dass es so kommen würde. Eines Tages wird dein Vater sie noch heiraten.«
Beinahe hätte Sascha gesagt, dass ihn das nur freuen würde, aber im letzten Augenblick wurde ihm bewusst, dass er damit alles nur noch schlimmer machte, und er schwieg.
Die Baronin Klees aber überlegte krampfhaft, was sie unternehmen könnte, um Alexander zu treffen. Es gärte und brodelte in ihr. Sie ertrug den Gedanken einfach nicht, dass die Kinder glücklich und zufrieden waren. Sie hatte immer gehofft, dass sie von sich aus den Wunsch äußern würden, wieder zu ihr zu kommen. Und nun sah sie sich enttäuscht und fühlte sich gedemütigt.
»Ich weiß gar nicht, was du willst, Großmama. Papi hat dir doch Muttis Bild geschickt. Das wolltest du doch haben. Er hat dir doch jeden Gefallen getan.«
Sie war zu verbittert, um eine passende Erwiderung zu finden. Alexander vor seinem Sohn zu erniedrigen, wagte sie doch nicht. Aber sie wollte nicht zusehen, dass alles nach Alexanders Wunsch ging. Sie hatte ihm nicht vergessen, was er bei ihrer letzten Unterredung über Sybille gesagt hatte. Sie wollte aber auch nicht wahrhaben, dass dies die reine Wahrheit gewesen war.
»Ich werde dich in ein Taxi setzen, dann kannst du heimfahren«, sagte sie kühl.
»Ich will aber nicht heim. Ich will nach Sophienlust. Da sind sie heute alle«, sagte er vorwurfsvoll.
»Ach, deswegen willst du nicht bei mir sein«, fuhr sie ihn an. »Nein, du fährst nach Schoeneich, wenn du schon nicht bei mir bleiben willst.«
»Ich habe doch gar nichts gesagt, dass ich nicht bei dir bleiben will, Großmama«, meinte Sascha kleinlaut. »Ich habe doch nur gesagt, dass du nicht dauernd von Mutti sprechen sollst. Papi wollte mich doch abholen.«
»Mir ist aber die Lust vergangen, mit einem so ungezogenen Kind zusammen zu sein«, erklärte sie gereizt.
Sascha zuckte die Schultern. Man konnte es ihr einfach nicht recht machen. Was er auch sagte, immer war es verkehrt. Jetzt hoffte er nur noch, dass sie ihn allein fahren lassen würde, damit er dann unterwegs aussteigen konnte, um doch noch nach Sophienlust zu kommen. Aber sie hatte es sich scheinbar doch anders überlegt, denn sie fuhr mit nach Schoeneich. Dort angekommen, verabschiedete sie sich nur kühl von ihm, um gleich darauf umzukehren.
Trübsinnig starrte Sascha vor sich hin. Das hatte er nun davon. Hätte er es doch gleich wie Andrea gemacht und ihr gesagt, dass er nicht bei ihr bleiben wolle! Nun stand er da, und ein Geschenk hatte er auch nicht bekommen. Aber das tat ihm nicht weh. Es schmerzte ihn nur, dass sie so böse von Tante Isi gesprochen hatte und dass er nun allein war.
Offenbar hatte man gar nicht bemerkt, dass er gekommen war, denn niemand kümmerte sich um ihn. Aber sie hatte das Taxi ja auch nicht bis zum Haus fahren lassen. Das letzte Stück musste er durch den Park noch zu Fuß gehen.
Plötzlich vernahm Sascha Stimmen. Sie kamen aus dem Verwalterhaus. Marie schien ihrem alten Freund Arnold einen Besuch zu machen.
»Ich glaube, dem Herrn ist schon lange ein Licht aufgegangen«, sagte sie eben laut, denn Arnold war schwerhörig. »Er hat bestimmt gewusst, dass sie ein Luder gewesen ist, er hat es sich nur nicht anmerken lassen. Ich wünsche ihm so, dass er eine gute Frau bekommt und die Kinder eine richtige Mutter. Aber die Einzige, die gut genug wäre, das wäre die Frau von Wellentin, doch die lebt nur für ihr Kinderheim. Ich bin nur froh, dass das Bild endlich fort ist. Ich konnte es schon nicht mehr sehen.«
Sie sprach über seine Mutter. Sascha hielt den Atem an. Luder hatte sie gesagt. Das war ein böses Wort. Wie erstarrt stand der Junge. Die Großmama hatte ihm doch nur immer die schönsten Dinge von seiner Mutter erzählt. Ein Engel sollte sie gewesen sein.
»Ein Satansweib war sie«, sagte da der schwerhörige Arnold laut. »Wie frech sie war, als ich sie damals mit dem Wellentin ertappte. Ich weiß es noch genau. Aber jetzt wird der Herr schon wissen, was er tut.«
Sascha schlich sich davon. Zwei Welten waren heute für ihn in Trümmer gefallen. Die eine war schon früher ins Wanken geraten, als er begann, seine Großmama und ihr Intrigenspiel zu durchschauen. Aber das Bildnis seiner Mutter hatte doch noch rein und unberührt in seinem Herzen gelebt. Er hatte sie so gesehen, wie man es ihm erzählt hatte. So, wie ihr Bild gewesen war. Aber jetzt konnte er nicht einmal mehr dieses Bild anschauen und danach suchen, ob Marie und Arnold recht hatten.
Niemand durfte ihn sehen. Niemand durfte wissen, was er gehört hatte. Er wollte nach Sophienlust laufen, um die anderen zu treffen und mit Tante Isi zu sprechen. Mit ihr konnte man über alles reden.
Sascha war todunglücklich und lief blindlings drauflos. Weiter und immer weiter, und weil er nicht dachte und immer nur Maries und Arnolds Stimmen in seinen Ohren hörte, verlor er völlig die Orientierung.
*
Irene von Wellentin hatte sich gleichzeitg mit den Baumgartens verabschiedet. Taktvoll hatte sie sich zurückgezogen, um Alexander von Schoenecker noch Gelegenheit zu geben, allein mit Denise zu sein. Sie spürte, dass sich zwischen den beiden Fäden spannen, und sie war bereits so geläutert, dass sie es als einen Ausgleich für das schwere Schicksal dieser beiden Menschen nahm, die schon so viel Leid durchlebt hatten. Sie wünschte ihnen von Herzen alles Glück, das sie zuvor nicht gefunden hatten.
Immer wieder überhäufte sie sich mit bitteren Vorwürfen. Wie schön hätte alles werden können, wenn sie Dietmar nicht daran gehindert hätten, Denise Montand zu heiraten. Dass er es dennoch getan hatte, war für sie nun zum reinsten Glück geworden. Sie liebte Dominik, diesen frischen, lebhaften Jungen, der es ihr so leicht gemacht hatte, sich mit allem zu versöhnen. Sie brachte Denise neben der Hochachtung auch die wärmsten Gefühle entgegen.
Wie schwer es ihr einmal gefallen war, den ersten Schritt zu tun, hatte man sie rasch vergessen lassen. Ihr Leben hatte einen Sinn bekommen. Sie war glücklich, auch das Ihre beitragen zu können zum Wohle der Kinder von Sophienlust, die dort eine Heimat gefunden hatten.
Noch ganz von dem Gedanken beseelt, wie harmonisch dieser Nachmittag wieder gewesen war, geriet sie in quälende Bedrängnis, als gleich nach ihrer Heimkehr die Baronin Klees sich bei ihr melden ließ.
»Guten Abend, meine liebe Frau Wellentin«, sagte die Baronin im süßlichen Tonfall. »Wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich musste Ihnen doch wenigstens einen Besuch machen, da ich schon einmal in der Nähe bin.«
»Sollten Sie nicht eigentlich mit Sascha in der Stadt sein?«, fragte Irene von Wellentin erregt. »Ich hörte doch so etwas in Sophienlust.«
»Sie waren in Sophienlust?«, fragte Baronin Klees bestürzt.
»Ja, ich bin jeden Tag dort. Es macht mir große Freude«, erwiderte Irene von Wellentin ruhig. »Es hat sich noch nicht zu Ihnen herumgesprochen?« Sie konnte sich diese kleine Anzüglichkeit nicht verkneifen.
»Nein, ich bin allerdings sehr überrascht«, sagte die Baronin empört. »Ich wollte Ihnen gerade mein Herz ausschütten, denn ich bin von Sascha tief enttäuscht. Er scheint mir sehr unter den Einfluss dieser Tänzerin geraten zu sein. Und mein Schwiegersohn scheint es zu billigen. Aber ich sehe schon, dass ich bei Ihnen kaum Verständnis finden werde.«
»Wenn Sie Beschwerden gegen Denise vorbringen wollen, muss ich Ihnen recht geben«, sagte Irene von Wellentin kühl. »Ich habe meine Schwiegertochter schätzengelernt und verbringe die glücklichsten Tage meines Lebens in Sophienlust, so wie es dort jetzt ist. Aber vielleicht finden Sie bei meinem Mann größeres Verständnis für Ihr Anliegen«, fügte sie spöttisch hinzu. »Allerdings müssen Sie sich dazu in die Stadt bemühen. Wir leben nämlich getrennt.«
Die Baronin starrte ihr Gegenüber entgeistert an.
»Ich kann mich wirklich nur noch wundern«, sagte sie spitz. »Dann würden Sie es wohl sogar billigen, wenn mein Schwiegersohn diese Person heiratet?«
Irene von Wellentin richtete sich steif auf. »Ich möchte Sie ersuchen, meine Schwiegertochter nicht als Person zu bezeichnen.«
»Haben Sie das selbst nicht auch getan?«, fragte Baronin Klees höhnisch.
»Wenn ich es getan habe, bedaure ich es tief. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Allerdings möchte ich gern fragen, so sich Sascha befindet!«
»Ich habe ihn nach Hause gebracht, er war sehr ungezogen«, erwiderte die Baronin hochmütig. »Sie brauchen nicht so besorgt zu tun, liebe Frau von Wellentin.«
»Ich bin besorgt. Die Fürsorge, die man den Kindern in Sophienlust angedeihen lässt, ist ansteckend.« Irene von Wellentin warf ihr einen kühlen Blick zu. »Ich glaube, liebe Baronin, Sie sollten jetzt gehen.«
Die Baronin wurde totenblass und erhob sich. Wortlos rauschte sie hinaus.
Sie atmete auf, als die Tür hinter der Baronin ins Schloss gefallen war. Diese ballte in ohnmächtiger Wut die Hände. Nun hatte sie noch eine Niederlage erlitten, und ihr Hass auf Denise wuchs ins Uferlose.
*
»Denise, mein Liebes«, sagte Alexander in einer stillen Minute leise, »Babs hat zwar besonders scharfe Augen, aber ich fürchte, lange werden wir nicht mehr verbergen können, was wir füreinander empfinden.«
»Wir müssen es, Lieber«, flüsterte sie. »Jetzt erst recht. Ich will nicht, dass die Kinder in Konflikte gestürzt werden. Auf der einen Seite ihre Großmutter, auf der anderen Seite ich.«
»Dafür, so meine ich, würden wir bei Irene von Wellentin eher Verständnis finden«, bemerkte er ruhig. »Es ist erstaunlich, wie sich diese Frau gewandelt hat.«
»Weil sie zur Einsicht gekommen ist. Aber du musst jetzt Sascha abholen. Ich weiß nicht, ich bin so merkwürdig unruhig.«
»Was keine Wunder ist. Ich bin es auch, wenn sie mit ihm zusammen ist. Behagt hat es ihm nicht, das habe ich ihm angesehen. Er hat wohl erwartet, dass ich ihm zur Hilfe kommen würde, aber sollte ich es tun, Denise? Es kam so überraschend. Brüskieren wollte ich sie auch nicht. Vielleicht ist sie jetzt einsichtiger, als wir annehmen.«
Wie er sich selber Mut macht, dachte sie. Oh, wie gern würde sie ihm helfen, die Gegensätze zu überbrücken, aber konnte das bei einer solchen Frau überhaupt möglich sein?
»Darf ich nicht noch bleiben, Papi? Bitte, bitte«, flehte Andrea. »Sascha möchte Tante Isi bestimmt auch gern guten Tag sagen. Wir spielen gerade so schön.«
»Nur noch ein halbes Stündchen«, meinte Denise, »dann wird gegessen, mein Liebes.«
Dass sie »mein Liebes« sagte, ließ Andreas Augen noch heller strahlen.
»Ich will ja auch nichts anderes als die anderen Kinder, Tante Isi«, meinte sie vernünftig. »Roli möchte mich so gern malen.«
»Nun haben wir ja bald eine ganze Galerie«, scherzte Denise.
Sie sahen Alexander nach, wie er davonfuhr, der Stadt entgegen. »Papi tut mir leid. Er wird sich wieder alles Mögliche von Großmama anhören müssen«, meinte Andrea nachdenklich. »Ich möchte nur wissen, was sie davon hat, wenn sie uns immer wieder gegen ihn aufhetzen will. So langsam müsste sie doch merken, dass ihr das nicht mehr gelingt.«
Sie sah das alles so nüchtern, dass Denise fast erschrak.
»Es ist alles so schön geworden, seit du hier bist, Tante Isi«, schmeichelte sie. »Wo bekommst du nur all die netten Kinder her?«
»Du siehst es ja, Kleines, sie kommen fast von selbst.«
»Aber uns hast du noch ein wenig lieber als die anderen?«, fragte Andrea eifersüchtig.
»Natürlich, mein Liebes«, sagte Denise, »wir dürfen es die anderen nur nicht merken lassen, Andrea.«
»Das weiß ich schon«, erwiderte das Kind und lächelte glücklich.
Denise ging mit ihr zu den anderen Kindern zurück. Roli hatte schon wieder ihren Zeichenblock aufgestellt und zeichnete eifrig. Auch dieses so schwierige Kind war jetzt aufgeschlossen und heiter.
»Gut, dass du kommst, Andrea«, meinte sie. »Deine Nase muss ich noch besser hinbekommen.«
Dominik begutachtete das Bild. »Es wird ziemlich gut«, stellte er fest, »aber da sieht Andrea meiner Mami ziemlich ähnlich.«
»Sonst auch?«, fragte Andrea hellauf begeistert.
Dominik betrachtete sie kritisch. »Ja, ziemlich«, meinte er. »Aber du machst ihr ja auch alles nach. Du guckst schon genauso wie Mami.«
»Wie denn?«, wollte Andrea wissen.
»Lieb«, erwiderte er schlicht.
*
Alexander trat aus dem Hotel wieder auf die Straße. Eine halbe Stunde hatte er bereits gewartet.
Von der Baronin und Sascha keine Spur.
Zu seinem Ärger gesellte sich Unruhe. Wollte sie ihn nur in Aufregung versetzen?
Da kam ihm Irene von Wellentin entgegen. Sie machte einen sehr erregten Eindruck.
»Haben Sie die Baronin Klees nicht angetroffen, Alexander?«, fragte sie tonlos. »Sie war bei mir – und ich gestehe, dass mich ihr Besuch nicht gerade erfreute. Sie hätte Sascha heimgebracht, sagte sie mir.«
»Heimgebracht?«, wiederholte er fragend.
»Ja, sie hatte sich wohl über ihn geärgert. Ich kann gar nicht sagen, warum ich herkomme. Eine innere Stimme trieb mich dazu.«
»Glücklicherweise«, erwiderte er dankbar, »sonst hätte ich mich noch länger gesorgt. Dann werde ich mich gleich auf den Weg machen. Herzlichen Dank, Frau von Wellentin. Sie haben mich von einer großen Sorge befreit.«
Er ahnte nicht, wie bald er schon eine viel größere haben sollte. Schnurstracks fuhr er nach Sophienlust zurück.
»Wo ist denn Sascha?«, fragte Andrea betroffen. »Bleibt er etwa bei Großmama?«
»Sie hat ihn schon früher heimgebracht. Mich wundert nur, dass er nicht wenigstens angerufen und Bescheid gesagt hat.«
»Er ist bestimmt sehr traurig, weil er ganz allein zu Hause ist. Wir rufen dich nachher noch mal an, Tante Isi«, versprach sie. »Damit du ihm wenigstens gute Nacht sagen kannst.«
Denise verspürte ein seltsames Angstgefühl, als sie davonfuhren. »Nun hat sie ihn wieder eingewickelt«, meinte Nick verächtlich. »Wer weiß, was sie ihm alles gekauft hat. Mir könnte einer schenken, was er wollte, wenn jemand böse über dich redet, würde ich nichts annehmen.«
»Sie ist seine Großmama«, erwiderte sie besonnen. »Du nimmst doch auch Geschenke von deiner Großmama.«
»Omi ist ja auch lieb. Sie würde nie mehr etwas gegen dich sagen. Ihr tut es leid, dass sie früher nicht gleich so nett zu uns war. Aber Saschas Großmama tut es bestimmt nicht leid.«
Kurz danach kam schon Alexanders Anruf, der Denise und alle anderen in die größte Aufregung stürzte. Der Junge war nicht auf Schoeneich. Niemand hatte ihn gesehen.
»Mein Gott«, flüsterte Denise, und alles um sie begann sich zu drehen.
*
Als Baronin von Klees ihr Hotel erreichte, erwartete sie eine Hiobsbotschaft.
Dr. Lutz Brachmann erhob sich aus einem Sessel und trat auf sie zu. Sein Gesicht war blass, und seine Stimme wollte ihm nicht gehorchen, als er sagte: »Wohin haben Sie Sascha gebracht, genädige Frau?«
Sie starrte ihn fassungslos an. »Sascha? Ich habe ihn doch heimgebracht«, flüsterte sie tonlos.
»Er ist nicht auf Schoeneich. Niemand hat ihn gesehen. Sie waren zuletzt mit ihm zusammen. Wo haben Sie ihn abgesetzt, wenn es stimmt, dass Sie ihn nach Hause gebracht haben.«
Wie Peitschenschläge prasselten seine Fragen auf sie herab.
»Nein, nein«, stöhnte sie auf, »Sie wollen mich nur erschrecken. Alexander schickt Sie, um mir Angst einzujagen.«
»Das wäre wohl das Letzte, wonach ihm zumute wäre«, murmelte er. »Sascha ist verschwunden.«
Da sank die Baronin ohnmächtig zu Boden.
*
Sascha merkte gar nicht, dass es dunkel wurde. Seine Augen brannten von ungeweinten Tränen, sein Herz schlug dumpf in seiner Brust. Immer weiter lief er, und der Wald wollte kein Ende nehmen.
Endlich merkte er, dass er den Weg nach Sophienlust verfehlt haben musste. Dort war der Wald nicht so dicht und dunkel.
»Tante Isi«, schluchzte er auf. »Liebe Tante Isi, ich bin so allein. Ich wollte doch zu dir. Du verstehst mich. Du verstehst alle Kinder.«
Wirr gingen die Gedanken durch seinen Kopf. Das, was Großmama zu ihm gesagt hatte und das, was er von Marie und Arnold erlauscht hatte.
Aber es war niemand da, der ihm Antwort auf seine bangen Fragen geben konnte. Es wurde kalt und immer dunkler und dunkler.
Er stolperte weiter. Seine Füße wollten ihm nicht mehr gehorchen.
Endlich entdeckte er einen Lichtschimmer. Es musste ein ganz einsames Haus sein, aber es war ein Haus, und sicher waren dort Menschen, die ihm den Weg nach Sophienlust weisen konnten.
Nur ganz vage konnte er die Umrisse einer Tür erkennen, die neben dem erleuchteten Fenster lag. Nein, richtig hell war es gar nicht. Es konnte nur eine kleine Lampe brennen. Aber wenn nun hinter dieser Tür kein guter Mensch wohnte? Wenn es ein böser war?
Sascha erinnerte sich des Märchens von Hänsel und Gretel, und in seinem verwirrten Kopf vermischten sich Märchen und Wirklichkeit. Ja, wie ein Hexenhaus sah es aus, und dann fauchte auch noch eine Katze. Ihre Augen funkelten in der Dunkelheit, und er schrie gellend auf, bevor ihm die Sinne schwanden.
*
»Was fauchst du denn so, Muschi?«, fragte ein dünnes Stimmchen in die Nacht hinaus. »Du sollst doch still sein. Großvater ist krank. Er darf sich nicht aufregen. Wir müssen jetzt ganz lieb sein, bis Dr. Baumgarten wiederkommt.«
Ein Kinderfuß tastete sich in die Dunkelheit, aber dann unterdrückte auch das kleine Mädchen einen Aufschrei. Da lag jemand vor ihr. Es war eine kleine Gestalt, jedenfalls nicht so groß wie ein Mann. Der Großvater hatte sie oft genug gewarnt, nur ja nicht mit einem fremden Mann zu sprechen oder gar mit ihm zu gehen. Aber Kati dachte daran sowieso nicht. Sie war froh, wenn sie niemanden sah. Nur seit der Großvater krank war, hatte sie das Angstgefühl kennengelernt, ganz allein zu sein.
Am liebsten hätte sie die Tür wieder zugemacht, aber die Gestalt regte sich nicht, und Kati hatte von ihrem Großvater immer wieder zu hören bekommen, dass man hilflosen Menschen helfen müsse.
»He, du«, raunte sie, »beweg dich doch mal. Wer bist du?«
Sascha kam rasch zu sich. Nur der Schrecken und die Erschöpfung hatten ihn für kurze Zeit seines Bewusstseins beraubt. Er vernahm die ferne Stimme, und sie klang gar nicht gefährlich oder gar drohend. Es war die Stimme eines Kindes.
»Wer bist du?«, fragte er stockend.
»Wer bist du?«, fragte Kati statt zu antworten.
»Sascha von Schoenecker«, erwiderte er mechanisch.
»Vom Gut?«, fragte die Kleine staunend. »Wie kommst du denn her? Das ist doch mächtig weit. Aber komm lieber erst mal rein. Es ist so kalt. Du musst nur ganz leise sein, weil Großvater krank ist und schlafen muss. Der Doktor kommt nachher noch einmal.«
»Dr. Baumgarten?«, fragte Sascha erleichtert. Wenigstens einer, den er kannte. »Habt ihr kein Telefon?«
»Ach wo, wie soll denn hierher ein Telefon kommen. Großvater ist doch nur der Waldhüter von Herrn von Wellentin.«
»Und wer bist du?«, fragte Sascha wieder, das kleine Mädchen mit den langen Zöpfen verwundert betrachtend.
»Kati Ebert bin ich«, erwiderte das Mädchen. Es legte den Finger auf den Mund und schlich in den Nebenraum.
»Großvater schläft ganz ruhig«, raunte sie, als sie zurückkam. »Aber wir dürfen nicht laut sein.«
»Ich kann ganz leise sprechen«, versicherte Sascha, froh, dass er überhaupt mit jemandem reden konnte. »Das hier ist wohl ziemlich weit von Sophienlust?«
»Ja, es ist weit weg und ich wünschte, es wäre noch viel weiter«, sagte sie düster. »Dr. Baumgarten hat gesagt, dass er mich dorthin bringt, wenn Großvater noch länger krank ist. Ich will aber nicht in ein Heim. Ich will hierbleiben bei Großvater und Muschi.«
Die Katze sprang auf ihre Schulter und legte schnurrend ihren Kopf an ihre Wange, als hätte sie die Worte verstanden.
»Muschi ist deine Katze, nicht wahr?«, meinte Sascha. »Du kannst dich doch nur freuen, wenn du nach Sophienlust kommst. Da ist es schöner als sonstwo auf der Welt.«
»Aber Muschi ist dann doch allein«, meinte die kleine Kati.
»Die kannst du doch mitnehmen! Dort nehmen sie alles, was lebendig ist. Ach, ich würde so gern dort sein.«
Kati betrachtete ihn staunend. »Wenn du doch der Sascha von Schoenecker bist, warum willst du dann lieber in Sophienlust sein?«, fragte sie stockend. »Ihr seid doch reich und habt ein schönes Haus. Großvater hat gesagt, er wäre auch lieber bei euch Waldhüter, aber einen alten Mann nimmt doch keiner mehr.«
»Mein Papi wird ihn schon nehmen, wenn er nicht für Herrn von Wellentin arbeiten will«, versicherte Sascha. »Ich kann ihn nicht leiden.«
»Ich auch nicht. Er sagt nicht mal guten Tag, wenn er mal kommt.«
Die gemeinsame Abneigung gegen Hubert von Wellentin brachte sie einander näher.
»Du bist ja nett zu mir«, meinte Sascha, »aber mir wäre es lieber, Onkel Werner würde kommen.«
»Wer ist denn Onkel Werner?«, wollte Kati wissen.
»Dr. Baumgarten. Er ist mit Tante Babs verheiratet. Er ist mein Onkel.«
»Er ist nett. Aber du bist auch ganz nett. Das hätte ich nicht gedacht.« Sie seufzte. »Warum habe ich dich denn noch nie gesehen? Manchmal kommen wir doch auch ins Dorf.«
»Ich bin noch nicht so lange hier«, erklärte Sascha. »Ich war erst im Internat, aber jetzt gehe ich in der Stadt zur Schule. Auf das Gymnasium«, fügte er erklärend hinzu.
»Ich gehe noch gar nicht zur Schule. Großvater hat gesagt, das hat noch ein Jahr Zeit. Er kann mich ja nicht immer hinbringen, und es ist über eine Stunde bis zum Dorf.«
Sascha überlegte, wie lange er da wohl gelaufen wäre. Eine Zeit musste er im Kreis gegangen sein, denn wie er nun auf seiner Armbanduhr erkennen konnte, war es bereits später als acht Uhr. Ob sie ihn jetzt suchen würden? Ergrimmt dachte er an seine Großmama. Hoffentlich bekam sie wenigstens einen tüchtigen Schrecken, wenn er nicht zu Hause angekommen war. Aber dann dachte er an seinen Vater, an Andrea und Tante Isi, und sein Groll schwand und machte tiefer Traurigkeit Platz. Ihnen wollte er keine Angst einjagen, und Tante Isi würde ganz bestimmt welche haben.
»Vor Sophienlust brauchst du wirklich keine Furcht zu haben«, fuhr er fort, um seinen eigenen Kummer zu vergessen. »Da haben es die Kinder gut.«
»Dann sagt Dr. Baumgarten das nicht nur so?«, fragte Kati.
»Nein, er gibt seine Kinder ja auch zu Tante Isi, wenn sie noch ein Baby kriegen.«
»Er gibt seine Kinder weg, weil er ein anderes haben will?«, erkundigte sich Kati entsetzt.
»Ach, du hast das nicht richtig verstanden. Doch nur für kurze Zeit, damit Tante Babs nicht gleich drei auf einmal hat. So ein Baby macht viel Arbeit, das haben wir bei Petra gesehen.«
»Wer ist Petra? Das Kind von Tante Isi?«, fragte Kati.
»Nein, Nick ist der Sohn von Tante Isi, aber das kann ich dir nicht alles erklären. Das wirst du schon sehen, wenn du nach Sophienlust kommst. Da lernst du sie alle kennen: Nick, Petra, Roli, Mario und Robby. Und Marlies natürlich auch.«
»Ich möchte aber lieber, dass Großvater schnell gesund wird und ich bei ihm bleiben kann.«
»Und deine Eltern, wo sind die?«
»Ganz weit weg. In Australien«, erklärte Kati. »Vielleicht holen sie mich mal, wenn sie das Geld beisammen haben, aber ich möchte lieber bei Großvater bleiben«, versicherte sie wieder. »Sonst ist er ja ganz allein.«
Sascha wusste nicht recht, was er von ihr halten sollte. Er wollte lieber nicht in einem so einsamen Haus mit einem Großvater und einer Katze allein leben. Er wäre viel lieber in Sophienlust. Da näherte sich Motorengeräusch, und beide waren wie auf Kommando ganz still und lauschten.
*
»Sascha ist verschwunden«, empfing Barbara Baumgarten ihren Mann aufgeregt. »Alle suchen ihn.«
»Ich habe es schon vernommen, Liebes. Bitte, reg dich nicht auf. Das ist gefährlich in deinem Zustand. Ich muss schnell noch nach dem alten Ebert sehen. Ich kann die Kleine nicht mit dem sterbenskranken Mann allein lassen. Sie sollte ohnehin nach Sophienlust. Da kann ich sie gleich mitnehmen und mich dann an der Suche beteiligen. Ich möchte nur wissen, was da passiert ist. Sascha ist doch ein verständiger Junge und kennt sich in der Gegend aus. Er kann doch nicht einfach weggelaufen sein.«
»Wer weiß, was diese alte Klees ihm wieder erzählt hat«, vermutete Barbara. »Isi sagte mir am Telefon, dass sie bei ihrer Schwiegermutter gewesen ist und diese auch völlig aus der Fassung gebracht hat. Setzt den Jungen einfach vor Schoeneich ab, ohne sich zu überzeugen, dass er auch in Empfang genommen wird.«
Dr. Baumgarten hatte keine Zeit, sich Barbaras Betrachtungen anzuhören. Er war schon wieder auf dem Weg nach draußen.
»Gib acht auf dich«, ermahnte er seine Frau noch einmal, bevor er sich wieder ans Steuer setzte.
*
Alexander war ins Dorf gefahren, dann nach Sophienlust und wieder zurück. Nun machten sie sich zu Fuß, mit Laternen bewaffnet, auf die Suche. Andrea hatte er in Denises Obhut zurückgelassen. Claudia, Edith Gerlach, Urban und Justus beteiligten sich an der Suche.
Immer wieder riefen sie Saschas Namen, doch es kam keine Antwort.
Wieder kam Alexander nach Sophienlust zurück, wo nun auch Irene von Wellentin eingetroffen war, zitternd vor Angst. Dann kam ein Anruf von Schoeneich, dass die Baronin von Klees dort auf eine Nachricht warte.
»Sie wird es mir büßen, wenn dem Jungen etwas zugestoßen ist«, sagte Alexander tonlos. »Einmal hat sie ihn mit ihrer Achtlosigkeit schon fast ins Grab gebracht.«
Denise dachte dran, wie sie um Sascha gebangt hatten, als er mit der schweren Blinddarmentzündung in der Klinik lag. In der gemeinsamen Angst um das Kind hatten Alexander und sie sich gefunden, aber jetzt war die Angst noch größer, denn sie wussten nicht, wo sie ihn noch suchen sollten.
»Vielleicht hat sie ihn doch versteckt und ihr Gewissen schlägt«, suchte er nach einem Hoffnungsschimmer. Und wieder fuhr er nach Schoeneich.
*
»Saschas Schutzengel wird schon bei ihm sein«, versuchte währenddessen Dominik Andrea zu trösten. »Er lässt die Kinder nicht im Stich.«
Andrea wusste nicht so recht, ob man sich in diesem Fall so ganz auf einen Schutzengel verlassen konnte. Draußen war es so schrecklich dunkel. Nicht ein Stern stand am Himmel, und der Mond hatte sich auch verkrochen.
»Ich habe Sascha schrecklich lieb«, wisperte sie. »Ich wusste gar nicht, dass ich solche Angst um ihn haben könnte.«
So groß wie Dominiks Angst war, danach musste er Sascha eigentlich ebenso lieb haben. Bebend schmiegten sie sich aneinander.
»Frieren wird er, und Hunger wird er auch haben«, schluchzte Andrea. »Wie lange kann man leben, ohne was zu essen, Nick?«
»Wenn es so ist wie bei Tieren, kann man ziemlich lange leben, ohne was zu essen«, meinte Dominik beruhigend.
Inzwischen hatte Alexander Schoeneich erreicht. Überall auf der Straße war er freiwilligen Helfern begegnet. Das ganze Dorf war auf den Beinen, Sascha zu suchen.
Die Baronin Klees fand er in aufgelöstem Zustand vor. »Er wollte nach Hause«, begann sie sofort, hysterisch weinend, mit ihrer Verteidigung.
»Er wusste, dass wir in Sophienlust sind«, sagte er heiser. »Ich könnte mir vorstellen, dass er dorthin wollte.«
»Vielleicht denkt er ganz anders als du«, begehrte sie auf. »Es kann doch sein, dass es ihm nicht behagt, wie sehr du dich an diese …« Unter seinem zornigen Blick schwieg sie.
»Ich kann mir denken, was du sagen willst«, stieß er wütend hervor. »Kein Wort gegen Denise von Wellentin, das rate ich dir. Wenn Sascha etwas zugestoßen ist, ist es bestimmt nicht ihre Schuld.«
Bevor sie etwas erwidern konnte, läutete das Telefon. Alexander griff hastig nach dem Hörer.
»Oh, mein Gott, ich danke dir«, rief er erleichtert. »Ich komme sofort.« Und zu der Baronin gewandt, fuhr er fort: »Sascha ist gefunden. Dich aber möchte ich ersuchen, dieses Haus zu verlassen und es nie wieder zu betreten. Nie wieder!«, wiederholte er mit rauer Stimme.
»Das werde ich mir selbst ersparen«, entgegnete sie hochmütig. »Du lieferst die Kinder ja lieber dieser ...«
»Schweig«, herrschte er sie an, »sonst vergesse ich mich noch.«
*
Sascha stand in der Tür des kleinen Hauses, als Dr. Baumgarten aus dem Wagen stieg. Jetzt war alles gut.
»Onkel Werner«, seufzte er erleichtert. »Ich bin so froh, dass du gekommen bist.«
»Sascha, wie kommst du hierher? Man sucht dich überall. Du hast uns einen schönen Schrecken eingejagt.«
»Ich habe mich verlaufen«, sagte Sascha kleinlaut. »Ich wollte eigentlich nach Sophienlust, aber dann wurde es immer dunkler, und endlich fand ich das Haus und Kati.«
»Die Hauptsache ist, dass du gesund bist. Jetzt werde ich rasch nach Herrn Ebert sehen, dann bringe ich euch beide nach Sophienlust.«
»Vielleicht ist Großvater bald wieder gesund?«, ließ Kati sich vernehmen.
Doch Dr. Baumgarten musste gleich feststellen, dass der Großvater nie mehr gesund werden würde. Ganz still war er hinübergeschlummert in die andere Welt, während die Kinder sich unterhielten.
»Du kommst jetzt mit, Kati«, sagte er liebevoll zu der Kleinen, während er fieberhaft überlegte, ob er ihr jetzt schon sagen sollte, dass der alte Mann gestorben war.
Katis Augen füllten sich mit Tränen. »Auf Wiedersehen möchte ich Großvater aber doch noch sagen«, meinte sie. »Sascha hat mir erzählt, dass es schön ist in Sophienlust, viel schöner als sonstwo auf der Welt. Es wird Großvater Freude machen.«
»Sag ihm Lebewohl, Kati«, meinte Dr. Baumgarten bedrückt. Sascha sah ihn aufmerksam an. Er spürte, dass etwas geschehen war, was Kati nicht vorausgesehen hatte.
»Es ist so still«, flüsterte Kati. »Ich höre Großvaters Atem gar nicht mehr.« Ihre Stimme bebte.
»Er ist eingeschlafen, Kati«, erwiderte Dr. Baumgarten leise. »Er wird nicht mehr aufwachen. Komm, Kleines. Er ist erlöst von allen Schmerzen.«
Mühsam versuchte Kati, die Tränen zu unterdrücken, aber dann rannen sie doch über ihre Wangen.
»Er ist jetzt beim lieben Gott«, flüsterte sie erstickt. »Und nun bin ich ganz allein.«
»Du bist nicht allein. Viele werden dich lieb haben, Kind«, sagte er behutsam.
Sascha trat auf sie zu. Er legte den Arm um sie. »Nimm deine Muschi und komm mit«, meinte er tröstend. »Du wirst schon sehen, dass ich dir nicht zu viel versprochen habe.«
*
Sascha, das Sorgenkind, und Andrea blieben an diesem Abend in Sophienlust. Er schlief tief und traumlos. Für ihn hatte das Abenteuer den Schrecken verloren, als er in die Geborgenheit von Sophienlust zurückkehrte, und auch Kati schlief ruhig, trotz ihres großen Kummers, der ihr Herz bewegte.
Denise entschloss sich am nächsten Morgen, Sascha nicht in die Schule zu bringen. Sie rief Alexander an. Er war damit einverstanden, denn auch er wollte sich zuvor vergewissern, dass die Baronin Klees die Stadt verlassen hatte. Das war allerdings nicht der Fall.
Ihr saß mehr denn je die Angst im Nacken, dass die Affären ihrer Tochter doch noch ans Tageslicht gezerrt werden könnten. Sie wollte die Beweise dafür unbedingt vernichtet wissen.
So hatte Hubert von Wellentin das zweifelhafte Vergnügen, ihren Besuch angekündigt zu bekommen. Das Gespräch zwischen ihnen verlief in sehr gereizter Atmosphäre.
»Verlangen Sie nicht ein wenig zu viel von mir?«, knurrte er gereizt. »Ich soll vor Schoenecker zu Kreuze kriechen und ihm die Briefe abhandeln? Weiß ich denn überhaupt, dass sie noch existieren. Mein Gott, Sybille ist schon lange tot und meine Frau ist ohnehin über meine Affäre mit ihr informiert. Was habe ich jetzt schon noch zu befürchten.«
»Sie haben Sybille in Verruf gebracht«, begehrte sie auf. »Nun sollten Sie wenigstens so viel Kavalier sein und ihr Andenken zu schützen versuchen.«
Er kniff die Augen zusammen. »Wenn ich auch mit Schoenecker nicht besonders gut stehe, so traue ich ihm doch nicht zu, dass er seinen Namen ins Gerede bringt, nur um Sie zu kränken. Vielleicht sollten Sie es auch einmal mit Toleranz versuchen. Schließlich sind es in erster Linie seine Kinder, und sie wären ihm doch ohnehin zugesprochen worden, wenn Sybille sich hätte scheiden lassen.«
Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. »Scheiden lassen?«, stöhnte sie außer Atem. »Davon war doch nie die Rede.«
Er lächelte ironisch. »Vielleicht informieren Sie sich einmal bei dem Grafen Satorski, falls er wieder im Lande sein sollte. Ich möchte mit dieser Geschichte nichts zu tun haben. Ich bin daran interessiert, meine Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen.«
Die Baronin Klees fühlte sich zutiefst gedemütigt. Wäre sie doch nur nicht hierhergekommen, dann wäre wenigstens diese Geschichte mit Sascha nicht passiert, die seinen Vater erneut gegen sie aufbringen musste.
Was konnte sie nur tun, um eine völlige Niederlage zu verhindern? Darauf bedacht, für sich selbst eine Rechtfertigung zu suchen, schob sie ungerechterweise alle Schuld auf Denise. Wäre sie nicht gekommen, würde alles noch so sein wie früher. Niemals wäre Alexander auf den Gedanken gekommen, die Kinder zu sich zu nehmen. Sie steigerte sich so in diese Vorstellung hinein, dass sie überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
Doch davon hatte Alexander keine Ahnung. Er wünschte nur Ruhe für sich und die Kinder, die er wohlbehalten und liebevoll versorgt in Sophienlust wusste.
Dort hatte für die kleine Kati der Tag mit einigen Überraschungen begonnen. Um ihr das Einleben leichter zu machen und den Tod ihres Großvaters schneller vergessen zu lassen, hatten sich die Kinder etwas ausgedacht.
Ganz früh war Dominik schon aufgestanden und stattete dem Papageien Habakuk einen Besuch ab.
Habakuk war noch recht mürrisch. Er war es nicht gewohnt, zu so früher Stunde zu seinem Gespräch aufgefordert zu werden. Er hatte schon seine Launen, der gute Habakuk.
»Nun hör mir mal schön zu, Habakuk«, redete er auf ihn ein.
»Hör zu, Habakuk«, wiederholte der Papagei.
»Du sollst sagen: Guten Morgen, Kati.«
»Morgen, Nick«, kreischte der Papagei.
»Guten Morgen, Kati, guten Morgen, Kati, guten Morgen, Kati«, wiederholte Dominik ungeduldig. »Verstehst du denn nicht, du bist doch sonst so schlau.«
»Bist doch sonst so schlau«, kreischte Habakuk und wandte sich beleidigt ab.
Dominik seufzte tief auf. Das wurde scheinbar nichts, er musste sich etwas anderes einfallen lassen, um Kati zu erfreuen.
Aber als er schon an der Tür war, schrie Habakuk plötzlich: »Guten Morgen, Kati!« Und das wiederholte er ein paar Mal.
Kati rieb sich die Augen. Sie war in einem wunderhübschen Zimmer erwacht und musste sich erst besinnen, wie sie hierhergekommen war. Und da rief immer jemand mit so komischer Stimme: »Guten Morgen, Kati!«
Sie war es gewohnt, früh aufzustehen. Immer hatte sie ihren Großvater auf seinen morgendlichen Rundgängen begleitet, und als er krank wurde, hatte sie ihn ganz allein versorgt. Ein schmales Kind mit traurigen Augen war sie und doch erst sechs Jahre alt.
Sie schlich sich hinaus, um der Stimme zu folgen. Da traf sie Dominik.
»Guten Morgen, Kati«, sagte er leise, aber das war nicht die Stimme, die sie vorher gehört hatte. Sie glaubte zu träumen, und plötzlich fiel ihr Muschi ein, ihre Katze. Wo war die? Sie folgte ihr doch immer.
Sie vernahm ein klagendes Miauen, und das hörte auch Dominik. Er winkte Kati, und sie traten in den Wintergarten. Vor Habakuks Bauer saß Muschi und hob die Tatzen.
»Krrch, Krrch, scher dich fort«, schrie Habakuk. Und dann wieder voller Stolz auf seine neuerlernten Worte: »Guten Morgen, Kati!«
»Ein Vogel, der reden kann«, stellte Kati staunend fest. »Ich kenne viele Vögel, aber keinen, der redet.«
»Das ist ein Papagei. Er kann sehr viel reden«, versicherte Dominik.
»Woher weiß er denn meinen Namen?«, fragte Kati.
»Von mir«, sagte Dominik stolz.
»Muschi hat Angst vor ihm«, flüsterte Kati.
»Ich glaube, er hat eher Angst vor ihr«, meinte Nick, »aber sie gewöhnen sich schon aneinander. Die Hunde habe sich auch daran gewöhnt.«
»Wir hatten auch einen Hund. Er ist vor ein paar Wochen gestorben. Und nun ist Großvater auch tot.«
Wieder kamen ihr die Tränen. Nick streichelte ihre Hand. »Nicht traurig sein, Kati, er war alt und krank. Meine Urgroßmama musste auch sterben, und mein Papi war noch ganz jung, als ihn der liebe Gott geholt hat. Du hast ja uns. Wir werden es dir schön machen. Du wirst schon sehen, dass du dich rasch eingewöhnst. Roli war zuerst auch immer traurig, aber nun möchte sie auch nicht mehr weg von uns.«
»Na, ihr beiden, was ist mit euch?«, sagte Claudia freundlich. »Wollen wir uns nicht lieber erst einmal waschen und anziehen?«
»Habakuk weiß meinen Namen schon«, flüsterte Kati, und ein Lächeln erhellte ihr Gesichtchen.
»Das ist fein, meinen kann er noch immer nicht sagen. Mich ruft er Caulia.«
»Ich muss mich jetzt fertig machen. Wir müssen in die Schule.«
Gleich schaute Kati wieder ängstlich drein, aber er tröstete sie. »Mario, Marlies und Petra sind ja da und Roli wird mit euch spielen. Wo ist Sascha?«, fragte er dann.
»Er bleibt heute zu Hause«, erwiderte Claudia.
»Er hat’s gut«, seufzte Dominik, aber das meinte er gar nicht so ernst, denn er ging gern in die Schule. Und weil er nicht murrte, murrte Andrea auch nicht.
Die Schulkinder frühstückten früher als die anderen, dann brachte Denise sie ins Dorf.
Von allen Seiten wurde sie freundlich begrüßt. Manch einer fragte, wie es Sascha ginge. Es hatte einen mächtigen Wirbel gegeben, aber nun hatte man schon wieder neuen Gesprächsstoff, weil der alte Ebert gestorben war und die kleine Kati nun auch Aufnahme in Sophienlust gefunden hatte.
»Was ist das für ein Segen für unser Dorf«, sagte der Lehrer Brodmann voller Dankbarkeit. »Jetzt macht es mir erst richtige Freude, hier zu leben.«
Einmal unterwegs, beschloss Denise, gleich einige Sachen für Kati zu kaufen. Das Kind war ja in ganz erbärmlichem Zustand. Bitterkeit erfüllte sie, wenn sie bedachte, wie wenig der reiche Hubert von Wellentin Sorge dafür trug, dass auch seine Angestellten ein menschenwürdiges Leben führen konnten. Die Familie Nickel und nun auch der alte Ebert mit seiner Enkelin bewiesen es.
Warum hatte seine Tochter eigentlich das Kind bei ihm zurückgelassen?, überlegte Denise, als sie über Kati nachdachte. Ob sie das Kind nun zu sich holen würde?
Ihr Weg führte an der Fabrik vorbei, vor der sich ein großer Menschenauflauf angesammelt hatte.
Was ist denn da los?, ging es ihr durch den Sinn, als ein Krankenwagen mit heulenden Sirenen vorfuhr. Sie musste anhalten, und da entdeckte sie ihre Schwiegermutter. Leichenblass stieg sie aus ihrem Wagen.
Rasch stieg auch Denise aus und ging auf sie zu. »Was ist geschehen, Mama?«, fragte sie bestürzt.
»Man hat mich eben benachrichtigt«, murmelte Irene von Wellentin. »Hubert ist etwas zugestoßen. Ich bin ganz durcheinander. Er muss gestern Abend noch einmal in die Fabrik gegangen sein. Anscheinend überraschte er jemanden bei einem Einbruch und wurde niedergeschlagen. Sie haben ihn erst heute Morgen gefunden.«
Ein Unglück kommt selten allein, dachte Denise. Nun hatte der gestrige aufregende Tag auch noch einen so dramatischen Nachklang gefunden.
Hubert von Wellentin war zwar übel zugerichtet, aber in Lebensgefahr schwebte er nicht. Irene von Wellentin folgte ihm in die Klinik.
*
Rasch drang die Kunde auch nach Gut Sophienlust. Lutz Brachmann hatte Claudia telefonisch informiert.
Hoffentlich war ihm das nun einmal eine Lehre und er beginnt nachzudenken, waren ihre ersten Gedanken, aber sofort wurde sie von den Kindern abgelenkt.
Wie es fast nicht anders zu erwarten gewesen war, schloss Kati sich zuerst an die kleine Marlies an, obgleich sie viel jünger war. Instinktiv spürte sie, dass sie aus ähnlichen Verhältnissen stammten, und Mario war nach wie vor sehr zurückhaltend. Sascha ließ sich gar nicht blicken. Er schlief noch immer. Er war gestern zu lange gelaufen, und bis zu seinem Zimmer hinauf drangen keine störenden Geräusche.
Er wurde erst munter, als Denise von ihren Einkäufen zurückkam. Schlaftrunken rieb er sich die Augen, als sie in sein Zimmer trat.
»Wie spät ist es denn schon?«, fragte er erschrocken. »Ich muss doch in die Schule.«
»Heute ausnahmsweise einmal nicht«, beruhigte ihn Denise.
»Das ist aber fein. Da müsste ich ja öfter mal ausreißen«, grinste er lausbubenhaft.
»Untersteh dich«, drohte sie ihm lächelnd. »Wir haben genug ausgestanden.«
Schmeichelnd drückte er ihre Hand an seine Wange. »Ich wollte euch nicht ängstigen, Tante Isi. Ich wollte doch nur nach Sophienlust kommen und mit dir reden. Du bist doch die Einzige, mit der ich richtig reden kann.«
Es rührte sie zutiefst. »Aber mit dem Papi kannst du doch auch richtig reden«, meinte sie.
»Darüber aber nicht.« Seine Augen verdunkelten sich. »Ich habe gehört, wie Marie mit Arnold sprach. Ich habe nicht gelauscht. Sie haben ganz laut gesprochen, weil Arnold doch so schwerhörig ist. Es war nicht schön.«
»Was meinst du?«, fragte sie beklommen.
»Was sie über Mutti gesagt haben. Sie sei ein Luder gewesen und so was, Tante Isi.«
Ihr schnürte es der Herz zusammen. »Vielleicht hast du dich verhört, Sascha«, lenkte sie ab. »Sicher haben sie von jemand anders gesprochen.«
»Nein, bestimmt nicht, und der Arnold sagte, dass sie frech geworden sei, als er sie mal mit dem Herrn von Wellentin ertappt hat. Was soll das alles bedeuten? Kannst du es mir erklären, Tante Isi? Großmama hat mir doch immer erzählt, dass sie ein Engel gewesen sei und wie lieb sie uns gehabt hätte.«
»Deine Mutter ist tot, Sascha«, flüsterte sie. »Manchmal sagen die Leute Dinge, die sie gar nicht verantworten können. Denk nicht mehr daran.«
»Ich muss immerzu daran denken«, murmelte er. »Wenn man noch nicht erwachsen ist, kann man vieles nicht verstehen.«
»Werde nur nicht so schnell erwachsen, mein Junge«, meinte sie liebevoll. Und dann dachte sie: Ich werde mit Alexander darüber sprechen müssen. Die Kinder müssen davon verschont bleiben. Mag Sybille gewesen sein, wie sie will, ihre Kindheit soll davon nicht belastet werden. Es ist schon genug, dass Alexander so gelitten hat.
»Großmama hat gesagt, ich sei sehr ungezogen gewesen, aber das war ich nicht«, erklärte Sascha zu seiner Verteidigung. »Ich habe ihr nur gesagt, dass ich gar nichts geschenkt bekommen will und dass ich lieber nach Sophienlust möchte.«
»Sie sieht es nicht gern, wenn ihr hier seid. Ältere Menschen haben so ihre Eigenarten«, meinte Denise beschwichtigend.
»Aber sie kann es uns doch nicht verbieten! Sie sagt auch, dass ein so großer Junge wie ich nicht mehr Papi sagen dürfte. Weiß Papi, dass ich nicht zur Schule gegangen bin?«
Denise nickte. »Ich habe mit ihm telefoniert. Und nun vergiss den gestrigen Tag, Sascha. Deine kleine Freundin ist schon lange munter. Ich denke, sie hat den größten Kummer, und darüber wollen wir ihr doch hinweghelfen.«
»Sie ist ein ganz armes kleines Mädchen«, murmelte er. »Sie muss sich hier wie eine Prinzessin vorkommen, wo es doch sogar für uns so schön ist.«
*
Kati kam sich wirklich wie eine Prinzessin vor, als Denise ihr das hübsche neue Kleid anzog.
»Warum tust du das?«, fragte sie schüchtern. »Es ist doch niemand da, der es bezahlen kann.«
»Dafür ist hier genügend Geld da, Kati. Es ist nicht mein eigenes. Die alte Frau von Wellentin, Dominiks Urgroßmama, hat es dafür bestimmt. Du brauchst dir also gar keine Gedanken darüber zu machen.«
Kati nickte gedankenvoll. »Ja, Großvater hat immer gesagt, dass die alte Frau von Wellentin ein guter Mensch gewesen ist. Aber ihr Sohn hat nicht viel von ihr«, setzte sie altklug hinzu.
»Er ist ein Mann und denkt nicht darüber nach, dass man manchmal etwas mehr als das Notwendige tun muss.«
Wieder nickte Kati. »Großvater hat immer gesagt, dass es gut ist, dass meine Eltern fortgegangen sind nach Australien. Da haben sie bestimmt ein besseres Leben. Aber jetzt sind sie schon ein paar Jahre fort, aber so gut scheint das Leben dort auch nicht zu sein. Ich wollte auch lieber bei Großvater bleiben, damit er nicht ganz allein ist.«
Ein alter Mann und ein kleines Mädchen in einem einsamen Haus, dachte Denise, und ich wusste nichts von ihrer Not.
Nun aber konnte sie Kati Sascha überlassen, der sie überall herumführte. Er war schon ganz daheim hier. Für Kati gab es genug zu schauen, was den anderen Kindern schon zur alltäglichen Gewohnheit geworden war. Für sie war alles wie ein Wunder.
Irene von Wellentin saß am Bett ihres Mannes. Jetzt, da er so hilflos in den Kissen lag, wollte sie ihn nicht im Stich lassen. Er hatte eine Platzwunde am Kopf, aber sonst keine schweren Verletzungen. Doch erinnern konnte er sich an nichts mehr.
»Was ist denn mit mir passiert, Irene?«, fragte er mit völlig normaler Stimme und ohne den gewohnten sarkastischen Unterton.
»Jemand hat dich verletzt«, erwiderte sie gedankenvoll.
»Verletzt – wo denn? Ein Unfall mit dem Auto?«
»Nein, in der Fabrik. Erinnerst du dich nicht, warum du gestern Abend noch einmal in die Fabrik gegangen bist, Hubert?«
Er schüttelte leicht den Kopf, doch das bereitete ihm anscheinend Schmerzen. Stöhnend sank er zurück.
»Wann bin ich denn von zu Hause fortgegangen?«, fragte er.
»Du warst doch nicht zu Hause, nicht in unserm Haus«, erwiderte sie leise. »Du warst doch in der Stadt.«
Sie wusste nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie wollte erst mit dem Arzt sprechen. Wie nannte man doch diese Krankheit, die einem solchen Schock folgen konnte? Amnesie oder so ähnlich. Mit medizinischen Fachbegriffen hatte sie sich nie befasst, aber sie begriff doch, dass etwas Ähnliches bei ihrem Mann eingetreten sein musste.
Er hatte die Augen wieder geschlossen. Tiefe Atemzüge verkündeten, dass er eingeschlafen war.
Nun konnte sie ungestört mit dem Arzt sprechen. Was geschehen war, hatten sie noch immer nicht in Erfahrung gebracht. Der Nachtwächter konnte sich zwar erinnern, den Herrn Generaldirektor gesehen zu haben, als er die Fabrik betrat, aber sonst hatte er nichts Auffälliges wahrgenommen und auch keine ungewöhnlichen Geräusche gehört.
Aber der Nachtwächter war ein alter Mann, der für ein kärgliches Entgelt diesen Posten versah. Bei der Besetzung solcher Posten sah Hubert von Wellentin immer darauf, dass er sparen konnte.
Der Arzt beruhigte Irene von Wellentin, dass die Erinnerung sehr rasch zurückkommen konnte, wenn er sich von dem Schock erholt hatte.
*
»Warum kommt Omi heute nicht?«, erkundigte sich Dominik, als der Nachmittag dahinging, ohne dass sie sich blicken ließ. »Hat der Großvater es ihr doch verboten?«
Das sollte er sich nicht einreden. So entschloss sich Denise, ihm die Wahrheit zu sagen.
Ganz entsetzt sah Dominik sie an. »Ein richtiger Einbrecher hat ihn umbringen wollen?«, fragte er atemlos.
»Zumindest hat er ihn ziemlich verletzt«, erwiderte sie.
»Hat man ihn schon geschnappt?«, erkundigte er sich eifrig. »So was darf man doch nicht tun, nicht mal dem Großvater.«
»Nein, so was darf man nicht tun, und man wird ihn sicher auch finden«, meinte Denise. »Nun siehst du wohl auch ein, dass Omi jetzt bei ihm bleiben muss.«
»Vielleicht wird er jetzt netter, wenn ihm auch mal einer richtig wehgetan hat«, fuhr er sinnend fort.
Nun, das glaubte Denise allerdings nicht.
Dass Sascha und Andrea auch heute Nacht noch in Sophienlust bleiben durften, freute Dominik so sehr, dass er auch keine Einwände machte, als seine Mami ihm erklärte, dass sie für ein paar Stunden wegfahren müsse. Und da die anderen schon laut nach ihm riefen, fragte er sie auch nicht nach dem Ziel ihrer Fahrt.
Ihr war das sehr willkommen, denn sie hatte sich entschlossen, nach Schoeneich zu fahren, um einmal ganz ungestört mit Alexander sprechen zu können. Sie hatte ihn angerufen, und seine Stimme hatte so froh geklungen, dass ihr ganz leicht ums Herz wurde.
Als sie jedoch nach Schoeneich kam, verabschiedete sich gerade ein Besucher von Alexander, und diesem war es sichtlich unangenehm, dass Denise mit ihm zusammentraf.
»Graf Satorski – Frau von Wellentin«, stellte er formell vor.
Er mochte etwa im gleichen Alter sein wie Alexander, aber er war ein ganz anderer Typ. Ein richtiger Playboy, dachte Denise.
Ein herausfordernder Blick traf sie. »Ich wusste nicht, dass Dietmars Frau so bezaubernd ist«, stellte Satorski mit einem süffisanten Lächeln fest. »Begreiflich, dass Sie mich so schnell loswerden wollten, Schoenecker. Na, nichts für ungut. Ich werde hoffentlich das Vergnügen haben, Sie noch öfter zu sehen, gnädige Frau.«
»Das soll er sich ja nicht einfallen lassen«, knurrte Alexander gereizt. »Verzeih, Denise, aber er wollte einfach nicht gehen. Es passt mir gar nicht, dass du mit ihm zusammengetroffen bist.«
»Keine Angst, Alexander«, lächelte sie, »ich werde ihm schon aus dem Wege gehen. Was wollte er denn?«, erkundigte sie sich beiläufig.
»Alte Verbindungen auffrischen. Er war lange Zeit im Ausland.«
Sie spürte, dass er einer direkten Antwort ausweichen wollte, aber sie wollte keine Fragen stellen. Was ihr am Herzen lag, erschien ihr noch wichtiger. Sie konnte nicht ahnen, dass es auch Satorski mit betreffen konnte.
Ganz vorsichtig steuerte sie das Thema an. Alexanders Miene verschloss sich zusehends.
»Die Sonne bringt es an den Tag«, murmelte er bitter, »aber in diesem Fall muss man wohl sagen, dass es Marie war. Es ist fatal, dass es dem Jungen zu Ohren kommen musste. Er ist nicht mehr so klein, dass er sich nicht Gedanken darüber macht. Aber er kommt zu dir und nicht zu mir. Das behagt mir nicht, Liebes.«
»Er weiß genau, dass er von dir kaum eine Antwort bekommen würde, aber ich kann ihm auch keine geben. Du musst dem Personal eindringlich sagen, dass darüber nicht gesprochen werden darf.«
»Sie täten es auch bestimmt nicht, wenn die Kinder es hören könnten. Sie konnten nicht damit rechnen, dass Sascha in der Nähe war. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sie sich damit beschäftigen, aber mir zuliebe haben sie außerhalb von Schoeneich bestimmt kein Wort verlauten lassen. Ja, so ist das nun, Denise. Da lügt man und versucht, sich selbst zu täuschen. Da wird ein Bild aufrechterhalten, das einen falschen Eindruck vermitteln muss. Ich wusste genau, wie Sybille war. Doch sogar dich habe ich zu täuschen versucht.«
»Ich kann es dir nicht verübeln, Alexander. Für mich ist das auch nicht wichtig, wie sie war. Es schmerzt mich nur, wie sehr du darunter gelitten hast.«
Er legte behutsam seine Arme um sie. »Du machst alles gut, Liebste«, flüsterte er. »Du lässt es mich vergessen.«
Endlich einmal waren sie allein. Kein Kind war in der Nähe, das hereinplatzen konnte. Sie brauchten nicht zu fürchten, dass jemand sie belauschte.
Sie vergaßen in ihrer innigen Umarmung alles, was sie bedrückte. Sie waren nur ein Mann und eine Frau – zwei Menschen, die sich liebten und sich vor Sehnsucht nacheinander verzehrten.
*
»Du warst ziemlich lange weg, Mami«, wurde Denise von Dominik mit leisem Vorwurf empfangen. »Omi war kurz da, aber sie hat nur mit Claudia über den Großvater gesprochen. Morgen kommt sie wieder zu uns. Sie hat uns sehr vermisst.«
»Siehst du, Nick, jetzt hält sie es keinen Tag ohne dich aus«, meinte Denise gedankenvoll.
»Ohne uns. Mit dir hätte sie auch gern gesprochen. Wo warst du eigentlich?«
»Etwas erledigen und dann in Schoeneich«, wich sie verlegen aus.
»Warum ist Onkel Alexander nicht mitgekommen?«
»Er hat viel zu tun. Morgen kommt er ja.«
»Ach, dann müssen Sascha und Andrea wieder mit nach Hause«, schmollte Dominik. »Das ist schade. Warum können wir nicht immer beisammen sein?«
»Es geht doch nicht, Nick«, erwiderte sie leise. »Der ganze Betrieb hier – das siehst du doch ein.«
»Aber Sascha und Andrea macht das nichts aus. Sie wollen gern immer hier sein, und für Onkel Alexander ist doch auch noch Platz.«
»Und was würde dann aus Schoeneich?«
»Ach, da kann er doch jeden Tag hinfahren, oder Sascha hat gesagt, er könnte es auch verpachten.«
»Über was ihr so alles redet«, meinte sie atemlos.
»Wir hätten nichts dagegen, Mami. Wir sind uns nämlich einig.«
»Worüber?«
»Dass es schöner wäre, wenn wir immer beisammen sind«, erwiderte er unbefangen. »Von uns Kindern hat keiner was dagegen.«
»Ihr stellt euch das alles so leicht vor«, seufzte sie.
Denise war erleichtert, als Claudia eintrat und das Gespräch dadurch unterbrochen wurde.
»Ich gehe dann auch schlafen«, erklärte Dominik bereitwillig. »Dürfen wir noch ein bisschen reden, Mami?«
»Aber nicht zu lange. Ich komme nachher noch mal nachschauen.«
»Die drei haben heute ja viel zu reden gehabt«, meinte Claudia. »Man könnte fast meinen, sie wollen dich und Alexander verkuppeln. Aber das brauchen sie wohl gar nicht erst«, fügte sie verschmitzt hinzu.
Denise blickte gedankenverloren zum Fenster hinaus. »Selbst wenn die Kinder es wollen«, sagte sie leise, »ich sehe keinen Weg, Claudia.«
»Du siehst den Wald vor Bäumen nicht mehr, das ist es. Das Kinderheim Sophienlust gut und schön, aber es wird sich doch eine vernünftige Person finden lassen, die die Leitung übernehmen kann.«
»Damit man mir nachsagen kann, dass mir meine persönlichen Interessen doch wichtiger sind? Nein, ich halte durch. Hubert von Wellentin soll nicht recht behalten. Er würde sich schön eins ins Fäustchen lachen.«
»Einstweilen hat er gar keinen Grund zum Lachen. Er leidet an Gedächtnisschwund. Er kann sich zwar noch an seine Frau erinnern, aber sonst an nichts mehr, selbst daran nicht, dass sie getrennt gelebt haben.«
»Meinst du nicht, dass dies nur Theater ist?«, fragte Denise nachdenklich. »Für ihn ein willkommener Anlass, allen Unannehmlichkeiten zu entgehen und seine Frau zur Rückkehr zu bewegen?«
»Zuerst dachte ich auch an so etwas, aber es scheint doch zu stimmen. Als sie ihm sagte, dass sie nach Sophienlust fahren würde, hat er keinen Einspruch erhoben. Na, wir werden ja sehen, wie es weitergeht.«
»Ich schaue jetzt noch mal nach den Kindern. Gehst du noch weg?«
»Lutz holt mich ab. Wir sind heute Abend bei den Schwiegereltern.« Sie machte ein schuldbewusstes Gesicht. »Du hättest es dir mit mir wohl auch anders vorgestellt, Isi? Holst mich her, und ich lasse dich sitzen.«
»Ich bin froh, wenn du glücklich wirst«, sagte Denise herzlich.
*
An jdem Bett musste Denise ein paar Minuten verweilen. Mario erzählte ihr, dass man mit Kati ganz wunderschön spielen könnte. Noch viel schöner als mit Susi, meinte er.
Die kleine Marlies blinzelte schon schlaftrunken, musste ihr dann aber rasch doch noch berichten, dass sie jetzt schon Seilspringen könnte.
Von Kati erfuhr sie, dass es in Sophienlust wunderbar sei.
Robby kam schuldbewusst aus dem Zimmer seiner Mutter gehuscht, und Roli versteckte ebenso schuldbewusst ihren Zeichenblock.
»Ich bin schon fertig«, sagte sie rasch. »Entschuldigung, dass ich noch Licht habe.«
»Darf ich mir dein neues Werk einmal anschauen?«, fragte Denise.
»Ich weiß nicht, ob es gut so ist.«
Sie hatte die Katze Muschi aufs Papier gebannt, und es war ein entzückendes Bildchen. Es war unglaublich, welche Ausdruckskraft in Rolis Bildern steckte.
»Wenn ich nur wüsste, wer dir Unterricht geben könnte«, meinte sie, aber ganz plötzlich kam ihr eine Idee. Es wäre doch für die langen Wintertage sicher eine schöne Abwechslung, wenn alle Kinder Zeichenunterricht bekämen. Ob sie einmal annoncierte? Ein Talent wie Roli durfte einfach nicht verkümmern. Aber jedes Talent musste auch gebildet werden.
Sie strich dem Mädchen über die Wange. »Wenn du so weitermachst, wirst du mal berühmt, Roli«, meinte sie anerkennend.
»Kann ich dann auch viel Geld verdienen?«, fragte Roli.
»Das ist schon möglich. Aber damit hat es noch Zeit.«
»Aber dann kann ich dir alles zurückgeben, Tante Isi. Ich möchte so gern viel Geld verdienen, damit ich es dem Heim geben kann. Hier ist ein richtiges Zuhause.«
»Das hast du schön gesagt, Roli. So haben wir es uns ja auch vorgestellt.«
Und das muss ich den Kinder erhalten, dachte sie weiter. Ein richtiges Zuhause! Sie hatte es auch erst hier gefunden.
Nun ging sie noch zu ihren Kindern. Ja, für sie waren auch Sascha und Andrea schon ihre Kinder geworden. Alle hatte sie gern, aber ihre drei liebte sie mit mütterlicher Hingabe.
»Schön, dass du noch kommst, Tante Isi«, sagte Andrea. »Ich kann gar nicht einschlafen, wenn ich dir nicht gute Nacht gesagt habe.«
»Dann sagen wir es jetzt ganz lieb, und du schläfst gleich. Deine Augen fallen dir ja schon zu.«
»Ich möchte dich aber gern etwas fragen.«
»Können wir das nicht bis morgen aufheben?«, fragte Denise, um Zeit zu gewinnen. Sie ahnte schon, was jetzt kommen würde.
»Du hast uns doch lieb, nicht wahr?« Denise nickte. »Und Papi hast du auch lieb?«
»Ja, ich habe ihn auch lieb«, erwiderte Denise zögernd.
»Nur weil er unser Papi ist oder auch so?«
»Was ihr alles wissen wollt«, flüchtete sich Denise in ein nachdenkliches Lächeln.
»Großmama hat zu Sascha gesagt, dass Papi dich eines Tages bestimmt heiraten wird, aber er hat sich nicht getraut ihr zu sagen, dass er nichts dagegen hätte, weil sie doch sowieso schon so böse war. Ich wollte dir das nur sagen, damit du weißt, dass ich auch nichts dagegen hätte. Ganz im Gegenteil.«
»Wir kennen uns noch gar nicht so lange«, erwiderte Denise ausweichend.
»Mir ist es so, als würde ich dich schon immer kennen. Du hättest gleich unsere Mami sein müssen, Tante Isi, dann hätten wir den ganzen Ärger mit Großmama nicht.«
Sie bekam einen zärtlichen Kuss und gab endlich Ruhe. Die gleichen Fragen, nur etwas vorsichtiger gestellt, wiederholten sich bei Sascha.
»Papi hat ja nur Angst, dass er dich kompri… Wie heißt das blöde Wort nur wieder?«
»Kompromittiert«, entgegnete Denise mechanisch. »Das trifft für uns nicht zu, Sascha.«
»Na, dann könnte er doch auch hier schlafen«, sagte er. »Ich möchte nicht wissen, wie allein er ist und wie sehr er uns beneidet.«
Wie genau er es doch fühlte! »Es gibt gewisse Dinge, die Zeit brauchen, Sascha«, meinte sie. »Es ist schön, dass wir uns sehen können und wissen, dass wir uns ganz nahe sind.«
»Und dass es ein Telefon gibt«, fügte er hinzu. »Ich bin richtig froh, dass Susis Vater eine andere Frau hat. Ich hatte schon Angst, dass er dich uns wegnehmen würde.«
»Das wäre nie passiert und wird auch nicht passieren«, versprach sie, um nun rasch ihrem Sohn noch einen Gutenachtkuss zu geben.
»Jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal erfahren, wie es Susi geht«, erklärte er unwillig. »Ich glaube gar, sie hat uns schon vergessen.«
*
Das war nicht der Fall, aber das neue Leben in dem fremden Land war so aufregend und die Eindrücke, die Susi sammeln musste, waren so gewaltig, dass sie noch gar keine Zeit gehabt hatte, Heimweh nach Sophienlust zu bekommen.
Kurz entschlossen hatten Günther Berkin und Ines geheiratet, und Susi fand das ganz in Ordnung, denn es ging nicht an, dass Ines eine eigne Wohnung hatte, während in ihrem schönen Haus doch genug Platz war.
Ganz unauffällig und ohne jedes Aufheben hatten Günther Berkin und Ines sich trauen lassen. Nun hatte er zwar eine liebevolle Mutter für seine Tochter gefunden, aber auf seine tüchtige Sekretärin musste er verzichten, und das kam ihm hart genug an.
Erst jetzt wurde ihm so recht bewusst, wie viel ihm Ines bedeutete. Es war gar nicht so einfach, plötzlich zu erkennen, dass nicht reine Vernunft der Ursprung dieses Entschlusses gewesen war. Und noch schwerer fiel es ihm, es Ines einzugestehen.
Es war ganz seltsam zwischen ihnen. Beide scheuten sich, dem anderen seine Gefühle zu offenbaren, und ganz instinktiv empfand Susi, dass eigentlich nicht alles so war, wie es sein sollte.
»Heute müssen wir aber an Nick schreiben«, erklärte sie an diesem Morgen. »Hast du mal Zeit, Ines? Oder hat Papi dir wieder so viel Arbeit mitgebracht?«
Als Sekretärin bin ich ihm scheinbar unersetzlich, dachte Ines wehmütig, denn ein ganzer Berg Schreibarbeiten lag auf ihrem Schreibtisch.
»Zu allererst schreiben wir an Nick«, erklärte sie entschlossen. »Du sagst mir, was ich schreiben soll, Susi, so wie du es mit Claudia gemacht hast.«
»Aber meinen Namen kann ich jetzt schon selbst schreiben«, erklärte Susi stolz. »Ich brauche gar nicht in die Schule zu gehen. Du bist die allerbeste Lehrerin, Ines.« Und nach einem kurzen Zögern fügte sie hinzu: »Und auch die beste Mami.«
Zum ersten Mal sprach sie es aus, und Ines kamen fast die Tränen. »Das möchte ich auch sein, mein Kleines«, erwiderte sie zärtlich. »Also schreiben wir.«
»Sagt das Papi auch immer zu dir?«, fragte Susi schelmisch.
»Genauso.«
Susi sah sie skeptisch an. »Würdest du lieber noch seine Sekretärin sein als seine Frau?«
»Wie kommst du darauf, Susi?«, fragte Ines erschrocken.
»Weil du da viele Stunden bei ihm sein konntest, aber jetzt ist er nur abends daheim. Ein bisschen mehr Zeit könnte er schon haben.«
»Er hat einen sehr verantwortungsvollen Posten«, erklärte Ines. »Wie wollen wir beginnen?«, lenkte sie ab.
»Lieber Nick – nein, lieber so: Liebe Tante Isi, lieber Nick und alle in Sophienlust. Wie spät wird es dort jetzt sein? Ich überlege, was sie gerade machen können.« Susi versank in Gedanken und Ines stenografierte alles mit, was sie sagte.
»Jetzt kommen Nick und Andrea vielleicht gerade aus der Schule. Ach, Robby dürfen wir ja nicht vergessen. ob er mit seiner Mutti noch in Sophienlust ist? Hat Marlies sich schon eingewöhnt? Bei mir ist das ganz schnell gegangen, aber hier habe ich mich auch eingewöhnt. Papi und Mami haben gleich geheiratet, und wir haben ein sehr hübsches Haus. Natürlich ist es nicht so groß wie Sophienlust, aber wir haben ja auch nicht so viele Kinder. Hoffentlich bekommen wir bald noch welche, denn es ist viel schöner, wenn man mehr hat.« Sie legte ihr Köpfchen schief und sah Ines nachdenklich an. »Ob uns auch mal jemand ein Baby vor die Tür legt?«, fragte sie. »Würdest du es dann auch nehmen? Aber wie ist das eigentlich, könnten wir uns nicht auch ein Baby bestellen? – Das darfst du aber nicht alles schreiben«, meinte Susi kopfschüttelnd, als Ines auch das ganz automatisch notierte.
Sie hatten beide nicht bemerkt, dass Günther eingetreten war, viel früher als sonst. Er blieb an der Tür stehen und lauschte dem munteren Geplauder seiner Tochter.
»Über das Baby können wir später noch reden«, fuhr Susi fort. »Jetzt schreiben wir erst rasch noch den Brief zu Ende. Also schreib mal, dass es mir hier sehr gut gefällt und dass es schön ist, Mami und Papi zu haben. Uns fehlen nur noch ein paar Kinder …«
»Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst, Susi«, unterbrach Ines sie. »Wir haben kein Kinderheim, und wir wollen froh sein, dass wir wenigstens dich haben.«
»Aber wir können Papi doch sagen, dass wir gern noch mehr Kinder wollen. Warum weinst du denn nun?«, fragte sie erschrocken.
Weil ich dir diesen Wunsch nicht erfüllen kann, dachte Ines verzweifelt. Niemals werde ich ein eigenes Kind haben.
Da machte sich Günther Berkin bemerkbar. Susi flog ihm in die Arme.
»Mami weint«, sagte sie aufgeregt. »Ich habe doch gar nichts Dummes gesagt – oder doch? Darf ich mir keine Geschwister wünschen? Willst du das nicht, Papi?«
»Lass mich mal einen Augenblick allein mit Ines«, sagte er heiser.
»Wir wollten aber den Brief fertig schreiben«, protestierte sie.
»Das können wir später. Vielleicht malst du inzwischen ein Bild für Nick.«
Susi merkte, dass sie augenblicklich fehl am Platze war und trollte sich.
Sanft legte Günther Berkin seine Hände auf Ines’ Schultern und legte seine Lippen an ihre Schläfe.
»Du musst nicht weinen, Ines«, sagte er bittend. »Wir waren uns doch klar darüber.«
»Aber wir haben nicht an Susi dabei gedacht«, schluchzte sie. »Ich bin die falsche Frau für dich.«
»Nein, du bist genau die richtige Frau«, erwiderte er weich. »Die Ärzte haben sich schon oft getäuscht, mein Liebes. Gerade heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass eine Frau nach zehnjähriger kinderloser Ehe Vierlinge zur Welt gebracht hat.«
Sie lachte unter Tränen. »Vier wären wohl ein bisschen viel auf einmal.«
»Für Susi bestimmt nicht, aber zehn Jahre wären schon ein wenig lang.«
Verlegen strich sie sich eine Haarsträhne aus der Stirn. »Du bist heute früh daheim«, lenkte sie ab.
»Weil es höchste Zeit wird, dass ich mich um meine Familie kümmere und vor allem um meine Frau. Sonst kommt sie womöglich noch auf ganz falsche Gedanken.«
»Auf welche?«, fragte sie leise.
»Dass sie nur meine Sekretärin und Susis Mutter sein soll«, erwiderte er innig. Dann küsste er sie lange und zärtlich, und Susi, der es plötzlich zu still geworden war, verschwand rasch wieder in ihrem Zimmer.
Sie wusste jetzt ganz genau, was sie Nick noch schreiben wollte. Wir haben uns alle sehr lieb. Ja, das wusste sie jetzt ganz genau.
*
»Mir wäre es ja ein bisschen langweilig, nur ein Kind zu sein«, meinte Nick, als seine Mutter ihm den Brief vorgelesen hatte, der ein paar Tage später eintraf. »Haben woanders alle Kinder richtige Eltern, Mami?«
»Nein, es gibt überall welche, die nur eine Mutter oder einen Vater haben oder auch keinen von beiden mehr.«
»Dann können sie sich doch ein paar suchen. Wenn wir Mario nicht so lieb hätten, könnten sie ihn ja bekommen, aber wir geben jetzt keins mehr her, nicht wahr?« Er betrachtete seine Mutter forschend. »Du könntest dir doch auch nicht vorstellen, dass wir wieder allein wären«, überlegte Dominik gedankenvoll, als ein schnittiger Wagen in den Gutshof fuhr.
»Wer ist denn das?«, fragte Dominik gespannt. »Den kenne ich gar nicht.« Sein Blick wurde sofort misstrauisch. »Er gefällt mir nicht, Mami.« Kompromisslos wie er war, verteilte Nick seine Sympathien und Antipathien umgehend.
Denise gefiel er auch nicht, und am liebsten hätte sie sich verleugnen lassen, aber da meldete Urban schon den Grafen Satorski.
»Wenn der ein Kind bei uns abgeben will, nehmen wir es nicht, Mami«, erklärte Dominik aggressiv.
Graf Satorski brachte rote Rosen mit, was Denise sehr kühn fand. Reserviert begrüßte sie ihn, er aber ließ seinen ganzen Charme spielen.
Während er auf Denise einredete, überlegte sie krampfhaft, wie sie ihn rasch wieder loswerden könnte, aber Dominik war so schnell verschwunden, dass sie sich nicht einmal an ihn als Rettungsanker klammern konnte.
»Ein herrlicher Besitz«, stellte Satorski fest. »Offen gestanden verstehe ich nicht ganz, dass Sie ihn für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen, Frau von Wellentin.«
So ein arroganter Kerl, dachte sie verägert und erwiderte kühl: »Es ist eine Aufgabe.«
Nick war schnurstracks zu Claudia geflitzt. »Komm rasch«, drängte er, »da ist ein Mann gekommen, den ich gar nicht leiden kann. Geh du zu Mami, wir machen inzwischen Krach, damit es ihm zu viel wird.«
Solche drastischen Maßnahmen wollten Claudia nicht recht behagen, außerdem wusste sie ja nicht, um wen es sich bei dem Besucher handelte, aber es konnte ja sein, dass Denise auf eine Hilfestellung hoffte. Sollte das nicht der Fall sein, würde sie es ihr schon zu verstehen geben.
In Windeseile hatte Dominik alle Kinder zusammengetrommelt und überredete sie, ein Indianergebrüll anzustimmen. Nur zögernd kamen sie diesem Befehl nach.
Es geschah alles gleichzeitig. Claudia trat nach kurzem Anklopfen ein, die Kinder begannen lauthals zu schreien, die Hunde zu bellen und Habakuk zu kreischen.
Graf Satorski zuckte zusammen, Denise unterdrückte nur mit Mühe ein Lächeln.
»Darf ich bekannt machen«, sagte sie kühl, aber die offizielle Vorstellung ging in dem Chaos unter.
»Können Sie das ertragen?«, fragte Graf Satorski konsterniert.
»Kinder müssen sich austoben können«, meinte Denise gelassen und warf Claudia einen dankbaren Blick zu. »Es ist Essenszeit. Die Rangen haben Hunger«, fuhr sie fort. »Sie entschuldigen mich? Ich muss meinen Pflichten nachkommen. Nett, dass Sie hereingeschaut haben, aber falls Sie unser Heim einmal besichtigen wollen, ist es besser, wenn Sie sich anmelden.«
»Danke für die Geistesgegenwart, Claudia«, seufzte Denise erleichtert, als Satorski Hals über Kopf das Feld geräumt hatte, »der hat mir gerade noch gefehlt.«
»Bedank dich bei deinem Sohn. Wenn dem einer nicht in den Kram passt, ist er zu allem fähig.«
»Ruhe«, rief sie mit donnernder Stimme zum Fenster hinaus. Und es war sofort mucksmäuschenstill.
»Hat’s was genutzt?«, fragte Nick gleich darauf durch die Tür. »Ich hab’ doch gleich gemerkt, dass der keine Kinder mag. So was können wir hier nicht gebrauchen.«
»Halb so laut hätte auch genügt«, sagte Denise lächelnd.
»Aber vielleicht wäre er dann nicht so rasch wieder gegangen«, überlegte er. »Was wollte er überhaupt?«
»Das frage ich mich auch.«
Sein Blick fiel auf die roten Rosen. »Das würde Onkel Alexander bestimmt nicht gefallen«, stellte er tiefsinnig fest.
Denise errötete. »Bring sie Frau Trenk. Die mag rote Rosen.«
»Aber ich weiß genau, wenn wir zwei jemand nicht mögen«, versicherte Dominik und beeilte sich, die Rosen zu Frau Trenk zu bringen.
»Was ist das denn für ein Kavalier?«, fragte Claudia.
»Ich habe ihn neulich mal flüchtig kennengelernt, als ich auf Schoeneich war. Graf Satorski.«
»Da muss ich doch gleich mal Lutz interviewen, wer das ist«, meinte Claudia.
»Satorski?«, fragte Lutz schockiert, als sie ihn abends fragte. »Wie kommst du auf den, Claudia?«
»Ich überhaupt nicht. Er hat Denise einen Besuch gemacht, aber mit vereinten Kräften haben wir ihn schnell hinausgegrault. Hoffentlich wird er sobald nicht wiederkommen.«
»Wenn er es auf Denise abgesehen hat? Täusch dich nicht, der ist hartnäckig. Der schöne Satorski ruht nicht, bis er nicht jede Frau erobert hat, die ihm gefällt.«
»An Denise wird er sich die Zähne ausbeißen«, erwiderte sie.
»Aber es könnte doch zu Komplikationen mit Alexander von Schoenecker kommen. Sybille wollte sich seinetwegen scheiden lassen.«
»Guter Gott«, stöhnte Claudia, »und das sagst du so gelassen?«
»Es ist schon einige Zeit her, mein Liebling. Wenn Vater neulich nicht zufällig davon gesprochen hätte, könnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war ja noch ein braver Jüngling, als sich das hier abspielte.«
»Wie brav warst du?«, wollte sie wissen.
»Sehr brav«, erwiderte er lächelnd. »Meine Vergangenheit brauche ich nicht zu verleugnen, Claudia. Satorski dagegen – ich möchte nur wissen, warum er es ausgerechnet auf Denise abgesehen hat.«
»Immerhin ist sie sehr attraktiv.«
»Aber bestimmt nicht sein Fall. Sie ist zu damenhaft.«
»Vielleicht weiß er, dass sie früher mal Tänzerin war und denkt sich etwas ganz anderes.«
»Dann frage ich mich als Anwalt, von wem er es wissen könnte. Er ist nicht sehr beliebt. Denise dagegen – für sie würde jeder durchs Feuer gehen.«
»Er hatte eine Affäre mit Sybille von Schoenecker«, stellte sie gedankenvoll fest.
»Lassen wir das doch. Einmal muss diese Geschichte doch zur Ruhe kommen.«
»Aber jemand scheint doch daran interessiert zu sein, Denise ins Gerede zu bringen«, überlegte sie.
»Das sind bloße Vermutungen, Liebes. Aber es ist komisch, dass er sich hier wieder eingenistet hat. Er ist doch total verschuldet, die Gläubiger werden ihm die Bude einrennen.«
»Vielleicht sucht er eine reiche Frau, die ihn saniert und Denise kommt ihm gerade recht?«, meinte sie ängstlich.
»Vielleicht aber hat ihm jemand auch eine Menge Geld geboten, wenn er sich an sie heranmacht«, stellte er plötzlich fest. »Fragt sich nur, wer? Wellentin? Der ist krank. Sein Gedächtnisschwund hält an.«
»Es kann ja sein, dass sie sich vorher geeinigt haben?«
»Machen wir keinen Kriminalroman daraus, mein Liebes. Warten wir es ab.«
*
»Irene?« Schwach klang Hubert von Wellentins Stimme durch den Raum.
»Möchtest du etwas?«, fragte sie leise. Manchmal fragte sie sich, warum sie so beharrlich an seinem Krankenlager aushielt, da sie sich innerlich doch schon so weit von ihm entfernt hatte. Aber dann wieder hatte sie tiefes Mitgefühl mit ihm. Noch niemals war er so krank, so hilflos gewesen. Immer war er stark, selbstbewusst und herrisch aufgetreten.
»Bitte, komm näher«, sagte er bittend. »Meine Augen schmerzen. Ich kann dich nicht erkennen. Alles ist verschwommen.«
Ein heftiger Schrecken durchzuckte sie. War es möglich, dass er nun auch noch das Augenlicht verlor? Konnte eine solche Verletzung das mit sich bringen. Ein Mann wie er, wie würde er das ertragen?
»Soll ich nicht lieber den Arzt rufen?«, fragte sie bebend. »Hast du Schmerzen, Hubert?«
»Nein, ich habe keine Schmerzen. Ich muss nur dauernd überlegen, was geschehen ist. Hilf mir doch!« Es klang wie ein verzweifelter Aufschrei, aber sie konnte ihm beim besten Willen nicht helfen. Bis heute war noch keine Spur von dem Einbrecher gefunden worden. Aber war es überhaupt ein Einbrecher gewesen? Die Polizei hatte nicht die geringste Spur für ein gewaltsames Eindringen finden können. Bis jetzt blieb es ein Geheimnis, warum Hubert von Wellentin so spät noch in die Fabrik gegangen war und was er dort gesucht hatte.
Sie rückte ihren Stuhl näher an sein Bett. »Wo warst du heute?«, fragte er.
»Wie immer in Sophienlust«, erwiderte sie tapfer. »Auch wenn du es nicht verstehst, Hubert. Ich brauche diese Stunden. Ich weiß erst jetzt, was ich entbehrt habe. Wir haben Dietmar verloren, aber –«
»Dietmar«, fiel er ihr ins Wort. »Er hat sie geheiratet, stimmt das, Irene?«
»Ja, es stimmt. Er hat Denise geheiratet, und ich sage heute, dass er keine bessere Wahl hätte treffen können. Ich gäbe Jahre meines Lebens dafür, wenn ich ihm das sagen könnte.«
»Denise von Wellentin«, sagte er langsam. »Dominik – so heißt doch der Junge?«
»Ja«, erwiderte sie leise. Wie eigenartig war es doch, dass er sich an manches doch zu erinnern schien. Wie war das zu erklären?
»Du gehst dort ein und aus, Irene«, stellte er nachdenklich fest. »Wie ist das gekommen?«
Durfte sie ihm die Wahrheit sagen? Konnte es ihm nicht schaden? Nein, schaden wollte sie ihm nicht, so viel er ihr auch angetan hatte. Jetzt war er krank und hilflos und für sie zählte nur noch die Zeit, in der sie seine Frau gewesen war, ohne an ihm zu zweifeln. Es hatte eine solche Zeit gegeben.
»Edith war dort. Ich wollte sie und ihr Kind besuchen«, sagte sie stockend. »Du erinnerst dich an Edith?«
Seine Augen waren geschlossen. »Dieses Mädchen, mit dem du gereist bist. Ja, jetzt erinnere ich mich. Warum verließ sie eigentlich unser Haus?«
Es war so seltsam und erschreckend, dass er sich an alles, was ungerecht in seinem Handeln gewesen war, nicht erinnern konnte. Hatte er es vergessen wollen?, fragte sie sich. War das des Rätsels Lösung? War er etwa vor diesem Unglück zu der Erkenntnis gekommen, dass er vieles falsch gemacht hatte, und war ihm das Bewusstsein erhalten geblieben, dass er gutmachen wollte?
Jäh wurde ihr bewusst, dass hier kein Arzt helfen konnte, sondern nur ein verstehender Mensch. Vielleicht nutzte es ihm schon, dass sie ihm helfen wollte.
»Edith Gerlach ging nach Sophienlust, weil dort ihr Kind war«, sagte sie. »Die kleine Petra ist jetzt neun Monate alt und ein reizendes Baby.«
Sie wusste nicht, ob er sie verstanden hatte. Er lag regungslos. »Erzähl mir von Dominik«, bat er schließlich stockend.
»Er sagt Omi zu mir«, erzählte sie mit erstickter Stimme. »Er ist ein reizender, gescheiter Junge. Willst du ihn sehen, Hubert?«
Wieder herrschte ein langes Schweigen. »Wird es Denise erlauben?«, fragte er dann kaum vernehmbar. »Was habe ich falsch gemacht, Irene? Sag es mir! Du weißt es doch. Irgendwo klafft eine Lücke … Er wollte mich erpressen«, rief er dann mit erhobener Stimme. Sein Atem ging schwer.
»Wer wollte dich erpressen, Hubert?«, rief sie beschwörend.
Er griff sich an die Stirn. »Ich weiß nichts, Irene, ich weiß es nicht mehr. Ich möchte Dominik einmal sehen. Sag mir doch, was ich falsch gemacht habe.«
»Wir haben beide vieles falsch gemacht, Hubert. Ich habe es nur früher eingesehen als du«, erwiderte sie weich.
*
»Ich weiß, dass ich viel, vielleicht Unmögliches von dir verlange, Denise«, sagte Irene von Wellentin verhalten. »Bitte versteh, dass ich diese Bitte geäußert habe.«
»Es bedarf doch keiner Worte, Mama«, erwiderte Denise ruhig. »Ich werde mit Nick sprechen.«
Hoffentlich ist er nicht bockig, dachte sie, während sie ihn suchte. Sie entdeckte ihn mit den anderen Kindern auf der Ponyweide.
»Nick«, rief sie und winkte ihm zu. Er kam sofort.
»Omi ist gekommen«, erklärte sie ihm.
»Da muss ich ihr aber gleich guten Tag sagen«, erwiderte er freudig.
»Wir möchten dich beide um etwas bitten, Nick!«
»Um etwas Wichtiges?«
»Ja, um etwas sehr Wichtiges«, erwiderte sie zögernd. »Dein Großvater möchte dich gern sehen.«
»Mein Großvater? Omis Mann? Ist er wieder gesund?«
»Eben nicht. Vielleicht kann er gesund werden, wenn du ihn besuchst.«
»Und dich will er nicht sehen?«, fragte Dominik aggressiv.
Diese Frage hatte Denise gefürchtet. »Er darf nur wenige Besucher empfangen«, erklärte sie.»Ich werde dann später zu ihm gehen. Omi zuliebe könntest du es doch tun.«
»Ich weiß nicht so recht«, meinte er ehrlich. »Vielleicht sage ich was, was ihm nicht gefällt.«
»Er ist krank, Nick. Und er hat vieles vergessen. Das wollen wir auch vergessen, wenn es ihm hilft.«
»Hast du schon mit Onkel Alexander gesprochen?«
»Meinst du, dass ich das tun sollte?«, fragte sie befangen.
Seine Stirn krauste sich. »Natürlich. Ich möchte nichts tun, was Onkel Alexander nicht recht ist.«
So viel bedeutet er ihm, dachte Denise beklommen. Sie griff nach seiner Hand. »Ich werde Onkel Alexander anrufen.«
»Was bist du für eine Frau«, sagte Alexander von Schoenecker bewundernd. »Denise …«
»Tante Isi, Tante Isi«, schallte es durch den Draht. Sascha und Andrea hatten ihrem Vater keine Zeit gelassen, den Satz zu Ende zu sprechen.
Denise legte langsam den Hörer auf. »Wenn du Großvater besucht hast, werden wir nach Schoeneich fahren, Nick«, sagte sie mit dunkler Stimme.
»Als Belohnung?«, fragte er schelmisch. »Ganz allein, nur wir zwei?«
»Nur wir zwei!«
»Onkel Alexander ist schlau«, meinte er. »Können wir mal den ganzen Abend allein sein, Mami. Du, Onkel Alexander, Sascha, Andrea und ich?«
»Wir werden mit ihnen essen.«
»Marie kocht zwar nicht so gut wie Magda«, meinte er, »aber wenn wir kommen, wird sie sich schon ganz besondere Mühe geben.«
»Werde nur nicht frech, Nick«, warnte sie.
»Bei Großvater werde ich ganz brav sein. Ich weiß doch, was ich dir schuldig bin«, versicherte er. »Er ist ja auch krank«, sagte er mitleidig.
*
Denise war mit in die Stadt gefahren, um einige Einkäufe zu tätigen. Kinder brauchten immer irgendetwas, das konnte sie jeden Tag feststellen.
Vor der Klinik hatte sie sich von ihrer Schwiegermutter und Dominik verabschiedet. Der Junge hatte ihr noch einen sehr nachdenklichen Blick zugeworfen, als wolle er sagen: Hoffentlich erleben wir keine Enttäuschung.
Denise schlug den Mantelkragen hoch. Es fröstelte sie noch mehr, als sie noch einen Blick auf die Klinik warf. In einem dieser vielen Zimmer lag Hubert von Wellentin, und in wenigen Minuten würde sein Enkel an sein Bett treten.
Die zehn Minuten kann ich auch zu Fuß gehen, sagte sie sich und ließ den Wagen auf dem Parkplatz stehen.
Ihr fehlte eigentlich die richtige Stimmung. Ihre Gedanken waren bei ihrem Sohn, der so tapfer seinen Widerwillen gegen den Krankenbesuch unterdrückt hatte, um seine Omi nicht zu enttäuschen. Er klammerte sich jetzt wohl an den Gedanken, dass er nachher mit seiner Mami nach Schoeneich fahren konnte.
Wortlos ging Dominik neben seiner Omi über den langen Gang. Als sie vor einer Tür stehen blieb, atmete er tief durch. Mit einem etwas gequälten Lächeln blickte sie ihn aufmunternd an.
»Fällt es dir sehr schwer, Nick?«, fragte sie.
»Na ja, ich war ja noch nie in einem Krankenhaus. Ich finde es grässlich hier. Alles ist so kahl. Großvater möchte bestimmt auch gern wieder nach Hause.«
Leise drückte sie die Klinke herunter. Mit geschlossenen Augen lag Hubert von Wellentin im Bett. Aber er schlief nicht.
»Irene?«, fragte er leise. Als sie sagte: »Ja, ich bin es, Hubert«, schlug er die Augen auf. Aber er sah nicht sie an, sondern den Jungen, der seine Mütze abgenommen hatte und zögernd an das Bett trat.
»Guten Tag, Großvater«, sagte er stockend. »Ich hoffe, dass es dir recht ist, wenn ich dich besuche.«
Sekunden vergingen, bis Hubert von Wellentin Worte fand. »Ich habe es mir doch gewünscht«, sagte er dann tonlos. »Ich dachte nur nicht, dass du kommen würdest. Bist du aber groß geworden!«
»Das sieht nur so aus, weil du im Bett liegst«, meinte Dominik. »So viel bin ich gar nicht gewachsen. Geht es dir besser? Tut dein Kopf sehr weh? Es war ganz gemein von dem Kerl, dich so zu schlagen. Wenn du ihn wenigstens gesehen hättest.«
Nun war ihm schon ein wenig wohler. Er konnte reden, ohne dass der Großvater ihm das Wort abschnitt und ohne ihn abweisend anzublicken.
»Jetzt geht es mir schon viel besser«, sagte er.
»Vielleicht kannst du dich nun doch erinnern, wie der Mann aussah«, fuhr Dominik eifrig fort. »Ich will, dass er endlich geschnappt wird. Er muss seine Strafe kriegen.«
»Das ist jetzt nicht so wichtig«, murmelte Hubert von Wellentin. »Erzähl mir ein wenig von Sophienlust. Was ihr so treibt und was ihr nun macht, wenn der Winter kommt.«
»Von den anderen Kindern willst du auch was wissen?«, staunte Dominik. »Du kennst sie doch gar nicht, oder hat Omi dir von ihnen erzählt?«
»Ich möchte, dass du mir von ihnen erzählst. Und von dir und deiner Mutter.«
Dominik überlegte angestrengt. Er konnte es nicht so rasch begreifen, dass der Großvater so ganz anders war als früher. Musste man dazu erst krank werden oder einen Schlag auf den Kopf bekommen?
»Mami hat uns hergebracht. Sie kauft jetzt ein. Du hast ja keine Ahnung, was so viele Kinder alles brauchen. Schuhe, Strümpfe, Wäsche und Anzüge. Immerzu geht was kaputt. Nachher holt mich Mami wieder ab, aber nicht so schnell«, fügte er hastig hinzu. »Ich kann schon noch ein bisschen bleiben. Wenn es dir aber zu viel wird, musst du es sagen, dann warte ich draußen. Bin ich zu lebhaft?«
»Nein, ich höre dir gern zu.«
Dominik warf seiner Omi einen fragenden Blick zu. Ob das auch stimmte? Sie nickte ihm zu, und er war beruhigt.
»Na, dann fangen wir mal bei Mario an. Der ist zuerst gekommen. Er hat keine Eltern mehr. Sie sind mit dem Auto verunglückt. Claudi hat ihn mitgebracht. Weißt du, dass Claudi Dr. Brachmann heiratet?«
»Dr. Brachmann? – Ja, ich erinnere mich«, erwiderte Hubert von Wellentin langsam. »Weißt du, es fällt mir schwer, mich an manches zu erinnern.«
»Das hat Omi schon gesagt. Da wollen wir mal hübsch nachhelfen«, meinte Dominik unbekümmert. »Dass wir dann Petra bekommen haben und dass ihre Mutti auch bei uns ist, weißt du ja schon. Dann kam Susanne, aber die ist jetzt in Johannesburg bei ihren Eltern. Ihr Papi hat geheiratet. Interessiert dich das auch?«
»Du kannst sehr anschaulich erzählen.«
Dominik lächelte schelmisch. »Das sagt Lehrer Brodmann auch. Ich möchte ja auch mal ganz gescheit werden, damit ich Urgroßmama keine Schande mache. Sie soll sich freuen, wenn sie vom Himmel auf uns herabblickt.«
»Es ist sehr lieb, dass du das sagst«, flüsterte Hubert von Wellentin.
»Es war ja auch sehr lieb von ihr, dass sie an uns gedacht hat. Es tut mir sehr leid, dass ich sie nicht kennenlernen konnte. Nicht so richtig«, fügte er leise hinzu. »Omi, du musst mir sagen, wenn ich etwas falsch rede.«
»Rede nur so, wie du willst«, erwiderte sie weich.
»Mir wäre es aber viel lieber, Großvater könnte aufstehen und mit nach Sophienlust kommen. Dort würde er sich viel schneller erholen als in dem Haus hier. So laut sind die Kinder gar nicht. Brüllen tun wir nur, wenn wir einen nicht leiden können. So wie den Satorski.«
Zutiefst erschrocken musste er feststellen, dass dieser Name eine erschreckende Wirkung auf den Großvater ausübte. Hilflos blickte er seine Omi an, als Hubert von Wellentin sich aufrichtete und ihn starr anblickte.
»Satorski«, murmelte er, »Satorski – dieser Lump«, rief er aus und sank keuchend in die Kissen zurück.
Irene von Wellentin klingelte sofort nach dem Arzt. Dominik wich bestürzt zur Tür zurück. »Nun habe ich doch etwas Falsches gesagt, Omi«, jammerte er.
»Vielleicht gerade das Richtige, Nick«, flüsterte sie und eilte zu ihrem Mann, um beruhigend seine Hand zu umschließen.
»Dieser Lump, er wollte mich erpressen«, keuchte Hubert von Wellentin. »Jetzt weiß ich wieder alles. Nein, das Kind braucht es nicht zu hören. Nick, mein Kleiner, kommst du ein andermal wieder?«
Dominik war noch viel zu verstört, um diese Bitte zu verstehen. Er hatte etwas gesagt, was den Großvater schrecklich aufregte, und gerade das hätte er doch nicht tun dürfen. Mami hatte ihn so sehr ermahnt, nur ja rücksichtsvoll zu sein.
Nun kam der Arzt. Irene von Wellentin führte Nick hinaus. »Warte hier, mein Liebling«, sagte sie zärtlich. »Ich glaube, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, das deinem Großvater sehr viel weiterhelfen wird.«
»Meinst du nicht, dass es ihm schaden kann?«, fragte er angstvoll. »Das wollte ich doch nicht, Omi. Er war so nett zu mir, ganz anders als früher. Ich hatte gar keine Angst vor ihm und wollte doch nur alles so erzählen.«
»Es ist schon gut, mein Kleiner. Ich muss jetzt hineingehen. Ich glaube, Großvater hat sich an etwas ganz Wichtiges erinnert.«
»Wenn Mami kommt, kann ich dann mit ihr heimfahren?«, fragte Dominik kleinlaut.
»Sagt vorher Bescheid. Vielleicht will Großvater euch noch einmal sehen.«
Sie ging wieder ins Zimmer zurück, während Dominik sich auf einen Stuhl kauerte und nicht gerade zuversichtlich der weiteren Entwicklung entgegenblickte.
*
»Ja, ich kann mich jetzt erinnern«, murmelte der Kranke. »Ich traf Satorski. Er steckt mit der Klees unter einer Decke, Irene. Sie will die Briefe und er will Geld. Mein Gott, was mir dieser gemeine Kerl anhängen will.«
Erschöpft sank er zurück und schloss die Augen. »Er phantasiert«, flüsterte Irene von Wellentin verzagt.
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube, das sind echte Erinnerungen«, erwiderte er leise. »Nur die Zusammenhänge fehlen. Er ist sehr erregt, aber er wird sich beruhigen und uns mehr sagen. Es ist sehr wichtig, dass er keinen Augenblick allein bleibt.«
Eine Schwester trat ein. »Frau von Wellentin ist gekommen. Sie fragt, ob sie noch etwas für Sie tun könnte, gnädige Frau«, sagte sie leise.
»Denise«, rief da der Kranke aus. »Ich will sie sprechen, ist sie da?«
Der Arzt nickte Irene von Wellentin zu. Niedergeschlagen ging sie, um Denise zu holen.
»Geht es Großvater besser?«, fragte Dominik kleinlaut. »Ich habe Mami schon gesagt, dass er sich aufgeregt hat.«
»Nicht deinetwegen, Nick«, sagte sie tröstend. »Hubert möchte dich sprechen, Denise. Würdest du ihm diesen Gefallen erweisen?«
»Selbstverständlich, Mama.« Sie traten gemeinsam an sein Bett.
»Denise, verzeih mir«, flüsterte Hubert von Wellentin. »Nimm dich in acht vor Satorski und pass auf Dominik auf. Ich rede nicht irr. Ich bin nur so erschöpft. Danke, dass du gekommen bist. Satorski ist übel …«, seine Stimme verklang. Er hatte keine Kraft mehr.
*
Unentwegt kreisten diese Worte in Denises Kopf, während sie mit Dominik nach Schoeneich fuhr. Er kauerte still neben ihr, noch immer verstört, obgleich sie ihn zu trösten versucht hatte.
»Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, Nick«, sagte sie, als er wieder tief aufseufzte.
»Der Satorski ist ein Lump, hat Großvater gesagt. Ich habe ihn ja gleich nicht gemocht. Aber nun regt er sich auf und wird vielleicht gar nicht mehr gesund.«
»Er wird schon wieder gesund. Er ist jetzt noch sehr erregt, aber der Arzt ist ja bei ihm.«
»Wenn der Satorski noch mal kommt, lassen wir ihn aber gar nicht mehr herein, nicht wahr, Mami? Vielleicht hat er Großvater auf den Kopf geschlagen.«
»So was sag besser nicht, Nick«, mahnte sie.
»Aber wenn er doch ein Lump ist, dann tut er so was sicher auch.«
Könnte sich Hubert von Wellentin mit jemandem gestritten haben?, überlegte nun auch Denise. Es muss ja nicht gerade Satorski gewesen sein. Aber da nichts auf einen Einbruch schließen ließ, musste es doch eine Erklärung für diesen tätlichen Angriff geben. Dass er mit einem Briefbeschwerer niedergeschlagen worden war, wusste man ja mittlerweile.
»Was hat Großvater noch zu dir gesagt?«, wollte Nick nun wissen.
Das wollte sie ihm lieber nicht erzählen, damit er nicht noch aufgeregter wurde.
»Dass wir uns nun vertragen wollen«, redete sie sich heraus.
»Na, Gott sei Dank«, seufzte er. »Wenigstens was Gutes. Mir ist das auch lieber so, schon Omis wegen. Er wollte viel über Sophienlust und die Kinder hören. Und ich habe ihm gesagt, dass er sich bei uns ganz bestimmt besser erholen kann als in dem scheußlichen Krankenhaus. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir nicht immer so schreien, nur wenn wir einen nicht mögen wie den Satorski. Ich möchte zu gern wissen, warum er ihn auch nicht leiden kann.«
Was zwischen den beiden Männern vorgefallen war, hätte Denise auch zu gern gewusst. Nick hatte sie angesteckt mit seinen vagen Vermutungen. Aber auch sie fragte sich, ob es gut war, wenn Hubert von Wellentin sich wieder an alles erinnern konnte. Würde er dann nicht rückfällig werden und in seine frühere Selbstgefälligkeit verfallen?
»Jetzt erholen wir uns erst mal von dem Schrecken«, meinte Nick erleichtert, als sie Schoeneich erreichten.
Denise brauchte nichts zu erzählen, denn Nick konnte es gar nicht mehr erwarten, die Ereignisse des Nachmittags, aufregend wie sie waren, zum Besten zu geben.
Seine Schilderungen gingen bis in die Details und Sascha wie auch Andrea hörten ihm so gespannt zu, dass sie gar nicht merkten, wie Alexander und Denise leise ins Nebenzimmer gingen.
»Was weißt du von diesem Satorski, Alexander?«, fragte Denise.
»Erspar es mir bitte, über diesen Kerl zu reden«, erwiderte er. »Du hast mir nicht gesagt, dass er in Sophienlust war.«
»Ich hätte es dir schon noch gesagt, jedoch nicht am Telefon. Wie du gehört hast, haben die Kinder sehr schnell für seinen Abzug gesorgt und ich war so ›freundlich‹ zu ihm, dass er es nicht noch einmal versuchen wird.«
»Du kennst ihn nicht. Wenn er hinter einer Frau her ist, lässt er nicht locker. Und wenn er mir damit noch eins auswischen kann, wird er nichts unversucht lassen.«
»Aber schließlich liegt das doch ganz bei der Frau.«
»Er kann sehr charmant sein«, stieß er gereizt hervor.
»Alexander«, meinte sie kopfschüttelnd, »kennst du mich so wenig?«
»Ich habe ein ungutes Gefühl, seit er hier wieder aufgetaucht ist.«
»Willst du mir nicht sagen, was er von dir wollte?«
»Jetzt nicht«, flüsterte er mit einem Blick zum Nebenzimmer.
Dominik war nun wieder abgelenkt. Im Spiel mit Sascha und Andrea vergaß er den Zwischenfall. Der Gesprächsstoff ging ihnen nie aus. Man konnte fast meinen, sie hätten sich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, so viel hatten sie sich immer zu erzählen. Von der Schule, von den Kindern und Hunden. Mit Lora mussten sie schwatzen und ihr von Habakuk erzählen, der lange nicht so phlegmatisch war wie sie.
Marie hatte ihr Bestes getan, um mit Magdas Kochkunst konkurrieren zu können, dennoch wollte es Denise und Alexander nicht so recht schmecken.
Dann verschwanden die Kinder ganz von selbst in ihrem Spielzimmer und ließen sie rücksichtsvoll allein.
Das Gespräch kam wieder auf Satorski. Was Claudia für sich behalten hatte, erfuhr Denise nun von Alexander.
»Er ist ein hemmungsloser Bursche«, stellte er aufgebracht fest. »Jetzt hat er sein Vermögen vergeudet und versucht nun auf alle mögliche Art zu Geld zu kommen.«
»Erpressung?«, fragte sie beklommen.
»Auch das. Doch da ist er bei mir an der falschen Adresse. Mir wollte er gewisse Briefe abhandeln. Das Geld dafür muss aus einer anderen Quelle stammen.«
»Er wollte sie dir abkaufen?«, fragte sie atemlos.
»Man kann es so nennen. Ich sage ja, er ist skrupellos und er weiß genau, wie er mich einzuschätzen hat. Er weiß, dass ich der Kinder wegen schweige.« Er betrachtete Denise mit einem langen Blick. »Bis heute glaubte ich, dass Wellentin sein Hintermann ist, aber nach Nicks Schilderungen scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Anscheinend hat er ihn sich auch als Opfer auserkoren.«
»Würdest du ihm zustrauen, dass er gewalttätig wird, wenn er ein Ziel erreichen will?«
Er sah sie entsetzt an. »Meinst du, er hätte Wellentin auf dem Gewissen?«
»Es ist Nicks Vermutung, aber wenn ich so recht darüber nachdenke, scheint sie mir gar nicht so abwegig zu sein.«
»Guter Gott«, stöhnte Alexander, »dann wäre der Skandal perfekt.«
Ihre Hände verschlangen sich ineinander. »Da ist noch etwas, was ich dir nicht verschweigen möchte, Liebster«, flüsterte sie. »Mama sagte mir, er hätte davon gesprochen, dass die Baronin Klees dahinterstecke.«
Seine Hand fuhr zum Mund, als wolle er einen Schrei ersticken. »Nein, das nicht, Denise. Zu solchen Mitteln kann sie nicht greifen. Das kann sie doch den Kindern nicht antun.« Er starrte blicklos vor sich hin. »Wie konnte ich mich nur hinreißen lassen, von diesen Briefen zu sprechen. Ich möchte so gern einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Sie soll uns doch nur in Ruhe lassen, mehr will ich nicht. Sie kann nicht so schamlos sein. Ach, was rede ich da«, fügte er voller Bitterkeit hinzu. »Warum sollte sie besser sein als ihre Tochter? Ich kenne sie doch zur Genüge. Was willst du eigentlich mit einem Mann, der sich ständig selbst täuschen will, Denise?«
»Wenn du dich nur in einem nicht täuschst«, murmelte sie. »Darin, dass du mich liebst. Wir werden über alles hinwegkommen. Die Zeit und unsere Kinder werden uns dabei helfen.«
*
Ein paar Tage schien es, als wäre Hubert von Wellentin wieder in seine Bewusstseinstrübung verfallen, und seine Frau war fast erleichtert darüber.
Als sie dann aber zu ihrem täglichen Besuch kam, saß er aufrecht in seinem Bett und blickte sie mit klaren Augen an.
»Ich muss eine Frage an dich stellen, Irene«, sagte er recht energisch. »Bist du bereit, unsere Ehe weiter aufrechtzuerhalten?«
Sie musste sich erst von ihrer Verblüffung erholen. Zu plötzlich kam ihr diese Frage.
»Ich sehe wieder ganz klar«, fuhr er fort. »Du wolltest dich von mir trennen. Du warst durchaus im Recht. Man kann nicht ungeschehen machen, was nun einmal geschehen ist. Wenn ich dich aber bitte, eindringlich bitte, noch einmal einen Versuch mit mir zu machen, wirst du dann bei mir bleiben?«
»Ich habe mich doch bereits entschieden, Hubert«, erwiderte sie gefasst.
Er nahm ihre Hand und zog sie an die Lippen. »Ich danke dir für dieses Wort. Würdest du es bitte übernehmen, Anzeige gegen Satorski zu erstatten? Ihm habe ich nämlich diese Verletzung zu verdanken. Nein, du brauchst mich nicht so zweifelnd anzusehen. Es stimmt. Ich werde dir alles erzählen. Ich habe ihm einmal eine beträchtliche Summe geliehen – nicht ganz freiwillig, wie ich gestehen muss. Nun wollte er wieder Geld. Ich lehnte es ab. Du wusstest ohnehin alles, die Baronin Klees hatte ich gerade vor die Tür gesetzt. Ich war dabei, mit mir ins Reine zu kommen und wollte mich aus dieser ganzen üblen Geschichte befreien. Ich bin in die Fabrik gefahren, um ein paar Briefe zu holen, die Sybille mir geschrieben hatte, um sie ihrer Mutter zu schicken. Satorski folgte mir, ohne dass ich es bemerkte. Ich hielt die Briefe schon in der Hand, als er plötzlich eintrat. Mich packte die Wut. Ich ging auf ihn los, aber er ist eben gewandter als ich. Er griff nach dem Briefbeschwerer und, bevor ich ausweichen konnte …, aber das weißt du ja.«
»Er hat dich einfach liegen lassen? Du hättest verbluten können«, ächzte sie.
»Ist das deine einzige Sorge?«, fragte er mit einem Anflug von Spott. »Sind die Briefe gefunden worden? Natürlich nicht. Er hat sie mitgenommen. Im Grunde ist es mir gleich, was er damit anfängt, wenn du zu mir hältst und wenn ich mir das bisschen Zuneigung, das Dominik mir vielleicht doch entgegenbringt, nicht verscherze. Aber ich muss ihm ein für alle Mal das Handwerk legen, sonst habe ich keine Ruhe mehr. Er muss merken, dass er ausgespielt hat, dass er nicht noch einmal versucht, sich Denise zu nähern.«
Irene von Wellentin kämpfte mit den Tränen. »Verzeih mir, Hubert, eine Zeit habe ich geglaubt, du hättest ihn auf Denise gehetzt.«
Mit einer bittenden Gebärde ergriff er ihre Hände. »Was muss ich für ein Unmensch gewesen sein, dass du mir das zutrauen konntest. Ein Leben lang war ich ein Egoist. Eigentlich müsste ich Satorski noch dankbar sein, dass er mir auf den Kopf geschlagen hat. Vielleicht hat er mit diesem Schlag meinen Hochmut getötet.« Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht. »Ich habe dir und Denise sehr viel abzubitten«, fuhr er dann fort. »Aber du hast mir inzwischen schon den Weg gewiesen, wie das möglich sein wird.«
»Hubert«, seufzte sie, »ist das deine ehrliche Überzeugung?«
»Es ist eine Erkenntnis«, bestätigte er.
»Sollten wir dann nicht versuchen, diese Geschichte ohne Aufsehen zu bereinigen? Alexander von Schoenecker und seinen Kindern zuliebe? Er hat doch wahrhaftig genug gelitten.«
»Ich fürchte nur, dass Satorski so nicht beizukommen sein wird«, meinte er nachdenklich.
»Ich werde es versuchen.«
»Du?«, fragte er staunend. »Woher nimmst du plötzlich die Kraft?«
Ja, woher nahm sie diese? Ihre Gedanken wanderten nach Sophienlust, zu Denise, Dominik, zu den Kindern. Dort hatte sie die Kraft gefunden, die ihr jetzt half, alles zu überwinden, was so drohend auf sie zugekommen war.
»Wir waren so engstirnig, Hubert«, sagte sie leise. »Ich habe genauso viel falsch gemacht wie du.«
»Du hast es nur rascher eingesehen«, brummte er. »Aber noch ist es hoffentlich nicht zu spät. Nur Mama und Dietmar kann diese Einsicht nichts mehr nutzen.«
*
Wie jeden Mittag fuhr Denise ins Dorf, um die Kinder abzuholen. Heute war ein besonderer Tag. Heute sollte Hubert von Wellentin nach Sophienlust kommen. Er hatte es eilig, denn erst gestern war er aus der Klinik entlassen worden.
Denise musste plötzlich scharf auf das Bremspedal treten. Ein Wagen stand quer auf der Straße und versperrte den Weg. Zuerst glaubte sie an einen Unfall, dann aber musste sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass jemand ihr absichtlich den Weg versperrte und dass dies kein anderer war als Graf Satorski.
Mit einem herausfordernden Lächeln kam er auf sie zu. »Welch ein bezaubernder Zufall«, sagte er frech.
»Zufall? Geben Sie mir sofort den Weg frei!«
»Aber wer wird denn gleich so unfreundlich sein. Was habe ich Ihnen denn getan, bezaubernde Denise? Wenn die Kinder es auch verstanden haben, mich rasch aus Sophienlust zu vertreiben, so möchte ich doch nicht annehmen, dass dies auch in Ihrer Absicht lag.«
»Was Sie annehmen, ist mir völlig gleich. Ich fordere Sie nochmals auf, die Straße freizugeben.«
»Nachdem ich schon so lange auf diesen Augenblick gewartet habe?«, sagte er ironisch. »Ich brenne vor Ungeduld, mich einmal ungestört mit Ihnen unterhalten zu können.«
»Und ich möchte schleunigst weiterfahren. Sind Sie schwerhörig?«, entgegnete sie aggressiv.
»So gefallen Sie mir noch besser«, stellte er gelassen fest. »Nicht die kühle Frau von Wellentin, eher die temperamentvolle Tänzerin Denise Montand. Diese Rolle steht Ihnen bedeutend besser!«
Er kam ihr so nahe, dass sein heißer Atem ihre Wange streifte. Mit einem Gefühl des Ekels, der sich mit wildem Zorn mischte, wich sie zurück.
»Lassen Sie mich in Ruhe«, herrschte sie ihn an. »Ihre berühmte Anziehungskraft auf Frauen verfehlt bei mir jede Wirkung. Ich weiß zu gut Bescheid über Sie, als dass ich auch nur eine Minute mit Ihnen verbringen möchte.«
»Es wird Ihnen kaum etwas anderes übrig bleiben«, lächelte er zynisch. »Spiel doch nicht die Kühle, holde Denise. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns ausgezeichnet verstehen werden.«
Zu ihrem Zorn gesellte sich nun Angst. Immer weiter wich sie zurück, aber er folgte ihr wie ein Raubtier, zum Sprung geduckt, mit gierigen Augen. Sie wollte schreien, kein Laut kam über ihre Lippen.
Er griff nach ihrem Arm, und nun erst merkte sie, wie viel Kraft er hatte.
Verzweifelt wehrte sie sich. Seine Lippen streiften ihre Wange, und es würgte sie. Mit letzter Kraft gelang es ihr, sich aus der Umklammerung zu befreien und sie begann zu laufen, blindlings, stolpernd, die Furcht im Nacken.
Er folgte ihr. Sie wusste nicht, woher die Kraft kam, die ihre Schritte noch schneller werden ließ, aber plötzlich verließen sie die Kräfte. Sie fiel nach vorn und stürzte mit einem Aufschrei auf die Straße. Das Kreischen von Bremsen war das Letzte, was sie vernahm, dann wurde es Nacht um sie.
*
»Na, ihr wartet ja immer noch«, sagte Lehrer Brodmann zu den Kindern. Dominik, Andrea, Robby und Kati, die man versuchsweise jetzt auch mit zur Schule schickte, sahen ihn ängstlich an.
»Mami ist doch sonst immer so pünktlich«, stellte Dominik fest. »Es wird doch nichts passiert sein?«
»Was soll auf unserer kleinen Landstraße schon passieren?«, sagte Lehrer Brodmann beruhigend. »Sie könnte höchstens eine Panne haben, aber dann werden wir es auch bald erfahren. Ich werde einmal in Sophienlust anrufen, ob sie aufgehalten worden ist.«
»Mami lässt sich nicht aufhalten, wenn sie uns von der Schule abholen muss«, erklärte Nick beharrlich. »Kann ich auch mal bei meiner Omi anrufen?«
Zuerst wollte es Lehrer Brodmann aber doch auf dem Gut versuchen. Wenn es auch ungewöhnlich war, einmal konnte es doch vorkommen, dass Frau von Wellentin sich verspätete.
Claudia war am Telefon und sie meinte, Frau von Wellentin sei schon über eine halbe Stunde weg.
Das stimmte Herrn Brodmann nun doch besorgt. Er zog jedoch die Möglichkeit in Betracht, dass sie auf halbem Wege eine Panne hatte und wenn nicht ausnahmsweise mal ein anderer Wagen vorbeikam, konnte sie kaum auf Hilfe rechnen.
Dominik ließ sich mit dieser Erklärung nicht beruhigen. So wählte Lehrer Brodmann die Nummer von den alten Wellentins, wie sie jetzt nun einmal hießen.
Aufgeregt redete Dominik auf seine Omi ein. Zuerst verstand Irene von Wellentin gar nicht, was er meinte, aber dann wurde sie auch besorgt.
»Wir wollen ohnehin gleich losfahren«, beruhigte sie Dominik. »Wir holen euch ab, und wenn Mami eine Panne hatte, werden wir sie unterwegs ja treffen.«
»Es ist noch nie passiert, dass Denise nicht pünktlich an der Schule war«, sagte sie zu ihrem Mann. »Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, Hubert.«
Früher hätte er sie ausgelacht. Jetzt war er weit entfernt davon. Allerdings verriet er ihr seine Gedanken nicht, aber sie kamen der Wahrheit ziemlich nahe.
Solange Satorski in der Nähe war, fand er keine Ruhe. Deswegen war er auch so schnell aus der Klinik heimgekehrt, deshalb wollte er auch so rasch schon mit Denise ein offenes Wort sprechen.
»Fahren wir«, erklärte er schnell, und Irene sagte dem Chauffeur Bescheid.
*
»Fein, dass du schon so früh kommst, Papi«, begrüßte Sascha seinen Vater. »Wir hatten heute schon eine Stunde früher Schluss. Wenn wir uns beeilen, treffen wir Tante Isi und die Kinder unterwegs. Dann könnten wir eigentlich gleich mit in Sophienlust essen.«
»Wir können uns doch nicht selber einladen«, meinte Alexander lächelnd.
»Freilich können wir das. Sie haben immer genug. Ich habe heute ganz großen Hunger.«
»Na, dann beeilen wir uns«, meinte Alexander, der gar nichts dagegen einzuwenden hatte, nach Sophienlust zu fahren.
Sie kamen schnell voran. Kurz nach der Kreuzung und vor der Kurve schrie Sascha plötzlich auf, und instinktiv trat Alexander auf die Bremse. Der Wagen kam knapp vor der regungslosen Gestalt zum Stehen, und Sascha hatte Denise schon erkannt.
»Tante Isi«, schrie er, »oh, es ist Tante Isi, Papi!«
Alexander wusste nicht, wie er aus dem Wagen kam. Doch als er sich über sie beugte, um zu sehen, ob sie verletzt sei, schrie Sascha erneut.
»Der Satorski, Papi, da rennt der Satorski!«
Unzählige Gedanken wirbelten in Alexanders Kopf herum, aber die Angst um Denise war stärker als alles andere.
Wieder näherte sich Motorengeräusch. Ein schwerer dunkler Wagen kam angebraust und kam vor der Kreuzung zum Stehen, als eben der Sportwagen heruntergeschossen kam.
Niemand wusste später so recht zu sagen, wie sich alles abgespielt hatte. Dominik hatte seine Mutter erkannt, Hubert von Wellentin Satorskis Wagen, dem jetzt der Weg versperrt war. Er rief dem Chauffeur etwas zu, was niemand verstand. Satorski war momentan irritiert, sprang dann aber aus seinem Wagen heraus, als er Hubert von Wellentin erkannte. Doch bevor er flüchten konnte, hatte der baumstarke Anton ihn bereits gepackt und hielt ihn fest.
Hubert von Wellentin trat auf ihn zu und schlug ihm zweimal kräftig in das verzerrte Gesicht.
»Das ist für den Schlag, den Sie mir versetzt haben«, stieß er zornig hervor, »und Gnade Ihnen Gott, wenn Sie noch Schlimmeres auf Ihr Gewissen geladen haben.«
*
Zuerst hatte Claudia überlegt, als der Anruf von Lehrer Brodmann kam, dann rief sie die Polizeiwache an.
Frau von Wellentin müsse eine Panne oder einen Unfall gehabt haben, brauchte sie nur zu sagen, als dort alles mobil gemacht wurde. Für Denise von Wellentin war jeder sofort bereit, die Mittagspause zu vergessen.
So traf zu aller Erleichterung wenig später schon der Streifenwagen ein und gleich danach auch der Rettungswagen.
Den Polizeibeamten wurde Satorski übergeben, und Hubert von Wellentin ließ keinen Zweifel daran, dass dessen Unschuldsbeteuerungen bloße Lüge wären.
Behutsam wurde Denise auf die Trage gelegt. Alexander fuhr mit ihr, während sich der verstörte Dominik in die Arme seiner Großmutter flüchtete, um die sich die anderen Kinder ängstlich geschart hatte.
So unerwartet in ein aufregendes Geschehen gedrängt, bewies Irene von Wellentin eine bewundernswerte Haltung. Für sie kam es jetzt nach dem ersten Schrecken nur darauf an, den Kindern fürchterliche Überlegungen zu ersparen.
Die Auseinandersetzung zwischen Hubert von Wellentin und Satorski hatte keines so recht mitbekommen, da alle viel zu aufgeregt waren.
Sascha kauerte noch immer im Wagen seines Vaters und hatte die Hände vor sein Gesicht geschlagen.
»Beinahe hätten wir Tante Isi überfahren«, schluchzte er, als Irene von Wellentin ihn tröstend in die Arme nahm. »Was ist mit Tante Isi?«
Das wusste niemand, aber alle hofften, dass es nicht so schlimm war, wie es ausgesehen hatte.
»Fahren Sie meine Frau und die Kinder nach Sophienlust«, erklärte Hubert von Wellentin dem Chauffeur. »Ich habe noch etwas zu erledigen.«
»Du darfst noch nicht fahren, du bist noch zu schwach«, protestierte seine Frau, als er sich schon ans Steuer von Alexander von Schoeneckers Wagen setzte.
»Dazu bin ich nicht zu schwach«, knurrte er. »Der Kerl soll mir nicht noch einmal entwischen.«
»Warum ist Mami nur ausgestiegen?«, fragte Dominik, als er den Wagen seiner Mutter mit offener Tür auf der schmalen Straße stehen sah.
Irene von Wellentin konnte es sich denken, auf welche Weise Denise zum Aussteigen gezwungen worden war, als sie die andere Autospur gewahrte.
»Vielleicht war etwas am Wagen nicht in Ordnung«, sagte sie jedoch. »Sie wollte Hilfe holen und ist zu schnell gelaufen.«
»Und dann ist sie über die Böschung auf die Straße gefallen«, fuhr Sascha sinnend fort. »Aber wieso war der Satorski da?«
»Er ist ein gemeiner Lump, hat Großvater gesagt«, murmelte Dominik. »Und er hat ihn gehauen«, fügte Kati hinzu, »ich hab’s gesehen.«
»Ich möchte so gern wissen, wie es Mami geht«, flüsterte Dominik.
»Papi ist ja bei ihr. Er wird schon auf sie aufpassen«, tröstete ihn Andrea. »Wieso waren wir eigentlich alle auf einmal da?«
»Und sogar die Polizei«, meldete sich nun erstmals Robby zu Wort.
»Jetzt werdet ihr euch erst einmal beruhigen«, meinte Irene von Wellentin. Und das hatte sie auch nötig.
*
»Denise, mein Liebes«, flüsterte Alexander von Schoenecker, als sie die Augen aufschlug. Glücklicherweise hatte sie außer einigen Prellungen und Hautabschürfungen keine Verletzungen davongetragen.
In ihren Augen stand Furcht, doch sie schwand, als sie seine Lippen an ihrer Wange fühlte.
»Was hat er dir getan?«, fragte Alexander heiser.
Ihre Lippen bewegten sich, aber noch brachte sie keinen Laut hervor. Sie schüttelte nur leicht den Kopf.
»Er wird es mir büßen«, sagte Alexander tonlos.
Ein trockenes Schluchzen schüttelte sie. Ihre Finger tasteten sich zu seinem Gesicht.
»Du bist da«, kam es bebend über ihre Lippen.
»Beinahe hätte ich dich überfahren«, murmelte er. »Aber Sascha schrie, und ich bremste. Mein Gott, es wäre nicht auszudenken.«
»Nichts denken«, raunte sie. »Halt mich fest, Alexander, ganz fest.«
Für alle Zeiten, dachte er. Was würde ich lieber tun als dies. Zärtlich streichelten seine Lippen ihr Gesicht und blieben auf ihrem Mund liegen.
»Ich möchte heim«, murmelte sie.
»Ja, mein Liebling, ich bringe dich nach Hause. Aber erst musst du dich ein wenig erholen.«
»Das kann ich daheim besser. Die Kinder werden sich Sorgen machen. Wer wird sie wohl von der Schule abgeholt haben?«
»Die Großeltern«, meinte er beruhigend.
»In Sophienlust ist es so friedlich«, meinte sie gedankenvoll. »Warum gibt es nur Menschen, die diesen Frieden stören müssen?«
»Vielleicht, damit wir uns des Friedens bewusst werden, Liebes«, erwiderte er leise.
*
Wochen waren seit jenem Tag vergangen, der seinen Schrecken für Denise noch immer nicht ganz verloren hatte.
Der November, dieser düstere Monat, neigte sich seinem Ende entgegen, und schon stand die Adventszeit vor der Tür.
Der Schock, der den Kindern lange in den Gliedern gesessen hatte, wich jetzt langsam einer stillen Vorfreude. Ja, seltsam still war es in Sophienlust zugegangen während dieser Wochen und dies nicht nur, weil Großvater Wellentin sich hier erholen wollte.
So ganz genau wussten die Kinder nicht, was und wie sich alles abgespielt hatte, obwohl man es ihnen zu erklären versucht hatte.
Immer wieder schlich sich Dominik vom Spiel weg und sah nach seiner Mami, um sich zu erkundigen, ob auch wirklich alles in Ordnung sei. Von der Schule wurden sie jetzt stets von Anton abgeholt.
Und jedes Mal hielt Hubert von Wellentin bereits nach ihnen Ausschau, wenn sie heimkamen. Im Dorf stand man fast kopf, als bekannt wurde, dass der hochmütige Hubert von Wellentin sich mit seiner Schwiegertochter versöhnt hatte. Das war noch viel aufregender als die Tatsache, dass man dem Grafen Satorski den Prozess machte.
Er kam, wie man so schön sagte, mit einem blauen Auge davon, weil niemand daran interessiert war, die Dinge aufzubauschen. Jeder der Beteiligten war froh, dass er spurlos von der Bildfläche verschwand, nachdem man seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt hatte.
Am ersten Adventssonntag waren sie alle in Sophienlust versammelt. Im Schein der ersten Kerze sangen die Kinder mit ihren hellen Stimmen ihre Lieder. Die Erwachsenen stimmten ein, nur Hubert von Wellentin saß still da und ließ seine Augen von einem zum anderen schweifen.
»Warum singst du nicht mit, Großvater?«, fragte Dominik.
»Ich konnte noch nie singen«, brummte er.
»Versuch es doch mal, vielleicht kannst du es jetzt? Onkel Alexander singt auch manchmal falsch, aber das macht gar nichts.«
Und das Wunder geschah. Hubert von Wellentin probierte es. Es klang zwar so, als wäre seine Stimme eingerostet, aber beim zweiten Lied ging es schon ein wenig besser.
»Es wird schon noch«, meinte Dominik aufmunternd. »Bis Weihnachten üben wir fleißig, dann lernst du es schon.«
»Ich möchte wissen, was ihr mir noch alles beibringt«, brummte sein Großvater.
Dass es auch noch eine Fabrik gab, um die er sich kümmern musste, wollte Dominik gar nicht so recht gefallen. Und schon gar nicht, dass sie nun wieder in ihrem Haus wohnten und nur zu Besuch nach Sophienlust kamen. Allerdings geschah das sehr häufig, und jedes Mal wurden sie stürmisch begrüßt.
»Du musst es mir schon sagen, wenn es dir nicht recht ist, Denise«, meinte Hubert von Wellentin mit belegter Stimme. »Verdient habe ich deinen Großmut wahrhaftig nicht.«
Sein Blick ruhte forschend auf ihrem schönen Gesicht. War nicht doch ein Stachel in ihr zurückgeblieben?, fragte er sich oft.
»Ich bin froh, dass du gern kommst, Papa«, erwiderte sie herzlich. »Es ist schön, dass wir das erste Weihnachtsfest in Sophienlust gemeinsam feiern können.«
»Sich selbst zu bekriegen, ist der schwerste Krieg«, murmelte er.
»Sich selbst zu besiegen, ist der schönste Sieg«, vollendete sie.
Tief beugte er sich über ihre Hände. »Ich danke dir, Denise«, flüsterte er mit erstickter Stimme. »Der Schlag auf den Kopf hat mir gutgetan.«
»Wer hätte das je gedacht«, staunte Edith Gerlach, wenn er die kleine Petra auf den Schoß nahm. »Was habe ich diesen Mann gefürchtet.«
»Nicht nur Sie, Edith«, meinte Denise gedankenvoll. »Jeder hat ihn gefürchtet und nun erkennt er, wie viel besser es ist, geliebt zu werden.«
*
Was Hubert von Wellentin versäumt hatte, solange Katis Großvater lebte, versuchte er nun auch noch gutzumachen. Der alte Ebert merkte nichts davon, dass er ein schönes Grab bekommen hatte, aber wenn Kati es besuchte, meinte sie, dass er sich darüber wohl sehr gefreut hätte. Unter hohen Tannen lag es, und ein schön geschnitztes Holzkreuz zierte es.
Nun wurde es von einer dünnen Schneedecke verhüllt wie auch das Grab von Sophie von Wellentin, das gar nicht weit entfernt lag.
Katis Eltern hatten sich jedoch bis zum heutigen Tage noch nicht gemeldet. Das Kind fragte nicht danach, doch Denise machte sich Gedanken. Jeden Tag, wenn die Post kam, schaute sie zuerst, ob ein Brief aus Australien dabei war. An diesem klaren Wintermorgen war dies nun der Fall.
Claudia beobachtete sie nachdenklich. »Nun ist er endlich da und jetzt zögerst du, ihn zu öffnen«, stellte sie fest. »Mir brauchst du nichts zu sagen, Isi, ich weiß, was du denkst.«
Dieser Brief konnte die baldige Trennung von Kati bedeuten und für das Kind eine einschneidende Veränderung. Für sie war Sophienlust nach wie vor ein Paradies. Ein Paradies, aus dem sie nicht vertrieben werden wollte. Sie sprach nie von ihren Eltern, sie fragte nicht nach ihnen. Wenn ein Kind, das so einsam wie Kati herangewachsen war, vollends glücklich sein konnte, dann war sie es.
Denise schlitzte den Umschlag auf. Ihre Finger waren kalt, als sie den dichtbeschriebenen Bogen herausnahm.
Sehr geehrte Frau von Wellentin! Auf Umwegen erhielt ich die schmerzliche Nachricht vom Tode meines Vaters. Ihrem Schreiben konnte ich entnehmen, dass Sie sich meiner Tochter Kati angenommen haben. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Leider bin ich nicht in der Lage, Ihnen Geld zu schicken und noch weniger, Kati zu mir zu nehmen. Ich habe schwere Jahre hinter mir. Meine Ehe zerbrach. Ich wollte dies meinem Vater nicht schreiben. Nun endlich habe ich eine Stellung gefunden, die mir die Hoffnung gibt, einmal bessere Tage kennenzulernen.
Wie Sie schrieben, hat Kati sich gut eingelebt in Sophienlust. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn sie dort bleiben könnte. Sie wäre in diesem Land nicht glücklich, da ich es auch nicht bin. Wenn ich nur könnte, würde ich in die Heimat zurückkehren, aber ich werde noch lange arbeiten müssen, um das Geld dafür zusammenzubekommen. Vielleicht werden Sie nicht verstehen können, dass eine Mutter auf ihr Kind verzichten kann, aber mir bleibt nur die Hoffnung, dass es Kati dort besser geht, als es hier der Fall sein würde. Gott schütze Sie für Ihre Güte!
Und darunter stand verwischt, als wären Tränen darauf gefallen: Wie mir wirklich ums Herz ist, kann ich nicht schreiben.
Stumm reichte Denise den Brief Claudia hinüber. »Die beste Lösung für das Kind«, meinte diese ruhig.
»Aber für die Mutter?«, bemerkte Denise sinnend. »Man muss zwischen den Zeilen lesen. Da ziehen sie hinaus in die Welt und erhoffen sich das große Glück. Und was bleibt am Ende?«
»Kati geht es gut, das ist die Hauptsache. Wir brauchen ihr ja nichts zu sagen. Sie fragt sowieso nicht. Sie kann sich ja gar nicht mehr an ihre Eltern erinnern.«
»Ich versuche, mich in die Lage ihrer Mutter zu versetzen. Man müsste ihr die Chance geben, zurückzukommen.«
»Weiß man denn, ob sie es wirklich will? Papier ist geduldig.«
»Sei nicht so hart.«
»Ich habe nicht viel übrig für Mütter, die ihre Kinder im Stich lassen.«
»Ich habe nicht vergessen, wie das Leben mit mir umgesprungen ist. Fast kann ich es nicht glauben, dass noch kein Jahr vergangen ist, seit wir in Sophienlust sind«, meinte Denise gedankenvoll.
»Du hast jedenfalls für Nick alles getan, was du nur tun konntest. Niemand weiß es besser als ich«, erwiderte Claudia.
Doch Denise hatte schon einen Entschluss gefasst. Sie wollte mit ihrem Schwiegervater sprechen und war sicher, dass sie ein offenes Ohr finden würde.
Man musste Hanne Ebert eine Chance geben. Wenn sie den ehrlichen Wunsch hatte, in die Heimat zurückzukehren, würde sie diese Chance nutzen. Kati aber sollte unbeschwert bleiben, bis sie darüber Gewissheit hatten.
*
Auch Alexander von Schoenecker hatte an diesem Tag einen wichtigen Brief bekommen. Seine Augenbrauen schoben sich zusammen, als er dem Absender entnahm, dass es sich um den Anwalt der Baronin Klees handelte.
Nicht ein einziges Wort hatte er von ihr gehört, seit sie an jenem Tag, als Sascha verschwunden war, sein Haus verlassen hatte. Zur Affäre Satorski hatte sie keine Stellung bezogen. Ihr Anwalt hatte ihm nur mitgeteilt, dass sie sich auf Reisen befände.
Weihnachten stand vor der Tür. Wollte sie nun wieder einen Versuch machen, sich den Kindern zu nähern? Aber über den Anwalt? Genauso unschlüssig, wie Denise den Brief aus Australien in den Händen gehalten hatte, betrachtete er nun diesen. Dann riss er ihn kurz entschlossen auf.
Seine Augen weiteten sich, als er die wenigen Zeilen las. Ich habe die traurige Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass Baronin Klees an den Folgen einer Virusgrippe verstarb. Beigefügt erhalten Sie die Abschrift ihres Testaments.
Sie ist tot, dachte er und trat ans Fenster. Weit öffnete er die Flügel und ließ die kalte klare Winterluft hereinströmen. Das Lachen der Kinder tönte aus dem Park herauf. Sie lieferten sich eine lustige Schneeballschlacht.
Lacht, lacht, freut euch eures Lebens, dachte er. Die Zeit heilt alle Wunden. Man muss Geduld haben.
Maries Stimme riss ihn aus seiner Versunkenheit. »Sie möchten rasch zu Dr. Baumgarten kommen, Herr von Schoenecker. Es geht los. Herr Doktor kann die Buben nicht mehr nach Sophienlust bringen.«
Ein Mensch ist gestorben, ein Kind wird geboren, ging es Alexander durch den Sinn.
»Sascha, Andrea«, rief er, »wir müssen Frieder und Axel nach Sophienlust bringen.«
Sie kamen mit roten Wangen und glänzenden Augen hereingestürzt. »Ist das Baby schon da?«, fragten sie wie aus einem Munde. »Es wird ja Zeit, damit es Weihnachten mitfeiern kann.«
Eines Tages werden sie es erfahren, dass sie keine Großmutter mehr haben, dachte er. Nicht heute, nicht vor Weihnachten. Und als er die Papiere in seine Schreibtischschublade schob, fiel sein Blick auf die Zeilen: Mein gesamtes Vermögen soll somit zu gleichen Teilen folgenden Stiftungen zufallen: …
Gott sei Dank, dachte er, die Kinder brauchen ihr Geld nicht zu nehmen.
*
»Glaubst du, dass wir ein Schwesterchen bekommen, Tante Isi?«, wisperte Frieder. »Mami hat es uns versprochen.«
»Sie hat vielleicht gesagt«, mischte sich Axel ein. »Warum weiß man das vorher nicht, Tante Isi?«
»Damit es eine richtige Überraschung ist.«
»Die Huber-Mutter kann alles voraussehen«, mischte sich Dominik ein. »Lena hat’s gesagt. Es wird ein glückliches Jahr für Sophienlust werden, hat sie prophezeit.«
Andrea sah ihn bewundernd an. »Was heißt prophezeit?«, fragte sie. »Warum bist du bloß so schrecklich schlau, Nick? Ich habe das Wort noch nie gehört.«
Er wehrte bescheiden ab. »Lena hat es mir auch dreimal vorgesagt, bis ich es verstanden habe. Die Huber-Mutter weiß, dass nächstes Jahr in Sophienlust die Hochzeitsglocken läuten werden.«
»Das weiß ich auch«, meinte Andra enttäuscht. »Claudi heiratet doch.«
»Aber sie sollen zweimal läuten«, meinte Nick geheimnisvoll.
»Für wen denn sonst noch?«, fragte Sascha neugierig.
»Das hat sie nicht gesagt«, erwiderte Nick kleinlaut.
»Vielleicht hört sie doppelt«, meinte Andrea. »Die Huber-Mutter ist doch schon so alt.«
»Die kann doch gar nicht mehr richtig hören«, überlegte Sascha.
»Sie hört doch auch nicht voraus. Sie sieht bloß voraus«, stellte Nick fest. »Ach, mir ist das zu dumm. Ich möchte lieber wissen, ob Tante Babs ihr Baby schon bekommen hat.«
»Wenn es noch lange dauert, Papi, könntest du dann nicht mal die Huber-Mutter fragen?«, wandte sich Andrea an ihren Vater.
»Wir werden es noch erwarten können«, brummte er.
»Ich werde Lena mal fragen. Vielleicht hat die Huber-Mutter ihr gesagt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird«, erklärte Dominik.
»Da bin ich aber gespannt«, meinte Sascha.
Dominik kam rasch zurück. »Es wird ein Mädchen«, schrie er triumphierend. »Das hat die Huber-Mutter schon von Anfang an gesagt. Und wenn das stimmt, dann läuten nächstes Jahr auch zweimal die Hochzeitsglocken.«
Sascha und Andrea verharrten in ehrfürchtigem Schweigen. Alexander von Schoenecker aber dachte: Hoffentlich läuten sie für uns, Denise.
Da stand sie auch schon in der Tür, als hätten seine Wünsche sie herbeigezaubert.
»Es ist ein Mädchen«, sagte sie leise, und ein kleines, glückliches Lachen kam über ihre Lippen. »Wisst ihr, wie es heißen soll?«
»Denise natürlich«, meinte Andrea wie aus der Pistole geschossen.
Denises und Alexanders Augen versanken in einem langen Blick. Drei Augenpaare betrachteten sie nachdenklich.
»Die Huber-Mutter hat recht«, seufzte Dominik erleichtert auf.
»Du liebe Güte, was hat sie denn mit Barbaras Baby zu tun?«, fragte Denise.
»Es ist nicht nur Barbaras Baby«, protestierte Andrea. »Es gehört Onkel Werner ebenso.«
»Es ist unser Schwesterchen«, riefen Frieder und Axel im Duett.
Jeder hatte etwas zu sagen, und die Stimmen schwirrten durch den Raum. Alexander aber beugte sich zu Denise herab und sagte leise: »Ob sich unsere Kinder auch einmal so freuen werden, wenn wir ein Baby bekommen, Liebes?«
Ihre Augen leuchteten sehnsuchtsvoll. »Lass uns nicht zu weit vorausdenken, Alexander«, flüsterte sie.
»Die Huber-Mutter hat gesagt, dass Barbaras Kind ein Mädchen wird«, erwiderte er gedankenvoll. »Sie hat auch gesagt, dass nächstes Jahr in Sophienlust zweimal die Hochzeitsglocken läuten.«
»Und was wird aus den Kindern werden?«, fragte sie mit belegter Stimme.
»Es wird sich alles finden. Ich glaube an unser Glück, Denise. Bitte, glaub du auch daran.«
*
Dass die Baronin Klees gestorben war, erfuhr Denise erst am nächsten Tag.
»Die Kinder werden sich wundern, wenn sie nicht einmal ein Geschenk von ihr bekommen, Alexander«, meinte sie, als er sagte, dass er es ihnen noch verschweigen wollte.
»Sie werden jeder ein Geschenk bekommen«, entgegnete er entschlossen. »Diese Geschenke kommen ja vom Christkind«, fügte er mit einem flüchtigen Lächeln hinzu. »Für sie ist es doch die größte Freude, dass wir mit euch feiern dürfen.«
»In einer großen Gemeinschaft. Hast du das auch bedacht, Alexander?«
»Dir zuliebe könnte ich mich an ein paar Dutzend Kinder gewöhnen, Denise«, flüsterte er zärtlich.
»Ohne daran zu denken, dass sie andere Väter und andere Mütter haben?«, fragte sie gedankenvoll.
Er legte seine Hand auf ihre Schulter. »Schau dir Frau Trenk an und Edith Gerlach. Wären sie nicht beide geeignet, deine Pflichten zu übernehmen?«
»Gewiss«, nickte sie.
»Es geht dir um Sophienlust?«, fragte er mit schwerer Stimme.
Sie machte eine abwehrende Handbwegung. »Es bliebe Nick doch immer erhalten, aber er bleibt ein Wellentin und ich würde dann eine Schoenecker.«
»Woran du alles so denkst«, murmelte er.
»Das muss man doch, wenn man wichtige Entscheidungen trifft. Meinst du, dass wir alles auf einen Nenner bringen können, Alexander?«
Er zog sie an sich. »Ich glaube es schon. Es gehört ein Teil Mut dazu, doch was mich betrifft, so habe ich den Mut.«
Wie stark sein Herz klopfte! Sie fühlte sich geborgen in seinen Armen. Ein Leben ohne ihn? Sie konnte es sich nicht mehr vorstellen.
Sie dachte an jenen Tag, an dem Sophie von Wellentins Testament eröffnet wurde, an dem sie sich zum ersten Mal begegneten. Hatte es da in ihr auch nur den winzigsten Gedanken gegeben, dass sie noch einmal lieben könnte?
Aber es war eine andere Liebe als jene, die sie für Dietmar empfunden hatte, eine bewusste und auch opferbereite Liebe, die sie nicht blind und taub machte gegen die Umwelt.
»Lassen wir das Jahr verstreichen, Liebster«, sagte sie weich. »Ich habe ein Vermächtnis zu erfüllen und will mit gutem Gewissen sagen können, dass ich alles getan habe, Sophie von Wellentins Wunsch in die Tat umzusetzen. Es ist erst ein Anfang gemacht.«
»Sie hat dir nicht zur Auflage gemacht, dein persönliches Glück zu opfern, Denise. Sie hatte etwas gutzumachen an dir und Dominik, und ich glaube, dass Hubert und Irene jetzt ebenso denken. – Lass mich bitte nicht mehr zu lange warten, Liebste. Die Zeit vergeht so schnell.«
*
Ja, das konnte man wohl sagen. Die Zeit eilte dahin. Ein wunderschönes Weihnachtsfest hatten sie alle gemeinsam in Sophienlust gefeiert. Sogar die Brachmanns waren gekommen, um sich an dem Jubel der Kinder zu erfreuen.
Alle erklärten einstimmig, dass es das schönste Weihnachtsfest ihres Lebens gewesen sei, und Nick meinte, dass Susi niemals mit nach Johannesburg gegangen wäre, wenn sie das miterlebt hätte.
Und ebenso schön wurde dann der Jahreswechsel, als die Böllerschüsse krachten, die Raketen unter begeisterten Ausrufen zum Himmel zischten, und die Glocken das neue Jahr einläuteten.
Lutz hielt Claudia im Arm. Für sie würde dieses neue Jahr den Beginn ihres gemeinsamen Lebens bringen. Sie wusste es. Ihnen sollten im Frühjahr die Hochzeitsglocken läuten.
Alexander und Denise standen zwischen den Kindern, und Irene von Wellentin sah zu ihnen hinüber.
»Sie sind füreinander geschaffen«, sagte sie zu ihrem Mann.
Er warf ihr einen irritierten Blick zu. »Alexander und Denise? Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen könnte.«
»Was haben wir uns einmal versprochen, Hubert?«, flüsterte sie. »Wir wollen niemals wieder ungerecht sein. Sie ist noch so jung, und schon einmal haben wir ihr das Glück nicht gegönnt. Vergiss es nicht. Wir haben ihr so viel zu verdanken.«
»Du hast ja recht«, beruhigte er sie. »Ich bin ein anderer Mensch geworden. Wir werden Nick ja nicht verlieren.«
Nick hatte nur seinen Namen verstanden, aber mit seinem strahlenden Lachen wandte er sich seinen Großeltern zu.
»Es ist das erste Mal, dass ich den Anfang eines neuen Jahres mit begrüßen darf«, sagte er. »Ist es nicht wunderschön, dass wir eine so große Familie sind?«
»Nun kommt noch Tante Isis Geburtstag und dann ist bis zu Claudias Hochzeit nichts mehr«, meinte Andrea tiefsinnig. »Was schenken wir Tante Isi, Papi?«
»Denkt ihr euch etwas aus. Ich denke mir auch etwas aus«, erwiderte er.
»Etwas ganz Schönes? Verrätst du uns kein Sterbenswörtchen?«
»Nein, ich verrate nichts.«
Sie versank eine Weile in Schweigen. »Weißt du, was ich komisch finde? Eigentlich macht es mir ja nichts aus, aber Großmama schreibt gar nicht mehr. Welche Weihnachtsgeschenke waren denn von ihr? Müssen wir uns nicht bedanken, sonst ist sie doch wieder beleidigt.«
»Ich schreibe nicht mehr«, mischte sich Sascha ein. Er hatte jenen düsteren Tag noch immer nicht vergessen, an dem eigentlich schon das Band zwischen ihnen zerschnitten worden war.
»Ihr braucht nicht mehr zu schreiben, und sie kann nicht mehr schreiben«, erwiderte Alexander langsam. »Ich wollte es euch vor Weihnachten nicht sagen. Sie ist gestorben.«
Die Kinder blickten ihn stumm an. »Sie ist tot«, sagte Sascha nachdenklich. »Sie ist tot?«, fragte Andrea staunend.
Eine Weile war wieder Schweigen zwischen ihnen. »Dann ist niemand mehr da, der etwas gegen Tante Isi hat«, stellte Sascha fest. »Wirst du sie jetzt heiraten, Papi?«
Alexander war aus der Fassung gebracht. »Für euch scheint das ja völlig problemlos zu sein«, meinte er stockend.
»Wir haben oft genug darüber geredet«, mischte sich Andrea ein. »Na, vielleicht hat der Großvater Wellentin noch was dagegen.«
»Er ist doch jetzt sehr nett«, stellte Sascha zuversichtlich fest. »Man kann ja mit ihm reden.«
»Das lasst ihr aber schön bleiben«, erklärte Alexander energisch.
»Tust du das selber?«, erkundigte sich Andrea treuherzig. »Eigentlich hat er doch nichts zu sagen. Tante Isi ist doch erwachsen.«
»Mit euch macht man schon etwas mit«, seufzte Alexander. »Denkt ihr auch an die anderen Kinder?«
»Freilich. Wir können uns doch auch weiter um sie kümmern«, meinte Andrea unbefangen. »Frau Trenk und Edith sind doch auch noch da, und Roli ist schon ein großes Mädchen. Die kann auch mit aufpassen.«
»Es sollen aber noch mehr Kinder kommen«, meinte Alexander. »So war es eigentlich gedacht.«
»Aber es kommen immer nur nette Kinder. Da passt Tante Isi schon auf. Sie müssen alle zueinanderpassen.«
»Es soll nämlich anders sein als in anderen Heimen«, erklärte Sascha. »Es soll eine richtige Familie sein.«
»Dominik hat sich schon was ausgedacht«, fuhr Andrea fort. »Wenn wir den Weg durch den Wald verbreitern, dass man mit dem Auto fahren kann, sind wir in fünf Minuten in Sophienlust. Und wenn wir dann noch ein paar Häuser hinbauen, wächst es ganz zusammen.«
»Was denkt ihr euch noch alles aus?«, fragte Alexander staunend.
»Dass Sophienlust eigentlich ein schönes Ferienheim sein könnte. Dann würden die meisten Kinder nicht immer dableiben, sondern nur für ein paar Wochen.«
»Eine großartige Idee«, meinte Alexander anerkennend. »Weiß Isi schon von euren Plänen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das will ihr Nick mal schonend beibringen«, erwiderte sie verschmitzt.
»Mario, Kati und Roli bleiben natürlich immer«, stellte Sascha rasch fest. »Das ist doch klar. Aber Mario ist sowieso schon wie Robbys Bruder, und Mädchen sind viel selbstständiger.«
»Na, dann wollen wir mal sehen, was uns die Zukunft bringt«, meinte Alexander.
Schmeichelnd drückte sich Andrea an ihn. »Wir könnten mit Isi und Nick doch eine kleine Familie in der großen sein, Papi. Das wäre wunderschön.«
Von ihrer Großmutter sprachen sie nicht mehr. Wer Liebe sät, wird Liebe ernten, dachte Alexander. Wer Zwietracht sät, wird vergessen. Sie hinterließ keine Lücke.
»Wenn Großmama so geworden wäre wie Omi Wellentin, wäre ich jetzt traurig«, sagte Sascha nach geraumer Zeit zu seiner Schwester.
Sie sagte darauf gar nichts.
*
Misstrauisch hatte Dominik am Morgen dieses Tages die Ankunft eines männlichen Besuchers zur Kenntnis genommen. Es war der letzte Ferientag, und er war über solche Störung gar nicht erbaut.
»Ein Mann«, sagte er zu Claudia, »aber er ist schon ziemlich alt.« Es war beruhigend für ihn.
»Ein Herr von auswärts«, erwiderte Claudia. »Er hat sich bereits angemeldet.«
»Was will er denn?«, erkundigte sich Dominik neugierig. »Weißt du es?«
»Das wird dir Mami nachher schon sagen.«
»Er wird doch keinen Ärger machen?«, vermutete er misstrauisch. »Sollen wir brav sein oder sollen wir lieber brüllen?«
»Seid mal lieber brav«, meinte sie lächelnd.
Der Herr blieb ziemlich lange, und als er dann endlich gegangen war, rief Denise die Kinder zusammen.
»Ich habe euch eine Mitteilung zu machen«, begann sie. »Wir werden nächste Woche zwölf Kinder bekommen.«
»Zwölf«, rief Dominik aus, »gleich ein ganzes Dutzend?«
»Madame Merlinde löst Haus Bernadette auf. Sie will heiraten und das Heim nicht mehr weiterführen.«
»Sie will heiraten«, staunte Dominik, »wo sie doch schon so alt ist?«
»So alt ist sie noch gar nicht, aber es wird ihr auch zu viel. Nun hat sie sich an uns erinnert und fragt an, ob wir zwölf Kinder übernehmen könnten.«
»Die ich schon kenne?«, fragte Dominik.
»Ja, gewiss, einige kennst du und Roli auch noch.«
»Na, die werden sich aber freuen, wenn sie zu uns kommen können«, seufzte Dominik. »Mami, kann ich dich mal was allein fragen?«
Dass es etwas ganz Dringendes sein musste, sah sie ihm an der Nasenspitze an.
Während die anderen Kinder sich aufgeregt über den zu erwartenden großen Zuwachs unterhielten, gingen sie in ihr Arbeitszimmer.
»Madame Merlinde heiratet«, meinte Dominik sinnend. »Sie macht ihr Heim einfach zu. Und wenn du Onkel Alexander heiratest, was machst du dann?«
Seine direkte Frage brachte sie in große Verlegenheit. »Für dich scheint es ja ganz sicher zu sein, dass ich Onkel Alexander heiraten werde«, meinte sie unsicher.
»Für Sascha und Andrea auch. Wir haben uns schon alles so schön ausgedacht. Aber wenn nun noch zwölf Kinder kommen, sehe ich ganz schwarz.«
»Schwester Gretli wird mitkommen. Sie ist sehr tüchtig.«
»Und lieb«, nickte er. »Sie wird sich freuen, wenn sie uns wiedersieht.«
»Und was eure Pläne anbetrifft, werden wir noch ein wenig Zeit verstreichen lassen.«
Er machte ein enttäuschtes Gesicht, aber es hellte sich gleich wieder auf.
»Bis wir die Straße durch den Wald gebaut haben, damit wir schneller zwischen Sophienlust und Schoeneich hin und her kommen? Opi sagt, das ist gar keine schlechte Idee.«
Aus dem Großvater war nun schon der Opi geworden. Denise musste lächeln.
»Nun, wenn Opi es sagt, dann sollten wir uns damit wirklich einmal befassen.«
»Opi lässt die Straße bauen«, versicherte ihr Dominik. »Ein Stück Wald, da wo Kati wohnte, gehört doch ihm. Und das Haus lässt er dann auch herrichten und ein paar andere könnte man auch noch hinbauen für Familien mit mehr Kindern.«
»Und ich werde vor bereits fertige Pläne gestellt«, meinte sie kopfschüttelnd. »Was meinst du wohl, was Alexander dazu sagen wird?«
»Das mit den zwölf Kindern wird ihm wohl nicht so recht gefallen, aber sonst … Na, er wird es dir schon sagen.«
*
Er sagte es ihr sehr schonend und war überrascht, als sie ihm lächelnd ins Wort fiel.
»Dominik hat mich bereits unterrichtet«, stellte sie fest. »Wir brauchen nur noch ja zu sagen, alles andere machen die Kinder mit Opi aus. Eine heitere Gesellschaft haben wir da beieinander.«
»Und was ist mit dem Dutzend Kinder, Denise?«
»Sie kommen natürlich.«
»Natürlich, konnte ich etwas anderes erwarten? Die Idee mit dem Ferienheim hätte mir besser gefallen.«
»Vielleicht finden die Kinder im Verein mit Opi dafür auch noch eine Lösung«, scherzte sie. »Mach kein so betrübtes Gesicht, Alexander. Ich habe mit Frau Trenk gesprochen. Wenn jetzt Schwester Greti auch noch kommt, traut sie es sich schon zu, die Leitung des Heims zu übernehmen. Und bei ihr können wir ganz sicher sein, dass sie bleibt. Sie hat mit ihrem Jungen hier eine wahre Heimat gefunden. Ist das nicht auch ein wunderschönes Gefühl?«
Sein Gesicht entspannte sich. »Ich kann den Frühling kaum erwarten«, murmelte er. Fest schlossen sich seine Hände um ihr Gesicht.
»Und dann?«, fragte sie atemlos.
»Dann wird Claudia heiraten und wir werden die Straße zwischen Schoeneich und Sophienlust bauen. Das erste Jahr wird zu Ende sein, Liebste, und die Huber-Mutter wird vielleicht doch noch recht behalten, dass in Sophienlust zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken läuten. Sie hat ja auch damit recht behalten, dass Barbaras Kind ein Mädchen wurde. Die kleine Denise. Wir sollten sie eigentlich mal besuchen. Was meinst du, Liebes?«
Sie schenkte ihm ein weiches Lächeln. »Sammeln wir unsere Kinder ein und fahren wir hin, Alexander.«
»Aber erst möchte ich noch einen Kuss«, flüsterte er. Und den bekam er.