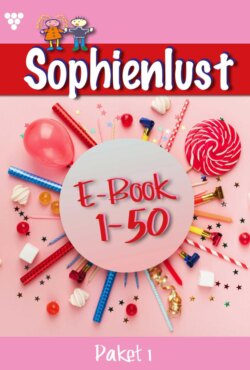Читать книгу Sophienlust Paket 1 – Familienroman - Diverse Autoren - Страница 6
ОглавлениеSophie von Wellentin saß in ihrem Lehnsessel in dem riesigen Wohnraum des Gutshauses, das sich seit vier Generationen im Besitz ihrer Familie befand. Wohlgemerkt in ihrer Familie, nicht in derer von Wellentin.
»Sophienlust« hatte ihre lebensfrohe Großmutter es einstmals genannt. Sie hatte dem Haus und auch ihr, der Enkelin, diesen Namen gegeben. Aber Sophie von Wellentin war bei weitem nicht so lebensfroh wie ihre verstorbene Ahnin.
Der Notar Dr. Brachmann, nicht viel jünger als die Gutsherrin, betrachtete die alte Dame mit wachsamen Augen. Gestern hatte sie ihren fünfundsiebzigsten Geburtstag gefeiert. Sie hatte sich sehr zusammengenommen, doch heute bemerkte man, wie erschöpft sie war.
»Sie wundern sich bestimmt, daß ich Sie heute nochmals rufen ließ, lieber Doktor Brachmann?« fragte sie mit ihrer leisen angenehmen Stimme.
»Ich möchte mein Testament ändern«, fuhr sie fort. »Und zwar noch heute, denn ich habe keine Zeit mehr zu verlieren.«
»Sie wollen Ihr Testament ändern?« fragte der Anwalt verblüfft. »Aber Sie haben doch gar keine Angehörigen, außer Ihrem Sohn und seiner Gattin.«
»Das meinen Sie, und das meinen die anderen«, erklärte sie spöttisch. »Ich aber weiß seit vier Wochen, daß ich einen Urenkel besitze.«
»Einen Urenkel?« wiederholte Dr. Brachmann ungläubig. »Dietmar ist seit fünf Jahren tot!«
»Ja, er ist seit fünf Jahren tot«, wiederholte sie traurig. »Aber sein Sohn lebt! Der Junge ist fast fünf Jahre alt, und er wird mein alleiniger Erbe sein!«
»Gnädige Frau, ich bitte Sie zu bedenken, Sie könnten falschen Informationen zum Opfer gefallen sein. Oder jemand könnte versuchen, sich auf unlautere Weise zu bereichern. Da war doch jene Tänzerin. Wie hieß sie doch?«
»Denise Montand«, antwortete die alte Dame.
»Und sie ist auch die Mutter meines Urenkels Dominik. Wir alle haben diese Affäre damals mit einer Handbewegung abgetan. Aber jetzt weiß ich, daß Dietmar dieses Mädchen kurz vor seinem Tod geheiratet hat. Es ist ein eheliches Kind! Verstehen Sie, Doktor Brachmann? Es gibt seit fast fünf Jahren einen Dominik von Wellentin, aber niemand wußte es.«
Eine Weile herrschte Schweigen.
»Ich komme da nicht mit«, meinte der alte Herr. »Wenn es so ist, warum hat diese junge Frau dann niemals Ansprüche geltend gemacht?«
»Sie besitzt etwas, das wohl niemand voraussetzte: Würde und Stolz. Deshalb konnte sie nicht bei Menschen betteln, die sie verächtlich von ihrer Tür gewiesen hätten. Es war mir ein dringendes Bedürfnis, mich Ihnen anzuvertrauen. Ich hoffe, daß ich mich auf Ihre völlige Diskretion verlassen kann.«
»Sie kennen mich lange und gut genug, gnädige Frau, um Ihnen meine Diskretion nicht versichern zu müssen.«
Sie nickte. »Vorerst weiß weder mein Sohn noch meine Schwiegertochter etwas davon. Deshalb muß ich ein Testament hinterlassen, das unanfechtbar ist. Ich möchte auch, daß Sie Dominik von Wellentin und seiner Mutter zur Seite stehen, da ich dazu nicht mehr in der Lage sein werde. Ich wage es nicht, mit dieser großartigen jungen Frau persönlich zu sprechen. Ich würde mich zu sehr schämen für das, was ich versäumte, obgleich Dietmar mir vertraute. Ich war so engstirnig, wie mein Sohn und seine Frau es heute noch sind, obgleich sie ihren einzigen Sohn verloren haben. Sie werden sich wohl auch nicht mehr ändern und für meine Handlungsweise kein Verständnis aufbringen. Aber wenn man sich an der Schwelle des Todes befindet, dann sieht man alles mit anderen Augen. Ich möchte nicht sterben, ohne Gottes Vergebung zu erlangen, nur er kann mir vergeben. Von dieser jungen Frau und von einem Kind darf ich es nicht erwarten. Und jetzt werde ich Ihnen die Vorgeschichte erzählen.«
*
Es war an einem Sommertag, als Dietmar von Wellentin zu seiner Großmutter kam, nachdem er mit seinem Vater eine harte Auseinandersetzung gehabt hatte.
Dietmar war erst vierundzwanzig Jahre alt, und er war auch kein Wellentin, wie ihn seine Großmutter sich gewünscht hatte. Dennoch liebte sie Dietmar, der von seinem Vater verwöhnt und von seiner Mutter vergöttert wurde.
»Ich soll Barbara von Borken heiraten, Großmama«, hatte er zornig gesagt.
»Ich weiß, sie ist ein sehr hübsches und gebildetes Mädchen«, hatte Sophie von Wellentin erwidert.
»Aber ich liebe Denise, Großmama. Denise Montand. Ich will sie heiraten! Ja, ich muß sie sogar heiraten, denn sie erwartet ein Kind von mir!«
Sophie von Wellentin sah Dr. Brachmann an.
»Sie können sich vorstellen, wie entsetzt ich war«, sprach sie mit leiser, aber ruhiger Stimme weiter. »Mein Enkel und eine Tänzerin! Ein Skandal! Dietmar gestand mir auch sogleich, daß er bereits mit seinem Vater gesprochen und kein Verständnis gefunden hätte.«
»Bist du überzeugt, daß es dein Kind ist?« hatte sein Vater ihn höhnisch gefragt.
»Wieviel Affären mag sie haben? Eine Tänzerin…! Du hast uns schon mancherlei geboten, Dietmar, und ich habe immer ein Auge zugedrückt, aber das ist zuviel. Nein, niemals wirst du diese Frau heiraten! In diesem Augenblick wärst du mein Sohn nicht mehr. Nicht einen Pfennig würdest du von mir bekommen.«
»Dietmar hat mir alles erzählt«, fuhr Sophie von Wellentin nach einer kurzen Atempause fort, »aber auch ich war geneigt, diese Tänzerin zu verdammen. Ich glaubte nicht an eine große, beständige Liebe. Ganz wollte ich ihn allerdings auch nicht im Stich lassen. Ich gab Dietmar zwanzigtausend Euro und bat ihn inständig, diese Affäre aus der Welt zu schaffen und das Mädchen abzufinden. Fast hatte ich den Eindruck, daß Dietmar zur Einsicht kommen würde. Aber es war das letzte Mal, daß ich ihn lebend sah. Wenig später verunglückte er in den Vogesen tödlich. Denise Montand trat nie in Erscheinung.«
»Aber…«, Dr. Brachmann geriet ins Stocken, »wie kamen Sie jetzt auf den Gedanken, Nachforschungen anzustellen?« fragte er. »Ich muß doch annehmen, daß Ihre Informationen auf solchen beruhen.«
Für einige Minuten versank die alte Dame wieder in Schweigen. »Der Himmel wollte es wohl, daß ich zur Einsicht komme«, flüsterte sie.
»Wie Sie wissen, war ich vor vier Wochen zur Kur in Ischia. Viel genützt hat es meiner Gesundheit nicht mehr, aber es sollte wohl so sein, daß dort eine Denise Montand eine Verletzung auskurierte, die sie beim Tanzen erlitten hatte. Man sprach viel darüber.
Sie ist eine sehr schöne Frau. Man konnte sie allerdings nur aus der Ferne bewundern, denn sie lebte völlig zurückgezogen.
Der Name war mir plötzlich in Erinnerung gekommen. Ich beobachtete sie.
Ein junges Mädchen begleitete sie des öfteren, und eines Tages sah ich einen kleinen Jungen an ihrer Hand, bei dessen Anblick mir der Atem stockte. Ich sah Dietmar, als er ein Kind war.
Es war nicht einfach, an Denise Montand heranzukommen, aber eines Tages gelang es mir, mit ihr bekannt gemacht zu werden.«
Sie sprach jetzt jedes Wort mit Überlegung aus, und Dr. Brachmann sah diese Szene, die sich vor einigen Wochen abgespielt hatte, plastisch vor seinen Augen.
»Frau Montand?« sagte Sophie von Wellentin. »Ich habe Ihren Namen schon gehört, Sie sind Tänzerin. Ich hörte von Ihrem Unfall. Mein Name ist Sophie von Wellentin.«
Denise Montand erblaßte. Ihre Lippen bebten.
»Ich bedauere, gnädige Frau«, erwiderte sie kühl. »Ich habe diesen Namen noch nie gehört.«
Sophie von Wellentin seufzte. »Ich wußte nicht mehr, was ich sagen sollte. Sie verabschiedete sich rasch, und einen Tag später war sie aus Ischia abgereist. Ich setzte alle Hebel in Bewegung, um ihren Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen. Endlich gelang es mir. Sie lebt zurückgezogen in Paris. Ihr Sohn aber befand sich wieder in dem Heim, in dem sie ihn vor drei Jahren untergebracht hatte. Übrigens in einem sehr guten privaten Kinderheim.
Ich fuhr dorthin. Eine beträchtliche Zuwendung machte die Leiterin sehr redselig.
Dominik lebt dort unter dem Namen Montand. Aber ich erhielt den Beweis, daß Dietmar die Mutter seines Kindes einige Wochen vor seinem Tod geheiratet hatte. Ich konnte das Kind sehen und auch sprechen. Ich gab mich allerdings nicht zu erkennen. So tief beschämt war ich noch nie in meinem Leben. Wir hatten diese Frau in Grund und Boden verdammt, und sie war so großartig, daß ich keine Worte dafür finde. Ich schickte seiner Mutter einen Brief und Geld. Beides kam zurück. Es müsse sich um einen Irrtum handeln, schrieb sie. Sonst nichts.«
»Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll«, meinte Dr. Brachmann.
»Sie brauchen nichts mehr zu sagen, mein Freund. Sie werden mein neues Testament aufsetzen und zwar so, daß Denise Montand es akzeptieren muß und niemand es anfechten kann!«
*
»Manchmal verstehe ich dich wirklich nicht, Isi«, sagte Claudia Rogers zu Denise Montand. »Warum hast du das Geld zurückgeschickt? Wenn schon einmal ein Mitglied dieser bornierten Familie eine menschliche Regung zeigt, hättest du es ruhig annehmen können. Es steht dir schließlich zu, und wenn nicht dir, dann Nick. Fünf Jahre hast du allein für das Kind gesorgt. Es ist dir doch wahrhaftig nicht leichtgefallen.«
»Viereinhalb Jahre«, berichtigte Denise. »Ich habe die ärgste Zeit geschafft, und die zwanzigtausend Euro, die Dietmar mir gegeben hatte, sind für Nick gut angelegt. Davon wird er seine Berufsausbildung bestreiten können. Ich will mit dieser Familie nichts zu schaffen haben.«
»Aber Nick trägt ihren Namen, vergiß das nicht!« mahnte Claudia.
»Ja, er trägt den Namen seines Vaters, aber er ist mein Kind. Seine Mutter hat man verachtet. Eine Tänzerin! Unglaublich, daß ein von Wellentin eine Tänzerin heiraten wollte. Ich habe es nicht vergessen.«
»Aber er wollte doch seine Familie von der Heirat unterrichten!«
»Dazu kam es nicht. Er starb vorher, und vielleicht war es gut so.«
»Du hast ihn doch geliebt, Isi«, sagte Claudia niedergeschlagen.
»Ja, ich liebte ihn, aber ich wußte nicht, daß er ein Schwächling war. Mein Sohn soll einmal ein ganzer Mann werden. Dominik wird mich nicht enttäuschen, ich weiß es.«
»Du bist verbittert«, flüsterte Claudia, die einzige Vertraute der schönen Frau.
»Dietmar ist tot«, erwiderte Denise leise. »Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken er starb. Aber manchmal fürchte ich, daß er wohl doch nicht durchgehalten hätte, Claudi. Und ich kann dir nur immer wieder raten: Schau dir die Männer ganz genau an, bevor du einem vertraust.«
»Aber du liebst Dominik. Du hättest ihn doch niemals weggegeben, wenn du nicht Geld verdienen müßtest. Jetzt aber mußt du den Tatsachen ins Auge sehen, Isi! Du wirst nie mehr tanzen können. Das Heim kostet eine Menge Geld. Wenn dir schon Hilfe angeboten wird, solltest du sie nehmen.«
Denise sah das junge Mädchen an.
»Du stehst wenigstens mit beiden Beinen mitten im Leben, Claudi«, lächelte sie. »Ich bin froh, daß ich dich habe und mit dir sprechen kann. Aber von dieser Familie laß uns bitte schweigen.«
»Du hast Nick versprochen, ihn zu dir zu nehmen. Er wird nicht verstehen, warum es plötzlich nicht mehr möglich sein soll.«
»Er ist sehr vernünftig und wird begreifen, daß ich mir erst einen neuen Beruf suchen muß. Tanzen kann ich nicht mehr. Was soll ich tun, Claudi?«
»Du hättest das Geld nehmen sollen. Dann hättest du dir eine Existenz aufbauen können. Eine hübsche Pension an der Riviera vielleicht, oder eine Boutique. Die alte Dame machte doch wirklich einen guten Eindruck.«
»Vielleicht hat ihr Gewissen geschlagen? Aber ich kann nicht vergessen, daß man mich wie ein billiges Mädchen behandelt hat, das sich anmaßte, einen von Wellentin an sich zu binden. Und ich kann mir nicht verzeihen, daß ausgerechnet Dietmar der Vaters meines Kindes sein muß.«
Plötzlich verließ sie die Beherrschung. »Ich hatte ihn so lieb, Claudi, so unendlich lieb. Ich werde nie erfahren, ob er so geworden wäre, wie ich ihn mir wünschte.«
»Du mußt zu Nick fahren und ihm sagen, daß es noch eine Zeit dauern wird, bis du ihn zu dir nehmen kannst«, mahnte Claudia, ihre Erschütterung unterdrückend. »Herrgott, wenn doch wenigstens ich Geld hätte! Aber warum mußt du dir ausgerechnet eine so arme Freundin aussuchen?«
»Weil ich dich sehr, sehr gern habe, Claudi«, erwiderte Denise herzlich. »Wir sind doch richtige Freundinnen.«
Sie erinnerten sich beide des Tages, als sie sich kennenlernten. Claudia war Lernschwester in der Klinik, in der Denise ihren Sohn zur Welt brachte.
Zuerst hatte die Sechzehnjährige in ihr nur die schöne Frau bewundert. Ganz langsam aber hatte sich das elternlose Mädchen immer inniger an Denise angeschlossen. Denise hatte bald gespürt, daß es mehr als eine flüchtige Zuneigung war. Sie war für Claudia Freundin und Schwester zugleich geworden, und eines Tages hatte das junge Mädchen dann ihr Schicksal erfahren. Je mehr Denise sich in sich selbst zurückzog und nur noch für ihren Sohn lebte und arbeitete, desto
energischer wurde Claudia, um ihrer Freundin zu helfen.
»Sehen wir alles jetzt einmal ganz objektiv, Isi«, meinte sie. »Dein Geld ist aufgebraucht. Das Geld für Dominik willst du nicht anrühren. Aber Nick glaubt an dich. Er freut sich darauf, bei dir sein zu dürfen. Was ich verdiene, würde uns das Existenzminimum sichern, und du weißt, wie gern ich mit dir teile. Aber enttäuschen darfst du den Jungen nicht.«
Denise ergriff ihre Hand. »Ich werde ihn nicht enttäuschen, Claudi.«
*
Das Kinderheim, in dem Denise ihren Sohn untergebracht hatte, trug den Namen »Haus Bernadette«. Leiterin war Madame Merlinde. Sie war über fünfzig, liebte es aber, sich jünger zu geben. Was immer man an ihr persönlich auch auszusetzen hatte, das Heim war gut geführt. Dominik hatte sich nie beschwert. Was er vermißte, war, daß er seine Mutter so selten sehen durfte. Das zeigte sich, als Denise kam und er sie schon von weitem entdeckte, als hätte er sie längst erwartet.
»Mutti, geliebte Mutti!« Mit diesem Jubelruf lief er ihr entgegen. »Ich dachte schon, du wärst krank.«
Er klammerte sich an sie, küßte sie stürmisch und wollte sie gar nicht mehr freigeben. »Ich habe so sehr auf dich gewartet, Mutti! Hattest du vergessen, daß du mich holen wolltest?«
»Ich konnte nicht früher kommen, Nick«, erwiderte sie traurig. »Du mußt mich verstehen, mein Kleiner! Du bist doch so vernünftig.«
»Hast du noch keine Arbeit gefunden?« erkundigte er sich zaghaft.
»Nein, das ist sehr schwierig, Nick. Ich muß doch einen Beruf haben, wo ich Zeit für dich habe. Allein kann ich dich doch nicht lassen.«
Nicks Gesicht wurde immer betrüblicher. Er war ein bildhübscher Junge mit verträumten dunklen Augen, die von langen Wimpern umgeben waren, lockigem blauschwarzem Haar und zierlichem Wuchs. Schmerzhaft wurde es Denise bewußt, wie wenig sie ihn bisher bei sich gehabt hatte. Gewiß waren es jedes Jahr ein paar Ferienwochen gewesen, aber die übrige Zeit zählte wohl doppelt, denn immer mußte sie erst gewisse Hemmungen überwinden, bis sie so mit ihm sprechen konnte, wie sie es sich wünschte. Sie fühlte sich schuldbewußt, daß sie nicht mehr Zeit für ihn aufbringen konnte.
Sie hatte hart gearbeitet und gut verdient, aber fast die Hälfte ihrer Einnahmen hatte sie für Dominik verwandt.
Sie hatte ihn nicht in irgendein Heim geben wollen, sondern war darauf bedacht gewesen, daß es ihm an nichts fehlte.
Die unbeantworteten Fragen, die Dietmars früher Tod aufgeworfen hatten, waren eine Belastung für sie gewesen. Aber nicht einen Augenblick hatte sie gezögert, alle Verantwortung für das Kind auf sich zu nehmen.
Die flüchtige Begegnung mit Dietmars Großmutter hatte neue Probleme für sie aufgeworfen. Die alte Dame hatte ihre Bekanntschaft gesucht, sie aber hatte dieser ausweichen wollen.
Warum nur besaß sie diesen Stolz, den sie sich doch gar nicht leisten konnte? Immerhin war es eine Tatsache, daß Dominik ein Wellentin war.
Sie mußte jetzt oft daran denken, wenn sie ihn sah. Er war seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Nur das dunkle Haar hatte er von ihr.
»Weißt du, Mutti, es wäre ja gar nicht so schlimm, wenn ich schon schreiben und deine Briefe selbst lesen könnte«, meinte Nick. »Besuch bekommen die andern Kinder ja auch nicht oft. Und Madame Merlinde ist zu mir jetzt auch ganz besonders nett.«
»Jetzt?« fragte Denise gedankenlos.
»Nun, seitdem die alte Dame da war. Ich mußte guten Tag sagen. Sie war sehr freundlich. Und hinterher hat sie uns ein ganz großes Paket mit Süßigkeiten und Spielsachen geschickt.«
Angst erfüllte Denise. Es konnte sich doch wohl nur um Frau von Wellentin handeln. Was hatte das zu bedeuten? Wollte sie ihr den Jungen nehmen? War es ihnen jetzt bewußt geworden, daß es sich um den letzten Wellentin handelte?
O nein, dachte Denise aufbegehrend. Er ist mein Sohn, ganz allein mein Sohn! Und dann war auch schon der nächste Gedanke da. Sie durfte Dominik nicht mehr hierlassen. Sie mußte auch ihren Aufenthaltsort wechseln. Frau von Wellentin hatte beides in Erfahrung gebracht.
Aber zuerst wollte sie doch mit Madame Merlinde sprechen.
Sie war sehr verlegen, als Denise sie direkt fragte. Dann gab sie aber doch zu, daß Frau von Wellentin hier gewesen sei und ihr Interesse an dem Jungen bekundet hätte.
»Und was haben Sie ihr gesagt?« fragte Denise ungehalten.
»Ich will mich gewiß nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, Madame Montand«, entgegnete die Ältere leise, »aber Sie sollten es sich vielleicht doch überlegen, schon im Interesse Ihres Sohnes, ob Sie sich diesen Stolz leisten können. Sehen Sie, ich bin eine lebenserfahrene Frau. Wie viele Schicksale sind mir bekannt geworden. Manch eines hätte eine glückliche Wendung nehmen können, wenn nicht unerbittliche Charaktere aufeinandergeprallt wären. Man sollte eine Hand, die zur Versöhnung bereit ist, nicht so schnell ausschlagen.«
»Sie können die Umstände nicht beurteilen«, erklärte Denise abweisend. »Ich möchte Dominik heute mitnehmen.«
Madame Merlinde sah sie fast entsetzt an. Es kam zu plötzlich. Sie hatte Frau von Wellentin versprochen, ihr umgehend mitzuteilen, wenn Denise Montand ihren Sohn aus dem Heim nehmen würde. Aber dazu hatte sie keine Gelegenheit, wenn sie ihn schon heute mitnahm. Andererseits konnte sie ihr auch nichts in den Weg legen.
»Sie wollen ihn mit nach Paris nehmen?« fragte sie vorsichtig. »Haben Sie bereits eine neue Position gefunden, die es Ihnen ermöglicht? Ich will doch nicht hoffen, daß Sie plötzlich Grund zur Beschwerde hätten?«
»O nein, Nick erzählte mir, daß Sie jetzt ganz besonders nett zu ihm wären«, erwiderte Denise spöttisch. »Frau von Wellentin hat sich Ihnen wohl sehr großzügig erkenntlich gezeigt.«
»Wenn ich mir eine Bemerkung gestatten darf, Madame Montand, die alte Dame machte durchaus den Eindruck, daß die ehrenwertesten Absichten sie bewegten.«
»Das mag durchaus der Fall sein«, gab Denise zu, »aber mein Sohn gehört mir. Wenn sich Frau von Wellentin noch einmal an Sie wenden sollte, sagen Sie ihr dies bitte!«
*
So erlebte der kleine Dominik die große Überraschung, schon an diesem Tage mit seiner Mutter Haus Bernadette verlassen zu können. Nicht einmal von seinen kleinen Freunden konnte er sich richtig verabschieden. Die kleine Susanne Berkin weinte bitterlich.
»Sie hat ja niemanden, Mutti«, erzählte Nick leise und drehte sich noch einmal zu ihr um. »Wenn wir mal ein schönes Haus haben, Susi«, rief er ihr tröstend zu, »dann darfst du zu mir kommen. Mutti erlaubt es bestimmt, nicht wahr, liebe Mutti?«
Du lieber Gott, dachte Denise, ein schönes Haus. Er wird umsonst darauf hoffen. Wir wollen froh sein, wenn wir uns bescheiden durchbringen. Aber sie konnte seinem bittenden Blick nicht widerstehen und sagte: »Ja!«
»Fahren wir nach Paris?« fragte Dominik auf dem Bahnhof.
»Nein, wir fahren zu Claudia. Sie hat Sehnsucht nach dir, Nick.«
Währenddessen hatte Madame Merlinde schon Frau von Wellentin auf Gut Sophienlust angerufen und ihr mitgeteilt, daß Dominik von seiner Mutter abgeholt worden sei.
Noch am Abend des gleichen Tages wurde der Privatsekretär, der Frau von Wellentin bereits alle Informationen besorgt hatte, beauftragt, sich sofort auf ihre Spur zu setzen und weder sie noch das Kind aus den Augen zu verlieren.
Sophie von Wellentin fühlte sich sehr matt, aber noch einmal entfaltete sie alle Energie. Sie ließ ihren Sohn zu sich rufen. Er traf am nächsten Vormittag bei ihr ein.
Man konnte Hubert von Wellentin als einen Mann in den besten Jahren bezeichnen. Seine Gestalt war jugendlich straff, seine Haare waren nur an den Schläfen leicht ergraut.
Er hatte das Leben genossen, aber er hatte dabei nicht vergessen, sein Vermögen zu vermehren. Daß der frühe Tod seines einzigen Sohnes ihn hart getroffen hatte, gab er nicht zu. Vielleicht quälte ihn auch sein schlechtes Gewissen, weil sie sich im Zorn getrennt und keine Zeit zur Versöhnung gefunden hatten.
»Geht es dir noch immer nicht besser, Mutter?« fragte er ehrlich betrübt.
»Nein, Hubert, und es wird mir auch nicht mehr bessergehen. Ich fühle mein Ende nahen.«
»Es bedrückt mich sehr, dich so sprechen zu hören, Mutter«, sagte er leise.
»Nun, ich bin fünfundsiebzig Jahre alt und habe ein langes Leben hinter mir. Kein sehr befriedigendes Leben, wie ich rückblickend feststellen muß. Seit fünf Jahren sogar ein sehr leidvolles Leben«, fügte sie hinzu. »Ich möchte heute mit dir über jene Frau sprechen, die Dietmar geliebt hatte und heiraten wollte.«
»Aber das ist doch längst vergessen«, erwiderte er abweisend.
»Eine Affäre. Er hat sie bereinigt, sonst hätte man wohl noch einmal von ihr gehört.«
»Es könnte andere Gründe geben, daß man nichts mehr von ihr hörte«, erklärte sie müde. »Hast du dir nie Gedanken darüber gemacht, von wem die Rosen sein könnten, die jedes Jahr an seinem Todestag auf dem Grab lagen?«
Unwillen zeichneten jetzt seine strengen Züge. »Deine Phantasie ist sehr rege, Mutter«, wehrte er ab. »Barbara wird sie gebracht haben.«
»Barbara, die seit vier Jahren verheiratet ist und Dietmar keine Träne nachgeweint hat?« antwortete sie bitter.
»Sie liebte ihn«, behauptete er.
»Das hast du dir eingebildet, weil es dir wünschenswert erschien. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Dietmar hat vor seinem Tod Denise Montand geheiratet, und sie hat einen Sohn zur Welt gebracht.«
Er sah sie fassungslos an.
»Ja, es gibt noch einen von Wellentin, mein Sohn, und ich hoffe, daß du davon Kenntnis nehmen wirst.«
»Niemals!« erwiderte er. »Wenn es wirklich so wäre, das Kind einer Tänzerin würde ich nicht anerkennen. Ist sie vielleicht an dich herangetreten? Will sie dich erpressen?«
»Ganz im Gegenteil! Sie versteckt den Jungen und lehnt jede Hilfe ab. Sie hat mir gegenüber sogar behauptet, den Namen Wellentin nie gehört zu haben.«
Dann berichtete sie, wie sie zu ihren Kenntnissen gekommen war. Aber sein Gesicht blieb unbeweglich und abweisend.
»Ich fühle, du willst mich nicht verstehen, oder du begreifst nicht, was ich dir verständlich machen will«, sagte Sophie von Wellentin tonlos. »Eigentlich habe ich auch nichts anderes erwartet. Nun kann ich nur hoffen, daß du eines Tages nicht die Reue empfinden wirst, die ich empfinde. Du hattest nur einen Sohn. All dein Geld werden eines Tages fremde Menschen bekommen, Hubert. Denise Montand war nicht gut genug für unseren Namen, nicht gut genug für deinen Sohn. Dietmar ist tot, und man soll Toten nichts Böses nachsagen. Ich bin überzeugt, daß ich es auch nicht tue, wenn ich jetzt sage, daß sie vielleicht zu schade für ihn war. Ich habe die Konsequenzen daraus gezogen.«
»Welche Konsequenzen, Mutter?« fragte er bestürzt.
»Das wirst du erfahren, wenn ich tot bin«, erwiderte sie ruhig.
*
Es war ein sonniger Frühlingstag, an dem die sterblichen Überreste Sophie von Wellentins in die Familiengruf gesenkt wurden. Eine große Trauergemeinde folgte ihrem Sarg. Noch mehr als den Gedanken, daß er nun keine Mutter mehr hatte, verfolgten Hubert von Wellentin ihre letzten Worte. Zwei Tage nach ihrer letzten Unterredung war sie gestorben. Auch sie waren nicht friedlich voneinander geschieden, wenngleich er den Gedanken, daß Differenzen zwischen ihnen bestanden hatten, weit von sich wies.
Die Testamentseröffnung sollte drei Tage später erfolgen. Irene von Wellentin, wie ihr Mann starr und unerbittlich in ihrer Haltung, hielt eine solche für völlig überflüssig.
»Du meinst doch nicht etwa, daß sie uns enterbt haben könnte, Hubert«, sagte sie zu ihrem Gatten, der nach der Beisetzung unanfechtbar war.
»Nun ist sie tot, und ihr kann alles gleichgültig sein. Ich fürchte, daß wir eine böse Überraschung erleben könnten.«
Irene von Wellentin hob die Augenbrauen. »Ein Testament ist doch anfechtbar«, erklärte sie gelassen. »Du bist ihr einziger Erbe.«
»Aber Sophienlust gehörte ihrer Familie. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist dem Vermögen der Wellentins nie einverleibt worden.«
»Aber es gibt doch niemanden, der ihr nahgestanden hätte«, rätselte sie.
Obwohl er nicht antwortete, ließen Hubert von Wellentin seine Gedanken nicht zur Ruhe kommen.
*
In Claudia Rogers kleiner Wohnung war gerade so viel Platz, daß Denise und Dominik eine Schlafgelegenheit finden konnten. Claudia war mehr als überrascht gewesen, als Denise mit dem Jungen kam, aber sie stellte keine Fragen.
Claudia war als Schwester in einer Privatklinik angestellt und verdiente recht gut. Sie war gern bereit, alles mit Denise und Dominik zu teilen, aber die beengten Verhältnisse stimmten sie doch besorgt. Noch besorgter empfand sie, daß Denise überaus schweigsam war und fast schwermütig wirkte.
Nur langsam erzählte sie, was sie bewegt hatte, Dominik mit sich zu nehmen.
»Gut, ich verstehe dich«, meinte Claudia. »Jetzt müssen wir uns nur nach einer größeren Wohnung umschauen und eine Stellung für dich suchen. Vielleicht wüßte ich sogar eine. Die Frau unseres Chefarztes sucht eine Betreuerin für ihre Kinder. Es wäre halt eine Übergangslösung.«
Denise versuchte, sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Wenn man sie nehmen würde, was sollte dann aber mit Dominik geschehen? Claudia meinte optimistisch, daß man ja mit den Leuten offen reden könnte. Wo bereits vier Kinder waren, käme es auf ein fünftes ja nicht an.
»Du hast wirklich Humor«, lächelte Denise. Da klingelte es, und ein Postbote stand vor der Tür.
»Nanu«, sagte Claudia, »ein Einschreiben. Aber der Brief ist ja für dich, Isi!« Staunen malte sich auf ihren Zügen. »Wer weiß denn, daß du hier bist?«
»Niemand!« erwiderte Denise. »Nicht mal Madame Merlinde.«
Denise leistete mechanisch ihre Unterschrift, immer noch überlegend, wer von ihrer engen Freundschaft mit Claudia Rogers wüßte.
»Von einem Doktor Brachmann«, sagte Denise zögernd. »Oh!« Nach diesem überraschten Aufstöhnen hielt sie das Schreiben Claudia hin. Diese nahm es und las:
Sehr verehrte, gnädige Frau! Nach dem plötzlichen Ableben meiner Mandantin, Frau Sophie von Wellentin, bin ich beauftragt, Ihre Interessen wahrzunehmen. Ich möchte Sie höflich ersuchen, zu der auf den 3. Mai dieses Jahres festgesetzten Testamentseröffnung auf Gut Sophienlust zu erscheinen. Für Ihre Auslagen füge ich Ihnen einen Scheck bei. Ich sehe mich veranlaßt, Ihnen mitzuteilen, daß Frau von Wellentin als ihren letzten Wunsch geäußert hat, daß Sie dieser Aufforderung Folge leisten mögen. Sie bat mich ausdrücklich, Ihnen mitzuteilen, daß nur der Gedanke daran, daß Sie diesen, ihren letzten Wunsch erfüllen, sie in Ruhe sterben ließ. Ihr Verständnis auf die letzte Bitte einer Sterbenden erhoffend, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung!
»Guter Gott!« seufzte Claudia. »Was nun, Isi?«
»Ich darf den letzten Wunsch einer Sterbenden nicht einfach übergehen, obwohl es mich schreckliche Überwindung kosten wird, ihn zu erfüllen. Denn bestimmt werden dort auch Dietmars Eltern erscheinen.«
»Der Nachsatz lautet, daß du Dominik mitbringen sollst. Die alte Dame war scheinbar sehr gut informiert. Wenn du meine Meinung wissen willst, Isi…, für dich kannst du entscheiden wie du willst, aber wenn sie dem Jungen etwas hinterlassen hat, hast du nicht das Recht, dich dagegen zu sperren. Hör dir doch wenigstens an, was man dir eröffnet. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Großartiger als du kann sich eine Frau gar nicht benehmen.«
»Mach mich nicht besser als ich bin! Ich habe diese Gesellschaft verachtet. Ich wollte nichts mit ihr zu tun haben.«
»Aber immerhin hat er dich geheiratet, Isi!«
»Ich wollte es nicht, aber irgendwie siegte mein bürgerliches Bewußtsein.« Sie lachte spöttisch. »Es ist fast komisch, aber ich überlegte mir damals, daß mein Kind mir mal Vorwürfe machen könnte, ein uneheliches Kind zu sein.«
»Das war sicher auch sein Hauptbeweggrund, Isi«, erwiderte Claudia. »Denk daran, wenn du jetzt entscheidest! Dietmar starb zu schnell. Er konnte dir nichts beweisen, aber vielleicht wußte seine Großmutter, wie ernst es ihm damit war und will nun alles gutmachen.«
Denise überlegte. »Nun, dann werde ich Dominik wohl erzählen müssen, daß er ein Wellentin ist«, meinte sie mit einem Anflug von Bitterkeit.
*
Der Junge war überrascht, daß sie schon wieder reisen wollten. Seine erste bange Frage war, ob Claudia sie nicht haben wolle. Aber darüber konnte ihn Denise trösten.
Alles andere konnte sie ihm nicht mit so einfachen Worten verständlich machen, aber er war ein intelligentes Kind und lauschte ihr sehr aufmerksam, als sie ihm sagte, daß er eine Urgroßmutter gehabt hätte, die nun gestorben sei.
Seine Urgroßmutter hatte er nicht gekannt, also konnte ihr Tod ihm nichts mehr bedeuten, als daß er ihm diese Reise einbrachte, wie seine Mami ihm erklärte.
Ihn interessierte vielmehr, ob er denn auch eine Großmutter hätte. Denise blieb nichts anderes übrig, als ihm zu sagen, daß es diese und auch einen Großvater gäbe.
Dominik blickte sie fragend an. »Aber mein Vater ist doch tot, Mami?« fragte er beklommen. »Du hast es doch nicht nur so gesagt?«
»Nein, ich habe es nicht so gesagt. Er ist lange tot. Er starb, bevor du geboren wurdest. Er ist verunglückt.«
»Warum haben mich meine Großeltern dann nicht besucht? Hätte ich sie nicht auch mal besuchen dürfen?«
»Sie mochten mich nicht, Nick«, erwiderte sie gleichmütig. »Mein Beruf gefiel ihnen nicht.«
»Wenn sie dich nicht mochten, mag ich sie auch nicht«, sagte er zornig. »Wozu fahren wir eigentlich dorthin, Mami?«
»Erinnerst du dich noch an die alte Dame, die euch Süßigkeiten und Spielsachen ins Heim schickte, Nick?«
»Ja, sie war sehr nett. Hat sie auch was mit denen zu tun?«
»Es war deine Urgroßmutter, Frau von Wellentin. Und du heißt eigentlich auch so.«
»Ich möchte aber lieber so heißen wie du«, erwiderte er ernst.
Es kostete sie große Überwindung, ihm zu sagen, daß auch sie diesen Namen führen könnte, es aber nicht wolle. Wie sollte ein kleiner Junge verstehen, was man für Beweggründe haben könnte, so zu handeln.
Aufmerksam sah Dominik seine Mutter an. »Du willst dich nicht so nennen, weil sie dich nicht mögen, nicht wahr?« fragte er dann.
»Du bist ein kluger und sehr lieber Junge, Nick. Nun werden wir erst einmal sehen, was sie von uns wollen. Du wirst ganz brav sein und still, nicht wahr? Eine Testamentseröffnung ist ein ernstes Ereignis.«
Dominik konnte sich darunter nichts vorstellen. Für ihn wurde diese Fahrt erst in dem Augenblick interessant, als sie am Bahnhof von einem großen dunklen Wagen und einem Chauffeur in grauer Livree erwartet wurden.
*
Dr. Brachmann hatte zu seiner Unterstützung seinen Sohn, der sein Sozius war, mitgebracht. Das Ehepaar von Wellentin war nach der Beisetzung auf Gut Sophienlust geblieben, um die Testamentseröffnung dort abzuwarten. Außer ihnen erschien noch ein hochgewachsener Herr in mittleren Jahren, den sie mit kühler Zurückhaltung begrüßten, weil sie sich auf seine Anwesenheit gar keinen Reim machen konnten. Es war Alexander von Schoenecker, der Gutsnachbar von Sophienlust, den man als Einsiedler bezeichnete. Auch seine beiden Kinder bekam man nie zu Gesicht.
»Wieso ist er anwesend?« fragte Hubert von Wellentin Dr. Brachmann ungehalten.
»Auf Wunsch der Verstorbenen«, erwiderte dieser.
»Können wir nun endlich beginnen?« fragte Hubert von Wellentin herablassend. »Meine Zeit ist begrenzt.«
»Wir sind noch nicht vollzählig. Aber da höre ich schon den Wagen.« Er wandte sich seinem Sohn zu. »Lutz, würdest du bitte Frau Montand empfangen?«
Der junge Dr. Brachmann ging hinaus, während Hubert von Wellentin den Notar fassungslos ansah!
»Das ist ja ungeheuerlich!« sagte er.
»Es ist von der Verstorbenen so bestimmt, und ich habe ihren letzten Willen zu vollstrecken.«
Trotz ihres schlichten dunkelblauen Kostümes sehr hoheitsvoll anmutend, betrat Denise Montand, ihren Sohn an der Hand, die Halle des Gutshauses Sophienlust.
War der junge Dr. Brachmann schon überrascht gewesen, als er in Denise Montand eine so schöne Frau kennenlernte, war dies sein Vater in noch größerem Maße.
Von einer allgemeinen Vorstellung wurde Abstand genommen, da Hubert und Irene von Wellentin mit eisiger Miene zu verstehen gaben, daß sie darauf keinen Wert legten, und da auch Denise ihnen nicht mehr als einen flüchtigen Blick schenkte.
Alexander von Schoenecker, der abseits stand, betrachtete die junge Frau und das Kind unter halb geschlossenen Lidern.
»Darf ich die Herrschaften bitten, Platz zu nehmen«, forderte Dr. Brachmann. Man konnte ihm ansehen, daß er sich sehr unbehaglich fühlte.
Dominik klammerte sich noch fester an seine Mutter. Er war froh, daß sie hinter diesen Leuten saßen, die seine Großeltern sein mußten, denn ganz leise hatte ihm seine Mami zugeraunt, daß diese auch anwesend wären. Aber wer war der Herr mit dem düsteren Gesicht, der ihn immer wieder ansah?
Der alte Herr war eigentlich ganz nett. Seine Stimme klang jetzt ruhig durch den Raum.
»Wir haben uns hier versammelt, um den letzten Willen Frau Sophie von Wellentins zu vernehmen«, begann er. »Ich bin beauftragt, ihn zu vollstrecken. Darf ich mit der Verlesung beginnen?« Er blickte sich um. Es war totenstill.
»Ich, Sophie von Wellentin, geborene von Lettin, verfüge bei Vollbesitz meiner geistigen Kräfte meinen Letzten Willen. Mein Notar, Herr Doktor Ludwig Brachmann, wird das bestätigen, jedoch wurden auf meinen besonderen Wunsch als Zeugen gerufen: Herr Alexander von Schoenecker und Herr Doktor Lutz Brachmann. Alle meine früher getroffenen Verfügungen werden hiermit aufgehoben.«
Dr. Brachmann machte eine Pause, dann fuhr er fort:
»Zu meinem Alleinerben bestimme ich Dominik von Wellentin, den Sohn meines tödlich verunglückten Enkels Dietmar von Wellentin.«
Dr. Brachmann machte eine abwehrende Handbewegung, als Hubert von Wellentin aufsprang.
»Sie können Einwände später vorbringen, Herr von Wellentin«, empfahl er kühl.
»Ich bitte, die Vorlesung nicht zu unterbrechen!«
»Es liegen Beurkundungen vor, die Dominik von Wellentin als ehelichen Sohn Dietmar von Wellentins bestätigen«, fuhr Dr. Brachmann ruhig fort. »Ich habe später noch einen Brief der Verstorbenen zu verlesen, der allen Anwesenden jede Aufklärung gibt. Es folgt nun die Aufzählung des Besitzes. Es umfaßt das Gut Sophienlust mit allen Anwesen, mein Vermögen im Gesamtwert von zwanzig Millionen Euro sowie das lebende und tote Inventar des Gutes Sophienlust.
Meinen Schmuck übereigne ich Frau Denise von Wellentin, genannt Montand.
Herr Alexander von Schoenecker erhält für seine Zusicherung, daß die künftigen Bewohner von Sophienlust den See, der zwischen unseren beiden Besitzungen liegt, ungehindert benutzen können, 30 Hektar Land, über dessen Ankauf er mit mir verhandelte.
Mein Aktienbesitz an den Fabriken meines Sohnes Hubert von Wellentin verbleibt der Erbmasse. Sollte sich mein Sohn eines Tages zu seinem Enkel bekennen, wird er ihm zufallen.
Es sind Vorkehrungen getroffen, daß dieses Testament unanfechtbar und rechtsgültig wird.« Dr. Brachmann legte nun das Schriftstück auf den Tisch.
Damit war der offzielle Teil erledigt. Noch immer herrschte Totenstille.
»Nun schreite ich zur Verlesung des Briefes, der den letzten Willen Frau Sophie von Wellentins erklären soll«, ließ Dr. Brachmann sich erneut vernehmen.
Er sah Denise Montand prüfend an. Eigentlich hatte er erwartet, in ihrem Gesicht Triumph zu lesen, aber sie saß zur Statue erstarrt und schien das Gehörte nicht zu begreifen. Sophienlust, zwanzig Millionen! Der Junge begriff die Tragweite natürlich erst recht nicht.
Sophie von Wellentin hatte genau niedergelegt, wie ihr die Existenz des Kindes bekannt geworden war, und was sie danach unternommen hatte, um mit Denise in Verbindung zu kommen.
Ich empfinde tiefe Reue, daß ich meinem Enkel einmal meine Unterstützung versagte. Gleichzeitig empfinde ich große Hochachtung und Bewunderung für eine Frau, die materielle Vorteile aus dieser Verbindung weder beanspruchte, noch den geringsten Versuch machte, ihre Rechte zu wahren. Ich erwarte von meinem Sohn, daß auch er dies respektiert. Als Mutter und gesetzlicher Vormund meines Urenkels kann Frau Denise von Wellentin über die künftige Verwendung des Gutes Sophienlust eigene Entscheidungen treffen. Herr Dr. Brachmann wird sie unterstützen. Mein Wunsch wäre es, daß dieses Haus zu einem Heim für Kinder umgestaltet wird, die Elternliebe entbehren müssen oder ihrer Eltern beraubt wurden. Es schmerzt mich, daß ich Denise nicht besser kennenlernen durfte. Aber ich bin überzeugt, daß sie einer solchen Aufgabe gerecht werden könnte. Jedoch soll sie selbst entscheiden, ob sie sich einem solchen Ansinnen gewachsen fühlt.
Denise stiegen Tränen in die Augen. Diese Frau hatte den Weg zu ihr gesucht, und sie hatte sich ihrem aufrichtigen Bemühen verschlossen. Auch sie empfand bittere Reue.
Alles begann sich um sie zu drehen. »Verzeihung, mir ist nicht gut«, sagte sie leise, »könnte ich
bitte einen Augenblick hinausgehen?«
Vor diesen fremden Menschen wollte sie ihre Tränen nicht zeigen. Sophie von Wellentin war tot. Sie konnte ihr nicht einmal mehr für ihre Großherzigkeit danken. Dabei dachte Denise gar nicht an das Vermögen, sondern daran, daß eine alte Dame so warme Worte über sie äußerte und ihr eine so unerwartete Rechtfertigung zuteil werden ließ.
Dominik ging hinter ihr her.
»Warum weinst du, Mutti?« fragte er leise. »Er hat doch nichts Böses gegen dich gesagt!«
Sie nahm ihn in die Arme. Ein riesiges Vermögen wartete auf ihn, aber für sie bedeutete es vor allem, daß sie mit ihrem Kind zusammenbleiben durfte. Und das hier auf diesem herrlichen Gut. Ohne Sorgen und noch dazu mit einer Aufgabe bedacht, deren Ausmaß ihr erst bewußt wurde, als sie ihren Blick durch den wundervoll gepflegten Park schweifen ließ.
»Hast du begriffen, daß dir dies alles gehören soll, Nick?« fragte sie ihn.
»Mir?« staunte er.
»Du bist der Erbe. Du kannst dir jetzt wünschen, was du willst!«
Er schmiegte sich an sie. »Ich wünsche mir nur, daß ich immer bei dir bleiben kann. Es ist schön hier, nicht wahr? Er hat gesagt, daß du ein Heim daraus machen kannst, Mutti«, sagte Dominik leise. Hier draußen erinnerte er sich plötzlich daran.
»Du kannst es bestimmen, Nick«, sagte sie liebevoll. »Alles gehört dir.«
»Warum eigentlich? Ich bin doch noch so klein. Warum bekommst du das alles nicht, Mutti?«
Weil sie es dann bestimmt anfechten könnten, dachte sie. Aber Dominik ist Dietmars Sohn. Daran gibt es nichts zu deuteln. Nun, ganz widerspruchslos werden sie es wohl nicht hinnehmen, aber ausrichten werden sie wohl kaum etwas können.
Sie hörte nichts von der harten Diskussion, die drinnen entbrannt war.
Sie ging mit Dominik durch den frühlingshaften Park, in dem die Natur in all ihrer Lieblichkeit erwachte.
»Ein Heim für glückliche Kinder«, meinte der Junge plötzlich. »Es wäre doch wunderschön, Mutti. Sie dürften dann auch lachen und alles tun, was sie bei Madame Merlinde nicht durften. Hier ist ja so viel Platz. Zuerst holen wir Susi, nicht wahr? Ich habe ihr doch versprochen, daß sie zu uns kommen darf, wenn wir ein schönes Haus haben. Und nun haben wir eins!«
Daran hätte ich zu allerletzt gedacht, überlegte Denise, aber nun erleuchtete ein Lächeln ihr Gesicht.
»Eine tolle Idee, Nick«, lobte sie. Dann hörte sie, wie ein Auto davonfuhr, und gleich darauf kam Dr. Brachmann zu ihnen.
»Herr und Frau von Wellentin haben Gut Sophienlust verlassen«, sagte er ruhig.
»Ich habe nichts anderes erwartet«, erwiderte Denise.
»Es sollte Sie nicht stören, gnädige Frau. Wenn Sie sich erholt haben, dann gibt es noch manches zu besprechen. Aber jetzt werden Sie und vor allem dieser junge Mann hungrig sein. Nach dem Essen können wir uns dann weiter unterhalten. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen einzuwenden, daß ich Herrn von Schoenecker gebeten habe, an unserem Mittagsmahl teilzunehmen.«
»Wenn er nichts einzuwenden hat?« entgegnete Denise.
»Er ist kein Freund von Herrn von Wellentin«, stellte Dr. Brachmann fest.
*
Alexander von Schoenecker saß Denise gegenüber. Abgesehen davon, daß sein Gesicht verschlossen wirkte, war er ihr durchaus sympathisch. Sein schmales ernstes Gesicht wurde von klugen dunklen Augen beherrscht, die einen unergründlichen Ausdruck hatten.
Neben ihm wirkte der junge Dr. Brachmann heiter und aufgeschlossen. Er machte manche kleine Späße mit Dominik, der schon etwas von seiner Scheu verloren hatte.
»Nun, gefällt es dir hier?« fragte er ihn.
»Sehr gut. Ich muß mir aber alles noch anschauen. Gibt es auch Hunde?«
»Senta hat gerade fünf Junge geworfen«, verriet Lutz Brachmann.
»Was ist sie für ein Hund?«
»Eine Hündin«, berichtigte Denise, und unwillkürlich sah Alexander von Schoenecker sie erstaunt an. Sie begegnete seinem Blick und lächelte.
»Ich bin dafür, daß er gleich alles richtig sagt«, meinte sie.
Dominik nickte. »Ein Hund ist keine Hündin. Was ist sie für eine Hündin?«
»Eine Spanielhündin«, erklärte ihm Lutz Brachmann. »Du wirst sie nachher kennenlernen.«
»Werde ich sie auch streicheln dürfen? Denn sie kennt mich doch noch gar nicht.«
»Tiere spüren, wenn jemand sie gern mag«, warf Dr. Brachmann ein.
»Kinder auch«, erwiderte Dominik ernst. »Ich habe alle Tiere gern. Ich möchte gern viele Tiere haben. Wieviel Kinder werden hier Platz haben, Mutti?« lenkte er dann ab.
»Mein Sohn zerbricht sich jetzt schon den Kopf darüber«, sagte Denise entschuldigend.
»Ein paar Kinder weiß ich nämlich schon, die lieber hier sein würden als bei Madame Merlinde. Dort gibt es nämlich keine Tiere«, berichtete Dominik. »Ich darf doch sagen, was ich denke, Mutti?«
»Gewiß, aber wir wollen nichts überstürzen.«
»Aber Herr Brachmann hat gesagt, daß Sophienlust mir gehört, und da darf ich doch auch überlegen, was ich damit machen will.«
Er hatte sich sehr rasch mit der Tatsache abgefunden, ein reicher Erbe zu sein. Gewiß spielte Geld für ihn noch nicht die Rolle wie für
einen Erwachsenen, aber eines hatte er bereits begriffen, daß sein größter Wunsch in Erfüllung ging, seine Mutti und seine liebsten Spielgefährten immer bei sich zu haben.
Zutraulich ging er mit Lutz Brachmann, um Senta, die Spanielhündin, zu besuchen.
Bevor Denise ihnen folgen konnte, trat Alexander von Schoenecker an sie heran. »Sie haben ein erstaunliches Kind, gnädige Frau. Ich wünschte, meine Kinder wären auch so aufgeschlossen.«
»Wie alt sind sie?« fragte Denise zurückhaltend.
»Acht und zehn Jahre alt. Aber für ein Kind ist es wohl wichtiger, wenn es die Mutter behält, statt den Vater«, fügte er mit belegter Stimme hinzu. »Meine Kinder haben ihre Mutter vor vier Jahren verloren.«
»Sind sie bei Ihnen?« fragte Denise wie unter einem Zwang.
»Nein, in einem Internat. Ich kann mich nicht so recht um sie kümmern. Aber wenn Sie wirklich ein Heim aus Sophienlust machen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn die beiden manchmal zu Ihnen kommen dürften.«
»Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Herr von Schoenecker.«
»Ich bin mit Ihren Angelegenheiten ungewollt konfrontiert worden«, erwiderte er verhalten. »Aber ich finde, daß Frau von Wellentin eine gute Entscheidung getroffen hat. Ich hoffe, Ihnen ein guter Nachbar zu werden.«
»Vielen Dank!«
Denise war erstaunt, daß dieser verschlossene Mann so offen mit ihr sprach. Doch es war gut, ein paar Freunde zu gewinnen, denn vielen würde sie wohl als Eindringling, wenn nicht gar als Erbschleicherin erscheinen. Vor allem Hubert von Wellentin und seine Frau würden schon dafür sorgen.
*
»Wir können nicht dulden, daß sie unter unserem Namen hier lebt«, erklärte Irene von Wellentin ihrem Mann. »Sie macht uns unmöglich. Es glaubt doch kein Mensch, daß Dietmar sie tatsächlich geheiratet hat.«
»Der Trauschein besagt es. Ich habe eine Abschrift gesehen«, erwiderte Wellentin gereizt. »Niemals hätte ich gedacht, daß Mutter uns so brüskieren könnte.«
»Nun läßt sich nichts mehr ändern. Doktor Brachmann hat es uns eindeutig zu verstehen gegeben. Ein Zweifel, daß der Junge Dietmars Sohn ist, dürfte auch nicht bestehen, dazu ist er ihm viel zu ähnlich. Für mich ist es ein entsetzlicher Gedanke, daß unser Sohn starb, ohne uns die Wahrheit gesagt zu haben«, sagte Irene von Wellentin.
»Hätte das etwas geändert?« knurrte er.
»Ja, wir hätten versuchen können, das Kind ihrem Einfluß zu entziehen. Da er nun einmal Dietmars Sohn ist, wäre es besser gewesen, wenn er in unserem Sinn erzogen worden wäre.«
»Vielleicht ist das noch zu korrigieren? Ich könnte mir vorstellen, daß es ihr eher zusagen würde, ein freies Leben zu führen, als in Sophienlust zu versauern. Mit einer entsprechend hohen Abfindung wird sie sich bestimmt bereitfinden, uns das Sorgerecht zu übertragen.«
Irene von Wellentin überlegte, daß dieser Zeitpunkt wohl verpaßt war, aber sie war es nicht gewohnt, ihrem Mann zu widersprechen, demzufolge schwieg sie.
*
Dominik war überglücklich, daß sie gleich in Sophienlust blieben. Mit dem Personal hatte er sich schon vertraut gemacht. Zuerst recht reserviert, tauten die langjährigen Angestellten rasch auf. Dem Charme dieses kleinen Jungen und der natürlichen Anmut seiner schönen Mutter konnte man nur schwer widerstehen. Sie hatten alle ihr gutes Auskommen hier gehabt, und sie waren gern bereit, weiterhin hierzubleiben. Wenn ihnen die Idee, ein Kinderheim aus Sophienlust zu machen, auch noch nicht ganz geheuer war.
Diese Tatsache machte ziemlich schnell die Runde. Lena, das Stubenmädchen, hatte gelauscht. Bald wußte es Magda, die Köchin, Urban, der Diener, und auch Justus, der Verwalter.
»Abwarten und Tee trinken«, meinte Magda. »Wenn es unsere liebe gnädige Frau so gewollt hat, sollten wir nicht meutern.«
Müde von diesem anstrengenden Tag, waren Denise und Dominik rasch eingeschlafen. Es blieben ja noch viele Tage Zeit, alles genau zu inspizieren.
Aber bereits nach wenigen Stunden erwachte sie. Leise erhob sie sich, zog sich den Mantel über und ging auf Zehenspitzen die Treppe hinab.
Sie verspürte eine seltsame Beklemmung, während sie eine Tür öffnete. Hatte sie das Recht dazu? fragte sie sich. In diesen Räumen hatte Sophie von Wellentin gelebt, hier hatte Dietmar als Kind die Ferien verbracht. Sie wußte es aus seinem Munde. Es war die Zeit seiner Kindheit, derer er sich gern erinnert hatte. Aber dann hatte auch die geliebte Großmutter ihn nicht verstanden, und er war verzweifelt zu Denise gekommen, um ihr das zu sagen.
Denise drückte auf den Lichtschalter. Gedämpfte Helligkeit durchflutete den Raum. Sophie von Wellentins Lieblingszimmer
Die Biedermeiermöbel paßten zu dem Bild, das sie sich inzwischen von Sophie von Wellentin gemacht hatte. Wie einsam mochte sie nach Dietmars Tod gewesen sein, mit all ihren Zweifeln und Selbstvorwürfen.
Auf dem zierlichen Sekretär stand eine Aufnahme von Dietmar, die kurz vor seinem Tod gemacht worden war. Denise besaß das gleiche Bild. Aber hier, in dem kostbaren Rahmen wirkte es anders. Dietmar hatte in diese Welt gehört. In einem einfachen Leben hätte er sich niemals zurechtgefunden. Leider hatte sie das erst erkannt, als sie ihm schon mit Leib und Seele gehörte.
Leise öffnete sie eine zweite Tür. Ihre Füße versanken in weichen Teppichen. Zwei Wandleuchter warfen ihr Licht auf ein Ölgemälde, das die gegenüberliegende Wand beherrschte. Es stellte eine schöne Frau mit sprechenden Augen dar, die einen Knaben von etwa fünf Jahren im Arm hielt.
Sophie von Wellentin mit ihrem Sohn. Eine junge lebensfrohe Frau, die ihr Kind gewiß sehr geliebt hatte. Wie konnten Mutter und Sohn sich nur so entfremden?
Erschrocken fuhr sie zusammen, als sie Schritte hinter sich vernahm. Es war Magda, die Köchin.
»Verzeihung, gnädige Frau!« bat sie. »Ich wachte auf und erschrak, als ich Licht sah. Ich wollte Sie nicht stören.«
»Sie stören mich nicht«, erwiderte Denise ruhig. »Sie erinnern mich nur daran, daß ich zu dieser Stunde nicht hier sein sollte.«
»Aber Sie können doch sein, wo Sie wollen«, meinte Magda. »Wir sind es nur nicht gewohnt, daß wieder Leben im Haus ist. Es ist schade, daß Sie nicht schon früher hiersein konnten. Es wäre für unsere gnädige Frau ein großes Glück gewesen. Sie war so allein. Sie können sich auf uns verlassen, gnädige Frau, und der junge Herr auch.«
»Nun, dann verwöhnen Sie mir den ›jungen Herrn‹ bitte nicht so sehr!« erwiderte Denise mit einem lieben Lächeln. »Er ist erst fünf Jahre alt und kann ein rechter Schlingel sein. Darf ich Sie um etwas bitten, Magda?«
»Aber jederzeit.«
»Dann erzählen Sie mir oft von Frau von Wellentin.«
»Ihr Geist wird jetzt lebendig bleiben«, erwiderte Magda gedankenvoll. »Sie wußte genau, was sie tat, als sie ihr Testament machte. Und wir wissen jetzt auch, warum sie es so wollte«, fügte sie rätselhaft hinzu.
»Wenn wir nun hier ein Heim für heimatlose Kinder einrichten, Magda, werden Sie dann auch bleiben?«
»Wir sind hier verwurzelt«, war die nachdenkliche Antwort.
»Das haben Sie schön gesagt. Ich denke, Dominik wird hier auch bald Wurzeln schlagen«, sagte Denise.
»Und Sie, gnädige Frau? Wir möchten es Ihnen gern erleichtern.«
»Ich danke Ihnen sehr, Magda«, antwortete sie verhalten. »Sie haben mir den Anfang bereits sehr leicht gemacht.«
*
Für Dominik brachte der kommende Tag so viele Wunder, daß er sich gar nicht beruhigen konnte. Schon das Erwachen war so herrlich.
Er war mit seiner geliebten Mutti in Sophienlust, und hier durften sie nun endlich vereint bleiben.
Vom Fenster seines wunderschönen Zimmers konnte er den Park überblicken. Rot, gelb und weiß blühten die Sträucher, und herrlich grün leuchtete der Rasen. Von den Ställen klang das Wiehern der Pferde herüber, und dann hörte Dominik Senta bellen.
Senta und die niedlichen kleinen Hunde. Gleich nachher mußte er mit Mutti Namen für sie suchen.
Ponies dürfe er sich auch wünschen, hatte Dr. Brachmann zu ihm gesagt. Es war alles unfaßbar für ihn, weil er bisher geglaubt hatte, so etwas gäbe es nur im Märchen. Aber die Märchen waren längst nicht so schön wie die Wirklichkeit.
Die Menschen waren alle so nett. Noch vor ein paar Tagen hatte er geglaubt, daß Claudia der einzige Mensch wäre, der ihn, Mutti ausgenommen, lieb hätte. Aber nun gab es plötzlich eine ganze Reihe. Ob Mutti verstand, daß er so gern hierbleiben wollte? Natürlich mußte sie bei ihm bleiben, denn ohne sie war es nirgendwo schön. Das mußte er ihr gleich sagen!
Auf nackten Füßen tappte er in ihr Zimmer und war enttäuscht, daß sie nicht mehr im Bett lag. Zu gern hätte er sich zu ihr gekuschelt und ihr all das erzählt, was ihn bewegte.
Er warf sich in ihre Arme und lächelte zu ihr empor. »Zuerst habe ich gedacht, ich hätte alles geträumt, Mutti, aber wir sind wirklich hier! Die Pferde habe ich schon gehört, und Senta hat gebellt. Ob sie mich wiedererkennt?«
»Ganz bestimmt, Nick«, versicherte Denise.
»Wir müssen nachher Namen für die Kleinen suchen, und dann müssen wir uns ganz viel anschauen, Mutti.«
»Zuerst werden wir einmal frühstücken!« schlug sie vor.
Solch ein herrliches Frühstück hatte Dominik noch nie gegessen. Lena brachte einen ganzen Wagen voll der köstlichsten Dinge, und er konnte wählen, was er wollte.
»Wenn Susi das alles sehen könnte«, seufzte er. »Darf sie bald kommen, Mutti?«
Sie konnte es ihm nicht versprechen, denn sie wußte nicht, welche Verfügungen über den Verbleib der kleinen Susanne Berkin im Hause Bernadette getroffen worden waren. Aber sie versprach Dominik, alles zu versuchen.
»Es hat sich doch nie jemand um sie gekümmert«, meinte er. »Sie war immer ganz traurig, wenn du mich besuchst hast und hat sich so sehr gewünscht, auch eine so liebe Mutti zu haben.«
Unwillkürlich erinnerte Denise sich an die Kinder von Alexander von Schoenecker. Ob sie sich auch so sehr nach ihrer Mutter sehnten? Warum versuchte der Vater nicht, seinen Kindern die Mutter zu ersetzen?
Warum überließ er sie fremden Menschen, obgleich er über die Möglichkeit verfügte, sie bei sich zu haben?
Erinnerten sie ihn zu sehr an die Frau, die er sehr geliebt hatte? Sie betrachtete Dominik nachdenklich. Er erinnerte sie auch ungemein an Dietmar, aber wenn sie darüber nachdachte, gestand sie sich ein, daß ihr das Kind mehr bedeutete als es Dietmar je getan hatte.
»Wir wollen auch der Urgroßmama Blumen aufs Grab legen«, riß Dominik sie aus ihren Gedanken.
Und seinem Vater, überlegte Denise. Zum erstenmal kann ich das tun, ohne fürchten zu müssen, daß jemand sie wegnimmt.
»Es hat ganz herrlich geschmeckt. Danke, Lena«, sagte Dominik.
»Da mußt du dich schon bei Magda bedanken«, erwiderte sie.
»Dann werde ich rasch in die Küche gehen«, erklärte er eifrig. »Das darf ich doch, Mutti?«
In der Küche saßen Magda und Urban beim Frühstück. Für sie war es schon das zweite, aber das wußte Dominik natürlich nicht.
»Ich will nicht stören«, sagte er schüchtern. »Ich wollte mich nur bedanken, weil es so gut geschmeckt hat. Warum eßt ihr nicht mit uns?«
Sie lächelten verlegen.
»Wir würden auch gern in der Küche frühstücken«, meinte er treuherzig. »Dann hätte Lena nicht doppelte Arbeit.«
»Das führen wir gar nicht ein«, antwortete Magda. »Wenn erst die Kinder hier sind, da haben wir in der Küche nicht alle Platz. Was meinst du wohl, junger Herr, wieviel Kinder es werden?«
Dominik betrachtete sie erstaunt. »Ich bin kein junger Herr. Ich bin Nick, wenn ihr mich gern habt. Vielleicht werden es fünf oder zehn? Ob die Platz haben? Es sollen natürlich liebe Kinder sein, die euch nicht ärgern. Im Haus Bernadette hatten wir ein paar ganz liebe Kinder. Wenn Susi kommen könnte, würde ich mich schon arg freuen. Sie würde euch ganz bestimmt gefallen. Aber ich habe euch ja noch gar nicht gefragt, ob ihr Kinder haben wollt?«
Wenn bis zu diesem Augenblick bei ihnen noch ein Zweifel bestanden hätte, wäre er jetzt besiegt gewesen. Freilich mochten sie Kinder!
»Ich dachte nur«, meinte Dominik, »weil wohl schon ziemlich lange keine Kinder mehr hier gewohnt haben.«
»Zu lange«, lächelte Magda und strich ihm über das Haar.
*
Die Taufe von Sentas Hundekindern wurde würdevoll vollzogen, wenngleich die Namen, die Dominik sich für sie ausgedacht hatte, recht bescheiden waren. Die kleinen Hundeherren wurden Bim, Bam und Bum genannt, und die beiden Hundedamen Bella und Blondi.
Der Verwalter Justus bewahrte Haltung, obgleich er sich das Lachen nur schwer verkneifen konnte. Später erklärte er Denise, daß Senta einer überaus vornehmen Hundefamilie entstamme und daß alle Kinder bereits entsprechende Namen in ihren Stammbaum eingetragen bekommen hätten. Aber das wollten sie Dominik lieber verschweigen.
Senta anerkannte den Jungen jedenfalls als ihren Herrn, und darüber war er sehr stolz. Er durfte die Hündin streicheln, und ganz unterwürfig schleckte sie ihm dafür die Füße.
Nun wurde der Zweispänner angespannt, und die Fahrt durch das Land, das zu Sophienlust gehörte, begann.
Dominik konnte es nicht glauben, daß all diese Herrlichkeit ihm gehören sollte, wie Justus ihm mehrmals bestätigte.
»Es ist ein herrlicher Besitz«, sagte Denise lobend.
»Daß er so erhalten geblieben ist, ist allein der gnädigen Frau zu verdanken«, erwiderte Justus. »Herr von Wellentin hätte das meiste Land verkauft. Er hat nur an seine Fabriken gedacht und hätte hier am liebsten auch welche hingestellt.«
Als Denise darauf schwieg, erklärte er: »Dort drüben beginnt Schoeneich.« Dabei deutete er mit der Hand zum See.
»Wird es Herrn von Schoenecker nicht stören, wenn dort die Kinder baden?«
»Er hat ja den Wald dafür bekommen«, meinte Justus, »und er ist mehr wert.«
»Hatte Frau von Wellentin einmal die Idee, das Gut einem anderen Verwendungszweck zuzuführen?« fragte Denise.
»Mit mir sprach sie darüber ein paar Wochen vor ihrem Tode. Es überraschte mich sehr. Sie war anders als sonst. Sie war eine gute Herrin, aber doch sehr auf ihren Besitz bedacht. Sie meinte, daß es eigentlich ungerecht sei, wenn eine alte Frau allein ein so großes Haus bewohne und sich um nichts zu kümmern brauche.«
»Sie war eine sehr gütige Frau, Justus«, bemerkte Denise.
»Sie war eine gerechte Frau«, erklärte er. »Sie litt darunter, daß sie einmal ungerecht gewesen war.«
»Das wollen wir vergessen…«
*
Wie wird es wohl ausgegangen sein, überlegte Claudia Rogers, als sie am Bett eines kranken Kindes Nachtwache hielt. Hoffentlich besiegt Isi endlich ihren Stolz und wahrt die Interessen des Kindes!
Der kleine Junge, der da in tiefer Narkose im Bett lag, war gestern bei einem Autounfall seiner Eltern beraubt worden. Voll heißen Mitgefühls hatte sich Claudia des verletzten Kindes angenommen.
Ihr Blick fiel auf das Namensschild über dem Bett: Mario Stolten. Er war vier Jahre alt und besaß keine Eltern mehr. Bisher hatten sich auch keine Angehörige gemeldet.
Wenn sie morgen früh heimkam, ob sie dann eine Nachricht von Denise vorfinden würde? Oder ob sie gar selbst mit Dominik zurückgekommen war?
Die Tür wurde leise geöffnet. Dr. Wolfram, der junge Assistenzarzt, trat ein. Er war erst seit ein paar Wochen an der Klinik und riß sich noch förmlich um den Dienst.
Aber dann dachte Claudia, daß er immer da war, wenn auch sie Dienst hatte.
Sie fand ihn ganz sympathisch. Doch er war nicht der erste Arzt, der Interesse für sie zeigte.
Heinz Wolfram war Junggeselle und ein netter, bescheidener Junge. Ja, noch ein richtiger Junge, der sie jetzt schüchtern bat, wenigstens eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken, wenn sie schon unbedingt die Nachtwache bei dem Kleinen übernehmen wolle.
»Er ist doch gar nicht so schwer verletzt«, meinte er. »Der Armbruch ist glatt, die Gehirnerschütterung leicht, die Schnittwunden haben wir gut klammern können.«
»Er hat seine Eltern verloren«, sagte Claudia ermahnend. »Solche Wunden kann man nicht so schnell schließen.«
»Gewiß«, gab er zu, »aber sicher wird sich doch jemand seiner annehmen. Er wird Verwandte haben, die sich um ihn kümmern, und wenn man erst vier Jahre alt ist, vergißt man schneller. Ich finde es allerdings rührend, daß Sie sich so sehr um ihn kümmern.«
Sie hatte keine Lust, sich am Bett des kleinen Mario mit ihm zu unterhalten, andererseits meinte sie, daß ihr eine Tasse Kaffee guttun würde. Es verpflichtete sie ja zu nichts.
Sie betrachtete Dr. Wolfram nachdenklich. Er war kein Frauentyp, und er sah auch nicht aus, als wäre er auf ein Abenteuer aus. Nun, da käme er bei ihr ohnehin an die falsche Adresse.
Er dagegen sah ein ungewöhnlich apartes Mädchen vor sich, das noch viel mehr aus sich hätte machen können, wenn es sich nicht so betont streng herrichten würde. Ein Mittelscheitel teilte ihr honigblondes Haar, das streng nach hinten gebunden war und unter dem weißen Häubchen versteckt wurde. Augen von bernsteinheller Durchsichtigkeit verliehen ihrem ovalen Gesicht einen ganz besonderen Reiz.
»Meinen Sie nicht, daß wir uns öfter einmal unterhalten könnten?« fragte er. »Vielleicht darf ich Sie auch einladen, ins Theater oder Konzert?«
»Sie meinen es sicher gut, Herr Doktor«, erwiderte sie freundlich, »aber meine Zeit ist ziemlich ausgefüllt.«
»Oh, sind Sie bereits engagiert?« fragte er betroffen.
»Ziemlich«, lächelte sie. »Ich habe eine Freundin, die einen Sohn hat. Wir sind sehr befreundet. Zur Zeit sind sie verreist.«
Sie kamen wieder auf den kleinen Mario zu sprechen. »Was wird aus diesem kleinen Kerl werden, wenn sich niemand um ihn kümmert?« fragte Claudia gedankenvoll.
»Nun, so unerfreulich dies auch klingen mag, aber er wird dann wohl in ein Waisenhaus kommen«, stellte Dr. Wolfram sachlich fest.
Männer haben eben kein Gefühl, dachte Claudia.
Nun, auch Dominik war in einem Heim aufgewachsen, allerdings nicht in einem Waisenhaus, und seine kindliche Seele hatte keinen Schaden genommen. Aber er hatte immerhin gewußt, daß seine Mutter da war, daß sie ihn besuchte, und er hatte sich immer auf den Tag gefreut, an dem sie ihn zu sich nehmen würde.
Für Waisenkinder gab es eine solche Freude nicht. Vielleicht hatte manch eines das Glück, eines Tages in einer Familie aufgenommen zu werden, aber wie wenige waren es doch, die ein wirkliches Zuhause fanden, mit echter Liebe ohne Vorurteile.
Sie sprachen noch ein wenig über den kleinen Mann, dann war ihr Plauderstündchen auch schon beendet. Er mußte auf seine Station, sie kehrte an Marios Bett zurück.
Der Kleine bewegte sich unruhig. »Mutti… Vati«, flüsterte er angstvoll. Und dann: »Ein Reh! Da ist ein Reh!«
Seine Warnung war zu spät gekommen. Das Reh war in den Wagen gesprungen, der darauf ins Schleudern geriet und an einen Baum raste. Vielleicht hatte Mario sich instinktiv geduckt, und das hatte ihm das Leben gerettet. Aber wäre es für ihn nicht besser gewesen, wenn er mit seinen Eltern gestorben wäre?
Gegen Morgen weinte er noch einmal schmerzlich auf.
»Ich will zu meiner Mutti. Wo ist meine Mutti!«
Tröstend beugte sich Claudia über ihn. »Sie wird schon kommen«, griff sie zu einer Notlüge.
»Du bist lieb, Tante«, murmelte er. »Bitte, bleib bei mir! Ich habe Angst.«
Erschöpft schlief Claudia an seinem Bett ein, als der Morgen graute.
*
Der Chefarzt hatte ein Machtwort sprechen müssen und sie heimgeschickt.
»Es fehlte mir gerade noch, daß meine beste Schwester zusammenklappt und ausfällt«, hatte er gezankt.
Kaum war Claudia zu Hause, da läutete es, und ein Eilbrief wurde für sie abgegeben. Ein Brief von Denise!
Alles hat sich plötzlich geändert, las Claudia. Erklären kann ich es Dir erst persönlich. Bitte komme, so bald es Dir möglich ist, und kündige Deine Stellung zum nächsten Termin! Du wirst dich überzeugen können, daß hier Aufgaben Deiner harren, von denen Du manchmal träumtest. Ich kann Dir versprechen, daß alle Deine Erwartungen übertroffen werden.
Das alles klang ein bißchen wirr. Jedenfalls schien Denise eine Erbschaft gemacht zu haben und wollte nun sofort mit ihr teilen, wie sie mit ihr geteilt hatte in der Not.
Doch Claudia war ein nüchtern denkendes Mädchen. Seltsamerweise mußte sie auch sofort an den kleinen Mario denken, der nach
seiner Mutti weinte. Wer sollte ihn trösten? Für die andern war er ein bemitleidenswerter Fall, aber für sie bedeutete er mehr, weil sie
frühzeitig erfahren hatte, was es bedeutete, keine Eltern mehr zu besitzen.
Obgleich sie todmüde war, schrieb sie Denise einen langen Brief und schilderte ihre Bedenken.
Ich würde gern kommen, aber im Augenblick kann ich nicht, schrieb sie zum Schluß und schilderte dann Marios Schicksal.
Bedächtig schrieb sie die Adresse. »Gut Sophienlust.« Es klang anheimelnd, doch es wunderte sie, daß sich Denise mit ihrem Jungen dort noch aufhielt. War es gar zu einer Versöhnung mit Dietmars Eltern gekommen?
Dann brachte sie den Brief zur Post.
*
»Na, ich muß ganz schön wirres Zeug geschrieben haben«, lächelte Denise, als sie Claudias Brief bekam. »Claudia kann wohl gar nicht glauben, daß wir sie wirklich brauchen.«
»Hast du denn nichts davon geschrieben, daß wir hier ein Kinderheim einrichten wollen, Mutti?« fragte Dominik.
»Das wollte ich ihr lieber mündlich sagen.«
»Wie es wirklich ist, kann sie sich ja gar nicht vorstellen«, schwärmte er. »Das muß sie sehen. Sie wird mächtig staunen. Aber sie wird doch bestimmt zu uns kommen, Mutti?«
»Ich hoffe es jedenfalls sehr«, meinte seine Mutter gedankenvoll.
»Sie kann so lieb mit Kindern sein«, erinnerte Dominik.
»Das beweist sie gerade jetzt wieder. Sie betreut einen kleinen Jungen, der seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Sie möchte ihn jetzt nicht allein lassen.«
»Aber dann soll sie ihn doch mitbringen«, riet Dominik unbefangen. »Dann haben wir schon ein Kind, bis Susi kommt.«
Zu allererst dachte er natürlich immer an Susi, und Denise bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie sich mit Madame Merlinde noch nicht in Verbindung gesetzt hatte.
Das wollte sie gleich tun, sobald sie Claudia angerufen hatte. Vorerst aber wollte Dominik genau wissen, wie sie denn das Gutshaus aufteilen würden, und wo die Kinder untergebracht werden sollten.
Dafür schien Denise der Seitenflügel mit seinen vielen Gästezimmern geradezu ideal geeignet. Zehn geräumige Zimmer mit Nebenräumen enthielt er. In jedem Zimmer konnte man leicht zwei Kinder unterbringen. Justus, der Verwalter, der ihr seine Hilfe in allen Entscheidungen zugesichert hatte, griff ihre Idee freudig auf. Er schlug vor, vom Seitenflügel aus einen Durchbruch zum großen Speisesaal zu machen, der während der letzten Jahre niemals benutzt worden war.
Der Gartenpavillon, der erst kürzlich renoviert worden war, eignete sich vorzüglich als Spielzimmer.
Soweit waren sie gestern schon in ihren Planungen gekommen. Aber gar zu gern wollte Danise in ihrer Anhänglichkeit an Claudia diese an allen weiteren Plänen teilnehmen lassen.
Endlich konnte sie ihr danken, was sie in all den Jahren selbstlos für sie getan hatte.
*
Erst nachdem Claudia ihren Brief an Denise eingesteckt hatte und deren Brief noch einmal las, fiel ihr auf, daß als Absender nicht Denise Montand, sondern Denise von Wellentin angegeben war. Nun wurde für sie alles noch viel rätselhafter. Erst Denises Anruf erlöste sie aus ihren Betrachtungen.
Es wurde ein sehr langes Gespräch. Und Claudia kam aus dem Staunen nicht heraus, aber Denise versicherte ihr, daß sie alles ganz genau erfahren würde, wenn sie käme.
Ein wenig mehr wußte Claudia nun schon. Dominik war der Erbe von Gut Sophienlust, und dort sollte ein Kinderheim entstehen. Ein Heim für einsame, verlassene, elternlose Kinder, die dort alles finden sollten, was sie sonst entbehren müßten. Wahrhaft eine große Aufgabe wartete auf sie, und Claudia war bereit, sie zu übernehmen.
»Bring doch den kleinen Mario mit!« hatte Denise ohne Umschweife gesagt. »Wenn er sonst niemanden hat, ist es der richtige Platz für ihn, seinen Kummer zu vergessen.«
Das war einfach gesagt und von Herzen gut gemeint, aber war es auch zu verwirklichen?
Zuerst einmal mußte sie mit dem Chefarzt sprechen. Und als sie ihm alles genau geschildert hatte, konnte er sich ihren Argumenten nicht verschließen.
»Sie sind scheinbar zur Samariterin geboren, Claudia«, meinte er wehmütig.
»Ich habe noch eine Bitte, Herr Chefarzt«, sagte sie zuletzt. »Es handelt sich um Mario Stolten. Haben sich inzwischen Angehörige von ihm gemeldet?«
»Ja, er hat Großeltern. Aber diese leben in einem Altersheim und können ihn nicht zu sich nehmen. Sie sind ganz gut situiert und bereit, für den Jungen zu sorgen. Aber es wird ihm kaum erspart bleiben, in einem Heim aufzuwachsen.«
»Dann weiß ich eines«, erwiderte Claudia rasch.
Er lächelte. »Wundern würde es mich bei Ihnen wirklich nicht, Claudia.«
»Ich habe heute erst erfahren, daß meine Freundin ein Kinderheim gründet. Sie hat mir schon angeboten, Mario mitzubringen.«
»Noch eine Samariterin«, spottete er gutmütig. »Wenn Ihnen an dem Jungen so viel liegt, und wenn Sie sich eine solche Verantwortung aufbürden wollen, wenden Sie sich wohl am besten an seine Großeltern. Die Adresse erfahren Sie in der Verwaltung. Für den kleinen Kerl würde es mich ja freuen, wenn er ein Zuhause bekäme. Aber machen Sie ihm bitte keine Hoffnungen, ehe Sie nicht wissen, ob Sie Ihren Plan in die Tat umsetzen können!«
*
Die alten Stoltens waren ein ruhiges nettes Ehepaar, aber wie Claudia sich überzeugen konnte, zu alt, um ein Leben mit einem kleinen Jungen, den sie dazu noch kaum kannten, zu beginnen.
Claudia erfuhr, daß ihr Sohn spät geheiratet hatte. Erst mit vierzig Jahren und dazu eine blutjunge Italienerin.
Die Ehe sei glücklich gewesen, aber die Eltern ihrer Schwiegertochter wollten von dem deutschen Schwiegersohn nichts wissen und hatten auch nicht reagiert, als sie die Todesnachricht bekommen hatten.
Sie sahen Claudia staunend an, als sie ihnen eröffnete, daß sie Mario gern mit sich nehmen würde.
»Aber Sie kennen ihn doch kaum«, sagte die alte Frau Stolten. »Wir haben ihn zuletzt gesehen, als er zwei Jahre alt war. Diesmal wollten sie uns auf der Fahrt in den Urlaub besuchen, aber da geschah das Unglück, und wir dachten, es würde Mario wohl zu sehr aufregen, wenn wir ihn besuchten.«
Welche Gefühle sie wirklich bewegten, sprachen sie nicht aus. Danach wollte Claudia auch nicht forschen.
Für sie war es wichtig, daß ihr nichts in den Weg gelegt wurde, wenn sie das Kind mit sich nahm, und daß die Stoltens den Behörden Vollmachten erteilen wollten. Denn in ein Heim mußte es ohnehin gebracht werden, und da war es gleich, in welches.
*
Mario sah sie mit seinen traurigen Augen an, als sie sich an sein Bett setzte.
»Mutti und Vati kommen nicht wieder«, schluchzte er. »Der Chefarzt hat es mir gesagt.«
Clauda war ihrem Chef zutiefst dankbar, daß er ihr diese Aufgabe abgenommen hatte.
»Sie sind jetzt im Himmel, Mario, und blicken auf dich herab«, tröstete sie.
»Der liebe Gott hat sie fortgenommen, aber er hat nicht daran gedacht, daß Mario nun ganz allein ist.«
»Er hat gewußt, daß du nicht ganz allein sein wirst, mein Kleiner«, erwiderte sie liebevoll. »Wenn du magst, werden wir zwei eine Reise machen, und du wirst mit anderen Kindern leben und spielen.«
»Wo?« fragte er.
»Auf einem schönen Gut, wo es nicht nur Kinder, sondern auch Tiere gibt«, erzählte sie. »Meine Freundin hat auch einen kleinen Sohn, der ein Jahr älter ist als du. Er freut sich schon auf dich.«
»Aber er kennt mich doch noch gar nicht«, flüsterte er. »Und was machst du dann, Claudia? Gehst du wieder fort?«
»Nein, ich bleibe auch da«, erwiderte sie.
Zum erstenmal flog ein Lächeln über sein Gesichtchen. »Mit dir gehe ich überall hin«, flüsterte er. »Du bist so lieb zu mir.«
»Nun mußt du rasch gesund werden, damit wir bald fahren können«, sagte sie.
»Wenn mich nun aber einer holt und von dir wegnimmt?« fragte er kläglich.
Diese Angst hatte Claudia auch noch ein paar Tage, aber dann traf der Bescheid ein, daß Mario mit ihr nach Gut Sophienlust gehen könnte. Die Erkundigungen, die man eingezogen hatte, schienen vorteilhaft ausgefallen zu sein.
Claudia verabschiedete sich von ihren Kolleginnen und Ärzten. Dr. Wolfram nutzte die Gelegenheit, sie noch einmal in ein Gespräch zu ziehen.
»Wissen Sie, wie sehr es mich trifft, daß Sie gehen«, fragte er mit belegter Stimme. »Darf ich Ihnen wenigstens schreiben, Claudia? Besteht nicht die Möglichkeit, daß wir uns manchmal sehen könnten?«
»Wenn es das Schicksal will«, erwiderte sie ausweichend. »Sophienlust ist ziemlich weit entfernt.«
Jetzt war nicht die Zeit, sich über einen Mann den Kopf zu zerbrechen. In Sophienlust wurden sie erwartet. Ein neues Leben begann dort für sie. Ein Leben, das Kindern gewidmet sein sollte, die Liebe brauchten und die das Lachen nicht verlernen oder wieder lernen sollten. Sie war Denise innerlich so verbunden, daß sie genau die gleichen Gedanken hegte wie diese. Und neben ihr saß Mario und fuhr mit ihr dem neuen Leben entgegen, noch scheu und unsicher, weil er sich nicht vorstellen konnte, was ihn erwartete.
*
Auf Sophienlust war die Zeit nicht mit dem Planen vergeudet worden. Die Handwerker waren schon fleißig bei der Arbeit. Anfangs hatte man in den umliegenden Ortschaften diese Neuigkeiten mit Mißtrauen und nicht sehr wohlwollend aufgenommen. Aber als es sich herumsprach, wie das alles gekommen war, machte man sich rasch mit dem Gedanken vertraut, daß Sophienlust nun ein Kinderheim werden sollte. Und da es an Geld nicht mangelte, bekam man auch die nötigen Arbeitskräfte, obgleich Hubert von Wellentin alles unternahm, um die Leute gegen Denise zu beeinflussen.
Sehr beliebt war er noch nie gewesen, und sozial war er auch nicht eingestellt.
Natürlich wurde die heimliche Liebe zwischen Dietmar von Wellentin und der schönen Tänzerin zu einem wahren Roman aufgebauscht, aber irgendwie war sie wohl auch von einem rätselhaften Zauber umgeben.
Dr. Brachmann und sein Sohn Lutz, die großes Ansehen genossen, unterstützten Denise, wo sie nur konnten.
Es war ein beglückendes Gefühl für sie, so rasch Freunde gewonnen zu haben und nicht, wie sie gefürchtet hatte, als Erbschleicherin betrachtet zu werden. Das taten nur Hubert und Irene von Wellentin. Denise ahnte das, deswegen war sie doppelt überrascht, als Hubert von Wellentin eines Tages auf Gut Sophienlust erschien.
Denise empfing ihn in der Bibliothek. Sie begrüßte ihn mit einem kühlen Kopfneigen, er zwang sich zu einer knappen Verbeugung.
»Ich habe Ihnen einige Vorschläge zu unterbreiten, Frau Montand«, begann er.
Sie lächelte ironisch. »Man hat sich daran gewöhnt, mich mit dem Namen meines Mannes anzusprechen«, erwiderte sie gelassen. »Es war der ausdrückliche Wunsch Ihrer Frau Mutter, wie Sie sich erinnern dürften. Aber Sie können die Anrede auch weglassen, Herr von Wellentin. Ich weiß, daß ich von Ihnen kein Verständnis erwarten kann.«
Zum erstenmal begriff er, daß er es mit einer gebildeten Dame zu tun hatte, und außerdem mit einer stolzen Frau. Aber er war nicht bereit, ihr Zugeständnisse zu machen.
»Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, den ich mit meiner Frau genauestens durchgesprochen habe. Ich bin bereit, Ihnen eine beträchtliche Abfindung zu zahlen, sagen wir eine Million, und Ihnen darüber hinaus noch einen monatlichen Unterhalt, wenn Sie Sophienlust verlassen.«
»Sie meinen, ich soll für meinen Sohn auf das Erbe verzichten?« fragte sie nach langem Schweigen.
»Nein, das verlange ich nicht«, erwiderte er überstürzt. »Sie sollen mir das Sorgerecht für Dietmars Sohn übertragen. Wir werden ihn als einen von Wellentin erziehen, dieses Versprechen gebe ich Ihnen. Ich kann mir vorstellen, daß Sie lieber ein anderes Leben führen wollen, als hier ein Kinderheim zu gründen, was ich ohnehin absurd finde. Sicher haben Sie auch den Gedanken, wieder zu heiraten.«
Da erst wurde Denise das Ungeheuerliche seines Vorschlages bewußt.
»Sie wagen es, mir dies zu sagen, ich soll meinen Sohn Menschen überlassen, die ihn als Bastard bezeichnet haben und seine Mutter als ein Flittchen? Verlassen Sie auf der Stelle dieses Haus, Herr von Wellentin. Ich will Sie nie wieder sehen! Nie!«
»Was erlauben Sie sich eigentlich, Sie dahergelaufene Person?« schrie er unbeherrscht. »Meine Mutter muß nicht mehr bei Verstand gewesen sein, als sie diese Verfügung traf. Sie werden es noch bereuen, mich aus diesem Haus gewiesen zu haben!«
»Das werde ich nie bereuen«, entgegnete sie eisig. »Ich bedauere, daß Sie nichts gelernt haben, Herr von Wellentin. Nicht aus dem Tode Ihres Sohnes, und auch nichts aus der Großherzigkeit Ihrer Mutter. Es ist schändlich, daß Sie es wagen, an deren Verstand zu zweifeln, daß Sie eine Tote zu diskriminieren wagen, nur weil nicht alles so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben. Ich will nichts für mich. Aber mein Sohn ist der Erbe Sophie von Wellentins. Er ist ihr Urenkel, und ich, seine Mutter, werde Ihnen beweisen, daß der Wille der Urgroßmutter meines Sohnes bis ins kleinste erfüllt wird. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe.«
Plötzlich stand Urban in der Tür. »Brauchen Sie mich, gnädige Frau?«
»Herr von Wellentin möchte gehen«, erwiderte Denise ruhig und wandte sich um.
Sie wollten ihn mir wegnehmen, dachte Denise aufgebracht. Sie haben nicht das geringste Gefühl dafür, daß man ein Kind über alle Maßen lieben kann. Sie wissen ja auch nicht, was es bedeutet, es entbehren zu müssen, damit es leben kann.
»Wenn du nicht zu müde bist, Nick, könnten wir jetzt Urgroßmama frische Blumen auf das Grab bringen«, sagte sie aus ihren Gedanken heraus zu dem Jungen, der gerade heranstürmte.
*
Als sie vom Friedhof zurückkamen, wurden sie von Alexander von Schoenecker erwartet.
Es war sein erster Besuch seit der Testamentseröffnung, und Denise verspürte eine unbegreifliche Befangenheit, als sie ihn begrüßte. Aber von ihm ging nichts Böses aus, so zurückhaltend er auch war.
»Ich hörte von Justus, daß Herr von Wellentin hier war«, begann er. »Ich hoffe, Sie hatten keinen Ärger, gnädige Frau.«
»Muß man einen solchen bei einem Besuch von ihm voraussetzen?« fragte Denise sarkastisch.
»Ich möchte bei Gott nicht in den Verdacht geraten, daß ich intrigiere«, erwiderte er bedächtig, »aber ich kenne Hubert von Wellentin leider zu genau, um ihm das zuzutrauen. Ich weiß nicht, ob Sie darüber informiert sind, daß Barbara von Borken meine Kusine ist? Sie heißt bereits seit vier Jahren schlicht Baumgarten und ist dabei sehr glücklich. Vielleicht ist Ihnen bekannt, daß sie…«
Denise vollendete mit einem flüchtigen Lächeln: »… daß sie auserwählt war, Dietmar zu heiraten. Ja, er erzählte es mir.«
»Fälschlicherweise beschuldigte mich Herr von Wellentin seinerzeit, diese Verbindung hintertrieben zu haben«, fuhr er fort. »Sie verzeihen mir, wenn ich offen bin, gnädige Frau?«
»Ich bin dankbar für Offenheit. Tatsächlich war dieser Besuch unerfreulich.«
»Ich fürchtete es. Aber eigentlich kam ich, um mit Ihnen über die Ponies zu sprechen, die Dominik sich wünscht.«
Denise sah ihn überrascht an. »Sie haben es nicht vergessen?« fragte sie. »Aber bitte, nehmen Sie doch Platz, Herr von Schoenecker! Ich finde es sehr aufmerksam, daß Sie sich Dominiks Wünsche gemerkt haben.«
»Nun, ich habe eine Ponyzucht«, entgegnete er verlegen. »Dominik könnte sich einige aussuchen.«
Ein eigentümliches Gefühl erfaßte sie. Sein Besuch war der Ausgleich für das bedrückende Erlebnis des Vormittags. Dankbarkeit erfüllte sie.
»Nick wird sich sehr freuen«, sagte sie gedankenverloren.
»Ich kann mir vorstellen, daß es nicht leicht für Sie ist«, wechselte er das Thema, »aber Sie haben sehr viele Sympathien hier, und diese werden Ihnen gewiß helfen. Barbara, Frau Baumgarten, würde Sie gern kennenlernen. Sie bat mich, Ihnen das zu sagen. Es war damals alles ganz anders, als Sie vielleicht annehmen.«
»Wenn ich ganz offen bin, Herr von Schoenecker, so muß ich gestehen, daß ich mir um solche Dinge damals gar keine Gedanken machte. Ich war sehr jung und sehr verliebt. Aber heute ist es für mich sehr interessant, mehr über Dietmar zu erfahren. Ich bin plötzlich in eine Welt gedrängt worden, mit der ich nichts gemein hatte. Ich war Tänzerin. Und ich muß gestehen, daß ich nicht die geringste Ahnung hatte, daß es noch eine Gesellschaftsschicht gab, die so starre Grenzen zieht.«
»Eine solche Gesellschaftsschicht wird es wohl immer geben«, entgegnete er. »Einmal ist es der Adel, dann wieder ist es das Kapital. Man kann nicht viel dagegen tun. Es kommt immer auf die Persönlichkeit des einzelnen an.«
»Dann muß ich es doppelt hoch bewerten, daß Sie so entgegenkommend sind.«
»Bitte nicht! Ich sagte Ihnen schon einmal, daß ich auf gute Nachbarschaft hoffe. Ihr kleiner Sohn hat mich sehr beeindruckt. Er ist ein ungewöhnliches Kind.«
»Herr von Wellentin versuchte heute, mir dieses Kind abzukaufen. Entschuldigen Sie, daß ich Sie mit meinen ganz persönlichen Angelegenheiten belästige. Aber Sie, als ein Fremder, kommen, um Nick etwas zu geben, und sein Großvater kam, um ihn mir abzuhandeln. Es war entsetzlich.«
»Er ist gewohnt zu handeln«, erwiderte Alexander von Schoenecker hart. »Mit Waren und auch mit Menschen. Wir kennen uns noch zu wenig, als daß ich Ihnen meine Freundschaft anbieten könnte, gnädige Frau. Aber wenn Sie einen Freund brauchen, wissen Sie, wo Sie ihn finden können. Jedoch möchte ich meinen, daß es für Sie nicht schwer ist, Freunde zu finden.«
Ein wehmütiges Lächeln legte sich um Denises Mund.
»Es fragt sich nur, ob sie im richtigen Augenblick zur Stelle sind. Und Sie kamen im richtigen Augenblick.«
Mit einem gewinnenden Lächeln streckte sie ihm die Hand entgegen, die er ergriff und an seine Lippen führte.
»Nun erzählen Sie mir bitte ein wenig von Ihren Kindern. Wie heißen Sie? Sie wissen schon so viel von mir, und ich weiß noch gar nichts von Ihnen.«
Seine Augen schweiften in die Ferne. »Ich wünschte, ich hätte einen so innigen Kontakt zu Sascha und Andrea wie Sie zu Ihrem Sohn«, gestand er leise. »Erst jetzt ist mir bewußt geworden, wie
wenig ich mich um sie gekümmert habe.«
»Weil Sie glaubten, die Kinder würden ihre Mutter mehr vermissen als den Vater?« warf Denise ein. »Sie haben Ihre Gattin sicher sehr geliebt, Herr von Schoenecker.«
»Ja, ich habe sie sehr geliebt.«
»Und die Kinder sind ihr ähnlich!«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich denke es mir. Es ist ein eigentümliches Gefühl, wenn Kinder immer an die Verstorbenen erinnern. Nick ist seinem Vater auch sehr ähnlich.«
»Und Sie haben Dietmar auch sehr geliebt!«
Denise sah an ihm vorbei. »Ich kann es heute nicht mehr sagen. Ich war zu jung. Alles war wie ein Traum. Wir hatten gar keine Zeit zusammenzuleben. Nick lernte seinen Vater nie kennen. Er war immer nur mein Kind. Nun ist Dominik ein Erbe zugefallen, das uns dem Namen Wellentin gegenüber verpflichtet. Das Kind begreift es nicht. Es sieht nur das Schöne und für ihn Erfreuliche. Für mich wirft es viele Probleme auf.«
»Sie werden sie bewältigen«, erwiderte er, und zum erstenmal bemerkte sie den Anflug eines Lächelns auf seinen strengen Zügen.
»Der Name Wellentin allein verpflichtet Sie zu nichts«, sagte er ruhig. »Sophie von Wellentins Wille war es, gutzumachen und ihr Gewissen damit zu erleichtern, daß ihr Urenkel sein Recht erhält. Vielleicht auch, daß andere Kinder dadurch glücklich werden. Es war eine Bitte zu erfüllen, und viele andere werden bereit sein, Ihnen dabei zu helfen. Wann darf ich Sie erwarten, damit Dominik sich die Ponies aussucht?«
»Vielleicht am Wochenende?« fragte sie. »Ich erwarte meine Freundin. Sie wird das erste heimatlose Kind nach Sophienlust bringen. Es ist ein kleiner Junge. Er hat vor kurzem seine Eltern verloren.«
»Er wird dennoch ein glückliches Kind werden«, stellte Alexander von Schoenecker fest. »Ich freue mich auf Ihren Besuch. Darf ich jetzt Dominik noch guten Tag sagen?«
*
Dominik hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und betrachtete Alexander von Schoenecker abwartend.
»Guten Tag, Nick«, sagte dieser so herzlich und mit einer Wärme, die Denise aufhorchen ließ.
»Guten Tag«, erwiderte Dominik brav.
»Herr von Schoenecker hat eine Ponyzucht«, erinnerte Denise. »Du darfst dir einige aussuchen.«
Seine Augen leuchteten auf. »Wann?«
»Ich denke, daß wir am Wochenende hinüberfahren können«, sagte Denise.
Dominik blinzelte. »Was möchten Sie dafür? Einen von Sentas Jungen? Eigentlich möchte ich keines hergeben, aber wenn Sie eines wollen?«
»Ich möchte gar nichts dafür«, erwiderte Alexander von Schoenecker, »außer, daß wir gute Freunde werden.«
Dominik sah ihn wachsam an.
»Sie und ich?«
»Wir alle.« Alexander von Schoenecker sah zu Denise hinüber.
»Das können wir schon«, meinte Dominik. »Justus sagt: Mit den Freunden, das ist schon so eine Sache. Man lernt sie erst kennen, wenn man in Not ist.«
»Nun, ich hoffe, daß ich dich nicht enttäuschen werde, Nick«, meinte Herr von Schoenecker.
Dominik lächelte verlegen zu seiner Mutter hinüber. »Habe ich was Falsches gesagt, Mutti? Früher hatten wir nur Claudia. Jetzt haben wir alles und auch noch Freunde. Möchten Sie sich Sentas Junge mal anschauen?« fragte Dominik.
»Gern!«
»Wir haben sie Bim, Bam, Bum, Bella und Blondi getauft, und sie sind alle niedlich«, versicherte Dominik.
Davon konnte sich Alexander von Schoenecker überzeugen. Es waren hübsche Hundchen mit ihrem rotblonden Fell und den feuchten Augen.
»Senta ist sehr stolz auf ihre Kinder. Aber das kann sie auch sein. Sie sind alle wohlgeraten.« Dominik sagte es nicht wenig stolz.
So wohlgeraten wie er, dachte Alexander von Schoenecker. Es war ein eigentümliches Gefühl für ihn, daß ein fremdes Kind den Ring sprengte, der sich um sein Herz gelegt hatte, als Sybille starb.
Es ist bald Pfingsten, überlegte er. Ich werde die Kinder nach Hause holen. Vielleicht komme ich ihnen jetzt näher. Ob Denise, die vielen fremden Kindern Wärme und Geborgenheit geben wollte, ihm dabei helfen konnte?
Er wollte sie fragen, wenn sie mit Dominik zu ihm nach Schoeneich kam. Fremd waren sie sich jetzt ja nicht mehr.
*
Am nächsten Tag wurden Claudia und Mario erwartet. Dominik war schon ganz aufgeregt. Für Mario war das Zimmer neben seinem hergerichtet worden, denn im Seitenflügel waren die Maler und Dekorateure noch am Werk. Für Claudia war ein Wohn- und ein Schlafraum bereitgestellt.
Viel zuviel Räume des Gutshauses waren bisher unbenutzt gewesen, wie Lena meinte. Jetzt rührte sich endlich etwas. An Hilfskräften mangelte es nicht. Aus den umliegenden Dörfern hatten sich rasch ein paar junge Mädchen bereitgefunden, auf Sophienlust zu arbeiten.
Einige von ihnen eigneten sich auch gut zur Beaufsichtigung von Kindern, wie Denise beobachten konnte.
Es gab jetzt so vieles zu bedenken, und Denise war froh, daß nun Claudia bald hiersein würde, die viel vertrauter im Umgang mit Menschen war als sie selbst.
Es lag ihr auch nicht, allein Einkäufe zu machen. Aber solche wurden dringend nötig, wenn sie die Spielräume für die Kinder einrichten wollten. Dafür konnten sie die schönen wertvollen Möbel, die vorhanden waren, nicht verwenden.
Überhaupt sollte in den Räumen, die Sophie von Wellentin bewohnt hatte, nichts verändert werden. Hier wollte sie mit Claudia die seltenen Stunden des Alleinseins verbringen. Denn schon jetzt ahnte Denise, daß diese Stunden selten genug sein würden.
Der einzige, der dem lebhaften Treiben, das nun in absehbarer Zeit auf Sophienlust herrschen würde, mit ziemlicher Zurückhaltung entgegensah, war Urban, der Diener. In Ehren ergraut, die Stille gewohnt und sich auch nicht nach Abwechslung sehnend, verhielt er sich abwartend.
Mit Dominik stand er auf gutem Fuß, aber er konnte sich nicht vorstellen, daß alle Kinder so lieb und vernünftig sein würden wie er.
»Du alter Griesgram!« schalt ihn Magda. »Laß es nur die gnädige Frau nicht merken, was du dir so vorstellst. Es kommen ja keine Wilden!«
Magda fand es jedenfalls erfreulicher, für eine große Runde kochen zu können, als die kleinen Portionen. Der Eßraum für das Personal war als erstes renoviert und neu eingerichtet worden. Recht gemütlich war es jetzt dort, und jeder hielt sich gern darin auf. Daß die richtigen Leute ins Haus kamen, dafür sorgten vor allem Justus und Magda, die aus der Gegend stammten und jeden kannten, der etwas taugte. Mit der Liesel Wallner und der Thea Sperling hatten sie einen besonders guten Griff getan. Das hatte auch Dominik schon festgestellt.
Während er sich das Warten auf Claudia und Mario damit verkürzte, daß er Justus auf seinem Rundgang durch die Ställe begleitete, sah Denise die Post durch. Diesmal war ein Brief von Madame Merlinde dabei. Sie schrieb auf ihre Anfrage wegen Susanne Berkin.
Natürlich hätte sie nicht das Recht, darauf Einfluß zu nehmen, wo Susanne künftig untergebracht werden solle, aber in diesem besonderen Fall müßte sie sich mit dem Vater in Verbindung setzen. Allerdings müsse sie darauf aufmerksam machen, daß Susanne von diesem nichts wüßte. Da er aber mit den monatlichen Zahlungen in Verzug geraten sei, würde sie, Madame Merlinde, es begrüßen, wenn Susanne nach Sophienlust käme.
Im übrigen drückte Madame Merlinde natürlich ihre Verwunderung aus, daß Madame »von Wellentin« sich eine so große Belastung aufladen wolle. Sie könnte ihr dafür nur Erfolg wünschen und sehr gute Nerven.
Über diese Formulierung mußte Denise erst ein wenig lächeln, dann allerdings irrten ihre Gedanken ab. Susanne besaß einen Vater, aber sie wußte nichts von ihm. Er hatte für sie bezahlt, und damit war für ihn der Fall erledigt gewesen.
Nachdenklich betrachtete sie die Adresse, die Madame Merlinde auf einer Karte beigefügt hatte.
»Dr. Günther Berkin.« Akademiker war er also auch. Er lebte in
Innsbruck, auch die Straße war angegeben. Allerdings hatte Madame Merlinde hinzugefügt, daß er wohl verzogen sei, daß ihr letzter Brief zurückgekommen wäre.
Ein seltsamer Vater mußte das sein, der nicht einmal wollte, daß seine Tochter von seiner Existenz erfuhr. Bitterkeit erfüllte Denise. Aber sie durfte sich nicht zum Richter aufwerfen, bevor sie nicht die näheren Umstände erfuhr.
Es hatte wohl wenig Sinn, an die angegebene Adresse zu schreiben. Denise überlegte. Wenn Claudia hier war, konnte sie nach Innsbruck fahren. Dort wollte sie sich den Mann anschauen, der sich so kaltblütig über die Existenz seines Kindes hinwegsetzte. Vorausgesetzt natürlich, daß sie ihn finden würde.
*
Claudia wäre schon längst an Ort und Stelle gewesen, wenn nicht ausgerechnet auf den letzten zwanzig Kilometern ihr Schnauferl lebensüberdrüssig geworden wäre und sich nicht mehr von der Stelle bringen ließ.
Da standen sie nun auf der einsamen Landstraße, kein Haus weit und breit, und warteten auf eine hilfreiche Seele. Aber sie mußten sehr lange vergeblich warten.
Mario schaute ein bißchen ängstlich drein, denn so ganz geheuer war es ihm noch immer nicht. Die Fahrt hatte quälende Erinnerungen in ihm geweckt.
»Fahr nur schön langsam, Claudia. Paß auf, daß nicht wieder ein Reh kommt«, hatte er sie mit banger Stimme immer wieder ermahnt.
Fürsorglich, wie sie war, hatte sie glücklicherweise genügend Reiseproviant eingepackt. Und gerade als sie mit Heißhunger ein Brötchen verzehrten, näherte sich Motorengeräusch.
Der graue Sportwagen stoppte sofort. Ein sympathischer junger Mann beugte sich aus dem offenen Fenster und fragte freundlich: »Brauchen Sie Hilfe?«
»Der liebe Gott schickt Sie«, seufzte Claudia erleichtert.
»Nein, mein Vater«, erwiderte der Fremde lachend und stieg aus. »Von seiner unbestreitbaren Güte abgesehen, ist er mit dem lieben Gott kaum zu vergleichen. Brachmann ist mein Name. Lutz Brachmann.«
»Claudia Rogers«, erwiderte sie.
»Oh, Frau von Wellentins Freundin! Die Heißersehnte!« gab er fröhlich zurück.
»Sie wissen Bescheid?« fragte Claudia staunend. Denise schloß doch gar nicht so rasch Bekanntschaften.
»Wir sind Frau von Wellentins Anwälte«, erklärte er. »Ich bin auf dem Weg zu ihr.« Er warf einen mitleidigen Blick auf das alte Schnauferl. »Es wollte wohl nicht mehr! Ich hatte auch mal so eins. Es fällt einem verflixt schwer, sich von einem so liebgewordenen Gefährt zu trennen. Nanu, da haben wir ja noch jemanden«, sagte er erstaunt, als Mario sich schüchtern bemerkbar machte.
»Das ist Mario«, stellte Claudia vor.
Lutz Brachmann blinzelte. »Ihr Sohn?«
»So etwas Ähnliches.«
»Du wirst dich noch wundern, junger Mann«, lächelte Lutz Brachmann. »Na, dann wollen wir mal das Gepäck umladen.«
Es war ziemlich viel, was ihn zu der Bemerkung veranlaßte, daß es dem Schnauferl wohl deshalb nicht mehr behagt hätte.
»Aber verkommen lassen werden wir es hier nicht. Das Schnauferl wäre doch für die zu erwartenden Kinder noch ganz hübsch zum Spielen. Meinen Sie nicht?«
Sie fand es nett, wie unbefangen er plauderte und daß er auch gleich an die Kinder dachte. Es war beruhigend für sie zu wissen, daß Denise hier hilfreiche Menschen gefunden hatte.
»Sophienlust ist gar nicht weit«, fuhr er fort. »In ein paar Minuten sind wir da. Dumm ist nur, daß ich jetzt mit geschäftlichen Dingen hineinplatze, die keinen Aufschub dulden.«
»Ich bin froh darüber«, seufzte Claudia, »sonst säßen wir womöglich noch heute abend hier.«
»Nachmittags ist die Straße schon belebter«, versicherte er. »Was aber nicht besagen soll, daß ich es lieber jemand anderem überlassen hätte, Sie nach Sophienlust zu bringen. So, meine Herrschaften, bitte einsteigen!«
Da Mario nicht in die Mitte wollte, nahm ihn Claudia auf den Schoß.
Schon nach kurzer Zeit breitete sich Gut Sophienlust vor ihren Augen aus.
»Da ist nun Ihr künftiges Heim«, meinte Lutz Brachmann.
»Bitte, könnten Sie einen Augenblick anhalten?« bat Claudia.
»Aber gern! Schön ist es hier, nicht wahr?«
»Wunderschön!« flüsterte sie. »So hätte ich es mir nicht vorgestellt. Das muß ja ein Vermögen wert sein.«
Er warf ihr einen raschen Seitenblick zu. »Wissen Sie nicht, wie groß das Erbe ist, das Dominik zugefallen ist?«
Sie schüttelte den Kopf. »Isi hat mir nur Andeutungen gemacht. Ich habe mich gewundert, daß sie es annahm«, fügte sie hinzu.
»Es blieb ihr wohl nichts anderes übrig«, erwiderte er. »Sie wäre allerdings auch sehr töricht gewesen, wenn sie Einwände erhoben hätte. Die alte Frau von Wellentin hat schon gewußt, was sie tat. Werden Sie ständig hierbleiben?« fragte er nach einer Pause.
»Solange Isi mich braucht.«
»Oder bis ein Mann kommt und Sie entführt«, lächelte er.
»Das kann mir nicht passieren«, widersprach sie.
»Na, na, nicht gleich so widerspenstig! Es gibt eine Menge netter junger Männer hier in der Gegend. Sie werden staunen.«
»Ich staune jetzt schon«, gab sie belustigt zu.
»Wenn ich das als eine Art Kompliment bewerten darf, dann vielen Dank!« erwiderte er, worauf sie nun doch errötete.
Ist das ein bezauberndes Wesen, dachte er. Er hatte sich Denises Freundin ganz anders vorgestellt, als sie davon sprach, daß sie Krankenschwester sei. Bei weitem nicht so jung, und vor allem nicht so
hübsch. Hoffentlich bot sich ihm recht oft Gelegenheit, nach Sophienlust zu fahren!
*
»Sie kommen, sie kommen!« schrie Dominik, aber dann wurde sein Gesicht betrübt, als das rassige Auto in den Gutshof einfuhr. »Das ist nicht Claudias Schnauferl«, meinte er enttäuscht. »Das ist der Sportwagen von Doktor Brachmann.«
Aber dann stieg Claudia aus, und er rannte ihr mit einem Jubelschrei entgegen.
»Claudi, Claudi! Wie schön, daß du endlich da bist. Mutti, so komm doch, Claudi ist da!«
»Ich auch«, rief Denise und schloß ihre Freundin in die Arme.
Blaß und verängstigt saß Mario noch immer im Wagen. Dieser stürmische Junge verriet ihm, wie beliebt Claudia hier war, und er kam sich plötzlich ganz einsam und verlassen vor. Instinktiv fühlte Lutz Brachmann, was der Junge empfand.
»Hier ist noch jemand, der begrüßt werden möchte«, mischte er sich ein, dann hob er den leicht widerstrebenden Jungen aus dem Wagen.
»Mario«, sagte Dominik, »oh, sei nicht böse!«
»Herzlich willkommen, Mario!« sagte nun auch Denise und streckte ihm die Hände entgegen. »Wir freuen uns sehr, daß du bei uns bist.«
Marios Augen waren feucht. »Komm schon, Mario«, sagte Claudia behutsam, »alle werden dich liebhaben.«
»Dich haben sie aber lieber«, flüsterte er.
»Mich kennen sie nur schon länger.«
Dominik griff nach Marios Hand. »Ich mache dich mit allen bekannt«, sagte er mit kindlicher Unbefangenheit. »Willst du zuerst die Tiere sehen oder die Menschen?«
»Lieber erst die Tiere«, meinte Mario nach kurzem Zögern.
»Paß aber schön auf ihn auf, Nick«, rief Denise den Kindern nach.
»Da kannst du ganz beruhigt sein, Mutti. Mario ist ja auch schon ein großer Junge.«
Das erfreute seinen kleinen Gefährten sichtlich! Wenn er auch noch schüchtern war, aber Sentas Junge entlockten ihm doch begeisterte Ausrufe.
»Welchen willst du haben?« fragte Dominik. »Du kannst dir einen aussuchen. Weil du ein Junge bist, darfst du dir einen Jungen nehmen.«
»Du schenkst mir wirklich einen?« staunte Mario.
»Freilich! Sie bleiben ja doch alle zusammen wie wir auch. Ich meine nur, Senta wird noch viele Jungs bekommen müssen, wenn alle Kinder einen haben sollen«, fügte er nachdenklich hinzu. »Aber weil das wahrscheinlich nicht geht, wirst du der einzige Junge sein, der einen für sich allein bekommt. Höchstens Susi kriegt noch einen.«
»Aber mir gibst du einen ganz allein?« vergewisserte sich Mario.
»Dir schon! Du bist jetzt so was wie mein Bruder. Dich hat Claudia mitgebracht, und du bist der erste, der nach Sophienlust kommt.«
»Bim, Bam, Bum, das sind hübsche Namen. Hören sie auch schon drauf?« fragte Mario.
»Probier’s doch mal!« riet Dominik.
»Bim«, rief Mario, aber nichts rührte sich. »Bam«, rief er dann, aber wieder reagierte keiner. »Bum«, sagte er dann leise, und plötzlich kroch das kleine Hündchen auf ihn zu.
»Der hat mich verstanden«, freute sich Mario. »Gibst du mir den?«
»Na klar«, erwiderte Dominik, »wenn ich was verspreche, halte ich es auch.«
*
»Und was führt Sie nach Sophienlust, Herr Doktor Brachmann?« fragte Denise freundlich, nach dem Begrüßungstrunk.
»Leider keine erfreuliche Angelegenheit«, bekannte er zögernd. Er warf einen fragenden Blick auf Claudia.
»Sie kann alles hören. Wir haben keine Geheimnisse voreinander«, sagte Denise.
»Herr von Wellentin…«
»Was will er denn nun noch?« unterbrach Denise den Anwalt unwillig.
»Es handelt sich um den Aktienanteil an den Fabriken. Er ist zu einem Kompromiß bereit. Wenn Sie ihm die Aktien überlassen, wird er Ihnen keine Schwierigkeiten mehr bereiten.«
Denise lachte amüsiert. »Das kann er ohnehin nicht. Die Aktien gehören wie alles andere meinem Sohn. Dominik aber kann erst entscheiden, wenn er mündig ist. Solange bleibt alles, wie Sophie von Wellentin es bestimmt hat.«
Sie wandte sich Claudia zu. »Du mußt wissen, daß ich ihm neulich die Tür gewiesen habe, Claudi.«
»Das haben Sie fertiggebracht?« fragte Lutz Brachmann mit ehrlicher Bewunderung.
»Und was möchte er noch tun, um mich zu ärgern?«
»Frau von Wellentins Schmuck, den sie Ihnen hinterlassen hat, befindet sich in seinem Safe. Er ist nicht bereit, ihn herauszugeben, wenn keine Regelung wegen der Aktien getroffen wird. Natürlich verläßt er sich darauf, daß Sie keinen Skandal wünschen.«
Denises Augenbrauen hoben sich leicht. »An einem Skandal ist mir durchaus nichts gelegen, aber daran, daß der letzte Wille Frau von Wellentins in vollem Umfang erfüllt wird. Ich bin nicht auf den Schmuck erpicht, aber ich denke doch, daß es an der Zeit ist, Herrn von Wellentin begreiflich zu machen, daß er sich über rechtmäßige Verfügungen nicht hinwegsetzen darf.«
»Das ist auch unsere Ansicht«, erklärte Lutz Brachmann. »Ich sollte mich nur über Ihre Einstellung vergewissern. Wir werden in diesem Fall allerdings das Gericht bemühen müssen.«
»Nun, dann bemühen Sie es bitte!«
»Ich kenne dich nicht wieder, Isi«, sagte Claudia.
»Ich mich selbst nicht. Aber wenn du einmal mit ihm zu tun hättest, würdest du es schnell begreifen. Dieser Mann hat kein Herz, keine Seele, kein Gefühl. Herr Doktor Brachmann, ich sage hiermit Herrn von Wellentin den Kampf an.«
»Allen Respekt, gnädige Frau!«
»Wollen Sie weiterhin meine Interessen wahrnehmen? Soviel ich weiß, vertritt Ihr Vater auch Herrn von Wellentin und würde durch eine solche Entscheidung einen beträchtlichen finanziellen Verlust erleiden.«
»Ich glaube, den können wir verkraften.«
»Er ist ein feiner Kerl, findest du nicht?« meinte Claudia, nachdem er sich verabschiedet hat.
»Ich weiß nicht, Claudi, womit ich es verdient habe, aber ich habe in kurzer Zeit so viel Gutes erfahren, daß mir angst werden müßte.«
»Dafür hast du fünf Jahre leiden müssen. Du hast sie ganz allein durchgestanden.«
»Nein«, erwiderte Denise, »ich hatte dich, und das werde ich dir nie vergessen.«
*
»Ich verstehe ja nichts von geschäftlichen Dingen, Hubert«, sagte Irene von Wellentin zu ihrem Mann, »aber meinst du nicht, daß du besser gefahren wärest, wenn du dich diplomatischer verhalten hättest? Es ist doch sehr peinlich, daß Doktor Brachmann dir sozusagen den Stuhl vor die Tür gesetzt hat.«
»Sie hat ihn eingewickelt. Dieser alte Narr kapituliert vor ihrem Getue. Ihr werdet schon noch sehen, was dabei herauskommt. In kurzer Zeit verjubelt sie Mutters Vermögen mit ihren Verehrern in Nachtlokalen und Spielhöllen.«
Entsetzt sah sie ihn an. »Gehst du nicht etwas zu weit, Hubert? Du kannst doch Doktor Brachmann nicht unterstellen, daß er seine Verantwortung als Vermögensverwalter des Kindes mißachtet. Es ist doch eine unumstößliche Tatsache, daß du den Schmuck nicht zurückhalten kannst. Muß wirklich erst das Gericht eingeschaltet werden?«
»Es geht um Schmuck für mehrere hunderttausend Euro«, antwortete er wütend. »Ich kann mich nicht damit abfinden, daß sie uns völlig übergangen hat.«
»Aber wir besitzen doch genug«, lenkte sie ein. »Sie hat nur über das Vermögen bestimmt, was sie selbst mit in die Ehe gebracht hat.«
Er kniff die Augen zusammen. »Haben sie dich schon weichgemacht, unsere lieben Freunde, die nichts Besseres zu tun haben, als unsere Familienverhältnisse breitzutreten. Schoenecker stachelt sie auf. Für ihn ist es ein gefundenes Fressen, sich jetzt zu revanchieren.«
»Mein Gott, Hubert, denk doch bitte nüchtern! Wofür sollte er sich revanchieren? Er hat Barbara bestimmt nicht beeinflußt.«
»Nun bist du auch schon gegen mich. Du warst genauso gegen Dietmars Wahnsinnsidee, diese Tänzerin zu heiraten. Was willst du jetzt eigentlich?«
»Wir werden alle unsere Freunde verlieren. Schon jetzt besucht uns keiner mehr.«
»Hatten wir denn jemals wahre Freunde? Es war ihnen doch eine Ehre, mit den Wellentins zu verkehren. Ach, laß mich mit deinem Geschwätz in Ruhe!«
»Der Junge ist Dietmar so ähnlich!« flüsterte sie. »Ich habe nie glauben wollen, daß er wirklich ein Sohn ist. Du hast es mir ja lange genug eingeredet. Aber wenn sie so schlecht wäre, wie du es immer hinstellst, hätte sie ihn nicht unter Entbehrungen aufgezogen.«
»Ach, wer weiß, ob das wirklich stimmt? Vielleicht hat Mutter schon lange für ihn gesorgt. Solange sie lebte, wollte sie sich nicht mit uns überwerfen, aber nach ihrem Tode war ihr alles gleich.«
Irene von Wellentin glaubte jetzt wirklich, daß ihr Mann seinen Verstand nicht mehr beisammen hatte. Im ersten Zorn war sie auch bereit gewesen, Denise zu verdammen. Aber je länger sie nachdachte, desto mehr wurde ihr bewußt, daß manches ganz anders war, als ihr Mann ihr einzureden versucht hatte. Seine neuesten Versuche, Denise zu schaden, hatten sie noch hellhöriger werden lassen.
Natürlich spielte die unbestreitbare Tatsache, daß man sich mehr und mehr von ihnen zurückzog, eine bedeutende Rolle dabei.
Viele Jahre hatte sie eine tonangebende Rolle in der Gesellschaft gespielt.
Niemand hatte versäumt, sie einzuladen. Jetzt waren schon zwei große Feste gefeiert worden, ohne daß sie eine Einladung erhalten hätten. Neulich hatte sie auf der Straße erleben müssen, daß die Frau Amtsgerichtsrat schnell in einem Geschäft verschwunden war, als sie aus dem Auto stieg. Ausgerechnet sie, die sonst keine Gelegenheit zu einem kleinen Schwatz ungenutzt ließ.
Bei ihrem wöchentlichen Bridgeabend hatten sich gestern abend alle Damen entschuldigen lassen. Zwei waren verreist, eine litt an Migräne. Gewiß war das früher auch manchmal passiert, aber im Winter, nicht im Mai.
»Ich möchte verreisen«, sagte sie.
»Ja, verreise, meine Liebe«, nickte er. »Es wird dich auf andere Gedanken bringen.«
»Aber ich mag nicht allein fahren.«
»Such dir eine Reisebegleiterin! Eine junge, die dich auf fröhlichere Gedanken bringt!«
Ja, es war vielleicht gut, einen jungen lebensfrohen Menschen um sich zu haben. Daß sie nicht schon früher darauf gekommen war. Aus dem Ort wollte sie allerdings niemanden bitten. Aber sie konnte ja eine Annonce aufgeben. Dann mußte sie auch noch überlegen, wohin sie reisen wollte.
*
»Wir wollen zu Herrn von Schoenecker fahren und die Ponies anschauen«, erinnerte Dominik seine Mutter. »Du hast gesagt am Wochenende, Mutti!«
Über den Ärger mit Hubert von Wellentin hatte sie es fast vergessen. Sie hatte sich schon so in diese neue Rolle, die ihr das Schicksal zugedacht hatte, hineingelebt, daß sie sich fragte, was dieser Mann sich eigentlich anmaßte.
So ganz sicher war sie sich nicht gewesen, daß der alte Dr. Brachmann sich auf ihre Seite schlagen würde, aber nun hatte er es ihr bewiesen und sie damit einigermaßen aus der Fassung gebracht, denn er zeigte ihr damit, daß er sie als eine von Wellentin anerkannte…
»Ja, wir fahren nach Schoeneich, Nick«, versprach sie. »Urban soll anspannen.«
»Mario kommt doch mit?« fragte Dominik. Denn er wollte nicht begreifen, daß sein kleiner Freund noch zögerte.
»Du mußt dir die Ponies doch auch anschauen«, drängte ihn Dominik.
»Kommt Claudi auch mit?« erkundigte sich Mario.
»Nein, ich habe zu tun«, erwiderte diese rasch. »Wir müssen das schöne Wetter ausnutzen, um den Pavillon herzurichten, und wenn niemand da ist, der den Handwerkern auf die Finger schaut, brauchen wir noch mal solange.«
Die resolute Claudia hatte das schnell erfaßt. Sie war überall, und meistens da, wo man sie gar nicht vermutete. Magda schmunzelte, wenn sie das junge Mädchen umherflitzen sah. Ja, so was brauchte man hier. Ihr war jetzt überhaupt nicht mehr bange, daß etwas schiefgehen könnte. Die gnädige Frau war zu nachgiebig, aber Claudia ließ sich nichts vormachen.
»Vielleicht möchtest du lieber allein mit deiner Mutti sein«, meinte Mario.
Dominik sah ihn ganz verblüfft an. »Hast du’s noch immer nicht begriffen, daß wir alle zusammengehören?« fragte er. »Los, komm schon! Es ist ganz toll, mit dem Zweispänner zu fahren. Ich bin gespannt, ob Schoeneich auch so schön ist wie Sophienlust.«
Nun, ganz so schön fand er es nicht, wie es da auf einer kleinen Anhöhe lag. Und so groß war es auch nicht. Aber die Ponies, die sich auf der Wiese tummelten, glichen das aus.
»Das sind ja ganz viele«, staunte er, als er sie schon von weitem sah.
»Herr von Schoenecker hat ja auch eine Zucht«, belehrte ihn Denise nochmals.
»Und wenn wir ihm nun alle abkaufen, dann haben wir eine Zucht«, lachte Dominik.
»Die macht aber sehr viel Arbeit, mein Sohn. Und gar zu unverschämt wollen wir doch wohl nicht sein.«
Dominik sah sie verlegen an.
»Es war doch nur ein Scherz, Mutti!«
Alexander von Schoenecker erwartete sie bereits. Denise hatte nicht versäumt, telefonisch anzufragen, ob ihr Besuch heute auch angenehm sei. Nur sich selbst gestand er ein, daß er den Tag kaum hatte erwarten können.
Er kam ihnen entgegen. In Reithosen und einem hellen Hemd sah er lange nicht so streng aus wie im Anzug. Dominik wurde gleich noch viel zutraulicher, während Mario sich bescheiden im Hintergrund hielt.
»Ich habe die Ponies schon gesehen. Es sind ja ganz viele«, sagte Nick begeistert.
»So eine Zucht macht viel Arbeit, sagt Mutti.«
»Bevor wir sie uns näher anschauen, darf ich wohl noch eine Erfrischung bringen lassen? Herzlich willkommen auf Schoeneich, gnädige Frau! Ihr beiden seid natürlich auch willkommen. Das ist also der Mario!«
Denise hatte wieder einmal Grund, sich zu wundern. Hier machte anscheinend alles schnell die Runde. Aber als sie dann erfuhr, daß Marie, das Faktotum Herrn von Schoeneckers, Magdas Schwester war, wunderte sie das nicht mehr.
»Heilige Mutter Gottes«, murmelte Marie, als sie Denise gewahrte.
»Nein, das ist meine Mutti«, erklärte Dominik aggressiv.
»Ich will ja nichts gesagt haben«, murmelte Marie und verschwand rasch.
»Ich werde es Ihnen später erklären«, sagte Alexander von Schoenecker leise.
»Wollt ihr schon hinausgehen?« wandte er sich an die beiden Jungen. »Oder wollt ihr euch ein bißchen mit Lora unterhalten?«
»Wer ist Lora? Dein Kind?« fragte Dominik. »Oh, pardon! Ihr Kind, meine ich.«
»Nein, es ist ein Papagei, er kann sogar sprechen«, erklärte Alexander von Schoenecker. Er führte die Kinder in den Wintergarten, dessen exotische Pflanzenpracht das Hobby des Hausherrn deutlich verriet.
»Wundervoll«, sagte Denise.
»Wunderrrrvollll«, kam das Echo aus einem großen Käfig. Die Kinder staunten und lachten und schwatzten dann auf Lora ein, dem aber so viel Gerede scheinbar zuviel wurde.
»Rrruhe«, kreischte sie.
»Toll«, amüsierte Dominik sich, während Mario erschrocken zusammengezuckt war.
»Tolle Lore, schöne Lore«, kam die Antwort.
»Sie haben vorerst ihre Unterhaltung«, sagte Alexander leise zu Denise, »darf ich Sie bitten, einen Augenblick hier hereinzukommen?«
Er öffnete die Tür zu einem bezaubernd eingerichteten Raum. Helle Seidentapeten zierten die Wände, zierliche Polstermöbel mit altrosa Samtbezügen gruppierten sich um einen wunderschönen runden Tisch, dessen Platte mit kostbaren Intarsien ausgelegt war. Nur ein einziges Bild hing an der breiten Wand, die durch keine Tür unterbrochen war, und dieses Bild raubte Denise fast den Atem. Mit einer anderen Frisur, etwas anderen Haaren und anderer Kleidung hätte es beinahe ein Bild von ihr selbst sein können. Wenigstens auf den ersten Blick.
»Sybille, meine Frau«, sagte Alexander von Schoenecker. »Es erklärt wohl Maries Erstaunen. Irgendwie sind Sie ihr tatsächlich ähnlich, gnädige Frau.«
»Eine seltsame Laune der Natur«, meinte Denise.
»Wenn Sie sprechen, verwischt sich die Ähnlichkeit. Sybille hatte eine hellere Stimme. Sie lachte gern. Es war sehr lebendig in diesem Haus, solange sie hier war.«
Nun drang das Lachen der Kinder zu ihnen herüber. »Jetzt ist es auch lebendig«, fügte er nachdenklich hinzu.
Sie betrachtete ihn mit tiefem Mitgefühl. »Holen Sie Ihre Kinder heim, Herr von Schoenecker! Dann wird es hier auch wieder lebendig sein.«
Seine Augen schweiften in die Ferne. »Ich hole sie in den Ferien heim, aber entscheiden sollen sie selbst, ob sie bleiben wollen.«
»Wollten sie das denn nicht?« fragte sie bestürzt.
»Nein«, erwiderte er rauh. »Sie werden es kaum verstehen können, aber die Mutter meiner Frau lebt noch«, abrupt unterbrach er sich. »Was soll ich Sie mit meinen Angelegenheiten belästigen? Verzeihen Sie!«
»Wenn Ihnen einmal danach zumute ist, höre ich Ihnen gern zu«, erwiderte Denise verhalten.
Als sie den Raum verließen, bemerkte sie, daß er sich noch einmal zu dem Bild umwandte, dann streifte sie unabsichtlich seine Hand, und ein undefinierbares Gefühl ließ sie den Atem anhalten.
Die Kinder belustigten sich immer noch mit Lora, die kreischte und mit den Flügeln schlug.
»So was fehlt uns auch noch, Mutti«, meinte Dominik.
»Wenn es nach dir ginge, hätten wir bald einen ganzen Zoo«, lächelte sie.
»Das wäre natürlich toll, Mutti.«
Mario schüttelte den Kopf. »Ich mag keine Rehe, die sind auch im Zoo.«
Dominik sah ihn verdutzt an, aber schnell legte Denise den Finger auf ihren Mund, damit er keine Fragen stellte.
»Marios Eltern verunglückten tödlich, als ihnen ein Reh in den Wagen sprang«, erklärte Denise ihrem Begleiter. »Er sah es mit an.«
Alexander von Schoeneckers Gesicht wurde fahl. »Meine Frau wurde von einem tollwütigen Hund gebissen«, sagte er heiser. »Ich war zu dieser Zeit nicht hier, und sie nahm nichts tragisch. Sie war nicht mehr zu retten. Aber lassen wir das! Gehen wir jetzt zu den Ponys.«
Zwei etwas größere standen abseits.
»Das sind Binni und Ben. Sie
sind unzertrennlich«, erklärte Alexander von Schoenecker. »Sie gehören Sascha und Andrea, meinen Kindern. Aber von den anderen darfst du dir welche aussuchen, Nick.«
»Wieviel?« erkundigte er sich, ohne den mahnenden Blick seiner Mutter zu beachten.
Alexander von Schoenecker lächelte.
»Sagen wir, vorerst einmal vier? Später könnt ihr ja noch mehr haben.«
»Für jedes Kind eins?«
»Du lieber Himmel, da müssen wir ja erst einmal Ställe bauen«, sagte Denise entsetzt. »Was du dir so denkst, Nick!«
»Ich denke nur, daß alle Kinder gleichzeitig reiten wollen, sonst streiten sie sich«, meinte er.
»Nun, wie wäre es, wenn wir das Reiten hierher verlegen würden«, schlug Alexander von Schoenecker vor.
»Wir haben die Bahn, und lernen müßt ihr es ja doch. Und Ställe haben wir hier genug.«
»Sie erlauben, daß alle Kinder auf einmal herkommen?« staunte Dominik.
»Es wäre immerhin mal eine Abwechslung.«
»Und Ihre Kinder hätten nichs dagegen?«
»Das wird sich finden«, bemerkte er zögernd.
»Man muß sie fragen«, nickte Dominik. »Ich hätte gern das schwarze Pony. Und du, Mario?«
»Darf ich es sagen?« fragte der Kleine schüchtern.
»Natürlich darfst du«, meinte Alexander von Schoenecker.
»Das kleine graue Pony. Es hat so traurige Augen«, flüsterte Mario.
»Und die beiden genügen vorerst«, bestimmte Denise energisch.
Dominik wagte keinen Widerspruch. »Ich nenne meins Nicki.«
»Meins nenne ich Bambino«, flüsterte Mario. »So hat meine Mutti mich immer genannt.«
Liebevoll zog ihn Denise an sich. »Nicht traurig sein, mein Kleiner«, tröstete sie.
»Wenn er weinen will, soll er ruhig weinen«, meinte Dominik.
»Ich habe auch oft geweint, wenn ich dich nicht hatte.« Brüderlich legte er seinen Arm um Mario. »Ich verstehe dich schon, aber nun hast du uns ja. Können wir die Ponies gleich mitnehmen, Herr von Schoenecker?«
»Im Zweispänner?« fragte Denise belustigt.
»Ich bringe sie euch morgen rüber«, versprach der Gutsbesitzer.
»Und wie kann ich mich erkenntlich zeigen?« fragte Denise.
»Indem Sie mir gestatten, Ihr Freund zu sein, gnädige Frau.«
Sie hob ihr Gesicht und sah ihm in die Augen, in denen eine ferne Sehnsucht zu glimmen schien. Ein weiches Lächeln legte sich um ihren Mund. »Dann aber bitte nicht mehr gnädige Frau!« Er ergriff ihre Hand, die sich ihm entgegenstreckte, und beugte sich tief darüber.
»Danke, Denise!«
Zarte Röte stieg in ihre Wangen. »Ich danke auch, Alexander!«
*
»Er ist ein netter Mann«, lobte Dominik auf der Heimfahrt. »Aber wir hätten ruhig gleich vier Ponies nehmen sollen.«
»Zwei genügen für den Anfang. Man soll Freundschaft nicht ausnutzen, Nick!«
»Er hat’s doch gesagt. Ob seine Kinder auch nett sind?«
»Wir werden sie nächste Woche kennenlernen.«
»Warum sind sie nicht zu Hause?«
Wenn ich nur selbst den wahren Grund wüßte, überlegte Denise. Etwas quält ihn.
»Wahrscheinlich, weil sie schon zur Schule gehen müssen«, erwiderte sie ausweichend.
Seine Augen weiteten sich schreckensvoll. »Nächstes Jahr muß ich auch zur Schule. Ich gehe aber nicht weg von Sophienlust, Mutti.«
»Natürlich bleibst du auf Sophienlust«, beschwichtigte sie ihn.
»Im Dorf gibt es eine Schule. Ich brauche gar nicht so viel zu lernen, Mutti. Wie man Pferde und Kühe aufzieht, bringt mir Justus bei.«
»Das reicht aber nicht, um ein gescheiter Mann zu werden. Nun, wir haben ja noch Zeit, das alles zu überlegen.«
»Ich will auch nicht mehr weg«, sagte Mario.
»Schauen wir uns die Dorfschule erst mal an«, schlug Denise vor. Es war das erste Mal, daß sie durch das Dorf fuhren. Die Leute blieben stehen und blickten ihnen nach. Wie ein Lauffeuer ging es durch den kleinen Ort, daß die junge Herrin von Sophienlust im Dorf war.
Die Schule war schlecht zu finden und sah erbärmlich aus. »Da bringt mich keiner rein«, erklärte Dominik spontan. »Das ist ja eine Bruchbude!«
»Das kann man wohl sagen, mein Junge«, bestätigte eine Männerstimme.
»Frau von Wellentin? Ich bin der Leiter dieser Schule. Brodmann ist mein Name.«
Er war mittleren Alters und machte einen recht sympathischen und aufgeschlossenen Eindruck.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen«, erwiderte Denise. »Wir zerbrechen uns eben den Kopf, wie das Schulproblem für unsere Kinder zu lösen wäre.«
»Für einen Neubau hat man kein Geld«, seufzte er. »Wir sind schon verschiedentlich an Herrn von Wellentin herangetreten, aber…«
»Wir werden gemeinsam einen Weg finden«, erwiderte Denise.
»Dann bauen wir eben eine Schule, Mutti«, meinte Dominik.
»Ja, Nick. Wir werden mit Dr. Brachmann darüber sprechen.«
Der Lehrer sah sie erstaunt an. »Wir werden uns demnächst mit Ihnen und dem Bürgermeister darüber unterhalten, Herr Brodmann.«
*
»Jetzt will sie sogar eine neue Schule bauen lassen, die Herrin von Sophienlust. Sie weiß genau, wie sie es anfangen muß, das Dorf auf ihre Seite zu bringen«, berichtete Hubert von Wellentin wütend seiner Frau.
»Der Schulbau war schon lange nötig. Du hättest dir damit viel Verdienste schaffen können«, war ihre gelassene Antwort.
»Na, was ist mit deiner Reise?« lenkte er ab. »Hast du schon eine Begleiterin?«
»Ich habe annonciert. Morgen wird sich eine junge Dame vorstellen. Mehr haben sich nicht gemeldet.«
»Die modernen jungen Mädchen lassen sich eben lieber von Männern aushalten«, schimpfte er. »Es gibt ja immer wieder Dumme, die sich ausnehmen lassen.«
Sie war des leidigen Streites müde und schwieg, denn Hubert wurde immer schwieriger und unzufriedener. Daheim und in der Fabrik. Längst hatte sie erfahren, daß sich bereits Unruhe unter den Arbeitern ausbreitete.
Sie wohnten nahe der Stadt auf ihrem herrlichen Besitz. Das Dorf lag weiter entfernt. Früher war es so gewesen, daß die Wellentins ihren Einfluß überall geltend machten. Ihr Mann ließ sich jedoch stets sehr lange bitten. Jetzt aber gab es eine andere Wellentin, die sehr rasch eigene Initiative entwickelte. Es gab viele, die sich darüber die Hände vor Vergnügen rieben. Sie spürte es schon in ihrem eigenen Haus, denn auch ihr hatte eine Angestellte gekündigt, mit der Begründung, daß sie nach Gut Sophienlust gehen wolle, weil man dort ein Herz für die Angestellten hätte.
Nur erst einmal weg von hier, dachte Irene von Wellentin. Wenn diese junge Dame mir nur einigermaßen zusagt, werden die Koffer ganz schnell gepackt.
*
Edith Gerlach blickte mit tränenfeuchten Augen auf das kleine Wesen, das in einem bescheidenen Wäschekorb lag. Nun hatte sie eine Stellung, in der man nicht viel nach ihren Kenntnissen fragte. Sie hatte sich heute bei Frau von Wellentin als Reisebegleiterin beworben und war sofort angenommen worden.
Aber wo sollte sie jetzt das Kind unterbringen? Ihre Freundin Gerda, die ihr fest zugesagt hatte, es zu sich zu nehmen, hatte mit ihrem Mann deswegen Streit bekommen und ihr Angebot zurückgenommen.
Blitzartig kam ihr ein Gedanke. In dem Geschäft, in dem sie heute Babynahrung für ihre kleinem Petra einkaufte, hatten zwei Frauen erzählt, daß auf Gut Sophienlust ein Heim für verlassene Kinder eingerichtet wurde.
Ob sie dort wohl auch Platz für ein Baby hätten, das eben erst drei Monate alt war?
»Ich muß versuchen, dich dorthin zu bringen, mein armes, kleines Schätzchen«, flüsterte sie. »Du hast dir eine abscheuliche Mutter ausgesucht.«
Aber was nutzten jetzt alle Selbstvorwürfe. Allen Vorhaltungen ihrer Eltern zum Trotz hatte sie einem Mann vertraut, der sie schamlos ausgenutzt und um all ihre Ersparnisse gebracht hatte.
»Ich will dich ja nicht für immer hergeben, mein Kleines«, flüsterte sie. »Du kannst nichts dafür, daß deine Mutter so dumm und gutgläubig war und deine Großeltern so böse auf sie sind. Aber ich muß endlich wieder Geld verdienen.«
Edith Gerlach nahm ihr Kind hoch und drückte es fest an sich. Dann schrieb sie auf ein weißes Blatt Papier mit zittriger Hand ein paar Zeilen, wickelte das Baby in eine warme Decke und verließ mit ihm das Haus.
*
In der Bibliothek des Gutshauses waren sechs Menschen um den großen Eichentisch versammelt.
Denise saß an der Schmalseite, zu ihrer Linken hatte Claudia Platz genommen, zu ihrer Rechten der Bürgermeister des Dorfes, Herr Lenhard. Neben ihm saß der Lehrer Brodmann. An Claudias Seite hatte sich der junge Dr. Brachmann niedergelassen, als gehöre er dorthin, und neben ihm sein Vater.
Denise gegenüber war noch ein Platz frei. Alexander von Schoenecker traf eben mit Verspätung ein.
»Ich bitte um Entschuldigung«, bat er, »ich habe heute meine Kinder aus dem Internat abgeholt, und wir kamen nicht so schnell voran, wie ich hoffte.«
»Es macht gar nichts«, erwiderte Denise, die er mit einem Handkuß begrüßt hatte, während er der übrigen Runde nur eine Verbeugung zollte. »Sie wissen ja, worum es sich handelt, Herr von Schoenecker.«
Hier, vor diesen Leuten konnte sie ihn unmöglich mit seinem Vornamen ansprechen, obgleich er sich beinahe über ihre Lippen gedrängt hätte. Er sah erschreckend erschöpft aus, und sie fragte sich, welcher Kummer ihn heute bewegte.
»Ich werde mich selbstverständlich an dem Schulhausneubau beteiligen«, erklärte er rasch, »soweit es mir finanziell möglich ist.«
»Darum geht es gar nicht«, ergriff Dr. Ludwig Brachmann das Wort. »Die Finanzierung ist gesichert. Ich glaube, es nach Rücksprache mit Frau von Wellentin verantworten zu können, daß sie aus der Erbmasse ihres Sohnes erfolgen kann. Von Ihnen, Herr von Schoenecker, erbitten wir ein paar Hektar Land, die wir von Ihnen erwerben möchten.«
»Ich stelle sie selbstverständlich unentgeltlich zur Verfügung«, erwiderte er rasch.
Der Bürgermeister sagte zufrieden: »Mir scheint, wir haben bisher an den falschen Türen angeklopft. Ehrlich gesagt, ich bin erstaunt,
daß Sie unseren Plänen so wohlgesonnen sind, Herr von Schoenecker.«
»Ich muß ja einen sehr schlechten Ruf genießen«, antwortete Alexander sarkastisch. »Aber bisher habe ich mich mit solchen Problemen noch nie befaßt. Darauf mußte erst Frau Denise von Wellentin kommen.«
Die ungewöhnliche Wärme in seiner Stimme irritierte die andern. Zu ihrer eigenen Beruhigung konnte Denise feststellen, daß sie nicht errötete.
»Dann können wir also ein Glas auf unseren Schulhausbau leeren«, sagte sie souverän. »Ich bin sehr glücklich.«
»Wir auch, Frau von Wellentin«, versicherte der Bürgermeister. »Darf ich bei dieser Gelegenheit im Namen unserer kleinen Gemeinde bemerken, daß Sie unserer aller Verehrung sicher sein dürfen.«
Als dann die Gläser erhoben wurden, fiel es nicht auf, daß Lutz Brachmann und Claudia etwas abseits standen.
»Auf die Schule und auf uns, Claudia«, raunte er ihr zu und verwirrte sie damit sehr.
»Vergessen Sie nicht, warum ich hierhergekommen bin, Herr Doktor!«
»Ich vergesse es keinen Augenblick und finde es großartig. Aber vielleicht läßt sich alles unter einen Hut bringen. Sophienlust, Ihre Freundschaft zu Denise und ganz bescheiden auch ich. Es gibt doch hoffentlich keinen andern!«
»Es gibt keinen und wird vorerst auch keinen geben«, erwiderte sie trotzig.
»Doch«, lächelte er, »mich! Wissen Sie, was ich jetzt tun möchte?«
Claudia las es in seinen Augen. Und ihr Herz sagte beglückt ja!
Sie verließ das Zimmer. Auch das bemerkte niemand, denn alle andern unterhielten sich angeregt, wenn man davon absah, daß Alexander von Schoenecker, an den Kamin gelehnt, stumm zu Denise hinüberblickte und ihr lebhaftes Mienenspiel in sich aufnahm. Lutz Brachmann warf einen kurzen Blick auf die kleine Gesellschaft, dann folgte er Claudia.
Doch als er sie in der schon offenen Tür erreichte und gerade nach ihrer Hand fassen wollte, drang ein jämmerliches Weinen an ihr Ohr.
Claudia drehte sich zu Lutz Brachmann um. »Es ist das Weinen eines Babys.«
»Ach, das ist Einbildung, Claudia!«
Aber da vernahm auch er das Weinen. Und dann sahen sie das kleine Bündel am Fuße der Treppe.
»Guter Gott«, sagte Lutz, »das darf doch nicht wahr sein!«
Claudia nahm das Bündel hoch und wiegte es in ihrem Arm. Aus der Decke rutschte ein Zettel.
Lutz Brachmann nahm ihn und las im Schein der Lampe:
Ich heiße Petra und habe eine unglückliche Mutter, die mich eines Tages wieder abholen wird. Seid bitte gut zu mir.
»Hoffentlich passiert das nicht zu oft«, seufzte Lutz, »sonst sehe ich schwarz für unsere eigene Familie, liebste Claudia.«
Ein zärtliches Lächeln umspielte ihren Mund, als sie in seine Augen blickte. »Liebster Lutz«, flüsterte sie dann, »wenn du dich an den Gedanken gewöhnen kannst, daß ich vorerst hier unabkömmlich bin, sehe ich nicht schwarz.«
Er beugte sich vor und küßte sie auf die weichen Lippen. »Ich habe mich schon an diesen Gedanken gewöhnt«, raunte er ihr ins Ohr. »Und was nun?«
»Wir haben einen neuen Hausgenossen, oder dachtest du, ich lege das süße Baby wieder vor die Tür?«
*
Denise unterbrach ihr Gespräch, als Claudia, gefolgt von Lutz Brachmann, mit dem Bündel auf dem Arm im Zimmer erschien. Noch ehe sie fragen konnte, sagte Claudia:
»Jemand hat uns ein Findelkind vor die Tür gelegt. Es scheint sich herumzusprechen, daß hier das Haus der glücklichen Kinder im Entstehen ist. Es heißt Petra und hat eine unglückliche Mutter, die es eines Tages wieder abholen will.«
»Daß niemand etwas bemerkt hat«, wunderte sich Denise. »Nicht mal Senta hat gebellt.«
»Doch hat Senta gebellt«, rief Dominik vom Obergeschoß herunter. Die lauten Stimmen hatten ihn aus dem Schlaf gerissen und wißbegierig, wie er nun einmal war, wollte er erfahren, worum es da unten ging.
»Nur ein bißchen, dann hat sie gewinselt. Aber das war erst, als ich Claudias Stimme gehört habe.«
Alle sahen auf den kleinen Jungen im blauen Schlafanzug. »Das könnte bedeuten, daß die Mutter – oder wer immer das Baby vor die Tür gelegt hat – noch in der Nähe ist«, meinte Herr Brodmann erregt.
»Ein Baby? Was für ein Baby?« fragte Dominik, aber niemand beachtete ihn. Die Männer gingen hinaus, nur Alexander von Schoenecker blieb zurück und trat ein paar Schritte auf Denise zu, während Dominik staunend das kleine Wesen auf Claudias Arm betrachtete.
»Nun, Alexander, Sie beteiligen sich nicht an der Suche?« fragte Denise.
»Soll man ein verzweifeltes Menschenkind jagen, das in diesem Augenblick vielleicht gerade Gott dankt, ihr Kind in guten Händen zu wissen?« antwortete er. »Ich sah vorhin eine Frau auf einem Fahrrad, als ich kam. Ich dachte allerdings, sie gehöre ins Dorf. Es kann sein, daß sie es war.«
»Auf einem Fahrrad mit einem kleinen Kind«, überlegte Denise. »Es ist sehr dunkel draußen. Sehen Sie, der Himmel ist bewölkt. Aber sie hat Sophienlust gefunden.«
»Ein guter Stern mag sie geleitet haben«, flüsterte er. »Der gleiche vielleicht, der Sie hierherführte, Denise.«
»Jetzt haben wir ein Baby, Mutti!« unterbrach Dominik das Gespräch.
»Ja, wir werden es schleunigst versorgen und ins Bett legen«, erwiderte sie energisch.
Die Männer kehrten nach erfolgloser Suche zurück, als Claudia die kleine Petra schon ins Obergeschoß getragen hatte. Nirgendwo hatten sie die Spur einer jungen Frau gefunden. Niemand hatte sie gesehen.
Lutz Brachmann aber überraschte seinen Vater und alle Anwesenden mit der Erklärung, daß er die Patenschaft für die kleine Petra für sich beanspruche und als Anwalt künftig alle ihre Rechte wahrzunehmen gedenke.
»Schließlich habe ich sie mit Claudia gefunden«, war seine Begründung.
Doch zu seinem Bedauern hatte er keine Gelegenheit mehr, Claudia noch einmal zu sprechen. Sie war damit beschäftigt, das Baby zu füttern. Eine Plastiktüte mit der Flasche und einer Packung Kindernahrung hatte sie in dem Bündelchen gefunden. Auch ein paar Windeln, ein Hemdchen und ein Jäckchen.
»Wir sind ja schon einigermaßen auf Zuwachs eingerichtet, aber an Säuglinge haben wir nicht gedacht, Isi«, lächelte sie.
»Das wird morgen geändert werden«, erwiderte Denise. »Ich möchte nur wissen, wieso das Mädchen hierherkam?«
»Geredet wird über Sophienlust doch genug«, meinte Claudia. »Warum sollte es der Mutter nicht zu Ohren gekommen sein.«
Das stimmte. Doch Edith Gerlach, die diese kühle Maiennacht unter freiem Himmel verbrachte, weil sie nicht wußte, wohin sie gehen sollte, war ahnungslos, daß jene Frau von Wellentin, bei der sie morgen ihre Stellung antreten sollte, in so enger Beziehung zu Sophienlust stand.
*
In den Kinderzimmern des Gutshauses Schoeneich brannte an diesem Abend noch lange Licht. Sascha und Andrea hatten gewartet, bis ihr Vater wieder das Haus verlassen hatte, dann trafen sie sich in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer.
»Ich weiß immer noch nicht, warum er uns heimgeholt hat«, meinte Sascha mürrisch. »Großmama wollte doch, daß wir die Ferien bei ihr verbringen.«
»Ich bin froh, daß ich hiersein kann«, entgegnete Andrea. »In der Stadt ist es langweilig.«
»Aber Großmama wird böse sein«, beharrte er. »Er hatte schlechte Laune.«
»Er hatte keine schlechte Laune«, verteidigte Andrea ihren Vater. »Er war bedrückt. Ich möchte nur wissen, warum Großmama uns immer gegen ihn aufhetzt.«
»Weil Mami tot ist, und er nicht da war, als der Hund sie gebissen hat. Großmama konnte Hunde noch nie leiden, aber Vati mußte ja welche haben.«
»Vati kann doch nichts dafür, daß der Hund tollwütig war.«
»Er hätte uns alle beißen können, sagt Großmama. Bestimmt hatte er einen Fuchs gebissen und sich angesteckt. Wir haben das neulich im Unterricht durchgenommen. Solche Tiere müssen sofort erschossen und die Menschen, die gebissen worden sind, müssen gleich geimpft werden.«
»Er ist doch erschossen worden, als man ihn fand. Mami hätte den Arzt kommen lassen müssen, aber das wollte sie nicht, weil sie auf den Ball gehen wollte. Weißt du, Sascha, ich finde es auch nicht richtig, daß sie auf den Ball ging, obwohl Vati nicht da war.«
»Du weißt das doch gar nicht mehr so genau«, widersprach er. »Du kannst dich ja nicht mal an Mami richtig erinnern.«
»Doch kann ich das! Früher war Vati auch ganz anders. Wir sollen auch nur böse mit ihm sein, weil Großmama es will.«
»Großmama will, daß wir immer bei ihr leben, aber das will Vati nicht. Deswegen müssen wir in das blöde Internat.«
»Ich glaube nicht, daß alles so ist, wie Großmama sagt«, stellte Andrea nachdenklich fest. »Vati hat uns nämlich doch lieb.«
»Aber eines Tages werden wir eine Stiefmutter bekommen«, trumpfte Sascha auf. »Und deswegen will Großmama lieber, daß wir bei ihr sind.«
»Wir können ihn doch einfach fragen, ob wir eine Stiefmutter bekommen sollen«, schlug Andrea vor.
»Er wird uns vor die vollendete Tatsache stellen, meint Großmama.«
»Ich kenne mich da nicht aus. Jennifer hat eine Stiefmutter, aber sie sagt, daß sie sehr lieb ist.«
»Und warum ist sie dann auch im Internat?« fragte Sascha aggressiv.
»Sie bauen gerade ein Haus, und dann kommt sie heim.«
»Dann kann man noch gar nichts sagen«, überlegte Sascha. »Hast du schon mal ein Märchen gelesen, in dem die Stiefmutter lieb war?«
»Ich kann Märchen überhaupt nicht leiden«, erklärte Andrea. »Ich mag lieber Geschichten mit Kindern, die viel Spaß haben. Sei doch nicht so bockig, Sascha! Morgen reiten wir mit Binni und Ben. Ich freue mich schon, und die werden sich auch freuen. Und einmal fährt Vati mit uns nach Sophienlust, das wird jetzt ein Kinderheim.«
»Vielleicht will er uns dorthin stecken, damit wir noch weiter von Großmama entfernt sind. Sie hat mir eine Armbanduhr versprochen, mit Stoppuhr und allem Drum und Dran. Die möchte ich gern haben.«
»Du magst Großmama ja nur, weil sie alles kauft, was wir haben wollen. Aber so schön wie hier ist es bei ihr nicht. Da kannst du reden, was du willst. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Sascha.«
*
Auf Sophienlust hatten sich die Gäste verabschiedet. Das Baby Petra war versorgt, und auch Dominik lag in seinem Bett. Mario dagegen hatte alles verschlafen.
Alexander von Schoenecker war noch etwas länger geblieben. Denise spürte, daß er etwas auf dem Herzen hatte.
»Es ist zwar schon sehr spät geworden«, sagte er entschuldigend, »aber ich wäre Ihnen dankbar, Denise, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit für mich hätten.«
»Gern! Fehlt Ihren Kindern etwas? Ich merkte, daß Sie sehr bedrückt sind.«
»Ihnen fehlt die richtige Einstellung zu mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie dürfen nicht glauben, daß ich sie gern in das Internat gab, aber meine Schwiegermutter wollte die Erziehung der Kinder in die Hand nehmen, damit wären sie mir ganz entfremdet worden.«
»Daran kann sie doch kaum ein Interesse haben«, sagte Denise verwundert.
»Ich habe mich ehrlich bemüht, ihr Verständnis entgegenzubringen, aber indirekt gibt sie mir die Schuld an Sybilles Tod. Sie war ihre einzige Tochter, und sie hat sie abgöttisch geliebt. Sie war damals schon gegen unsere Heirat.«
»Ich kenne zwar die näheren Umstände nicht, aber es ist doch wohl sehr an den Haaren herbeigezogen, Ihnen die Schuld geben zu wollen, daß Ihre Gattin von einem tollwütigen Hund gebissen wurde.«
»Es war einer von meinen Jagdhunden. Meine Schwiegermutter haßt Hunde. Sie wollte überhaupt nicht, daß Sybille in ein Gut einheiratet. Sie hätte sie lieber als Frau eines Industriellen gesehen.«
»Wahrscheinlich sogar als Frau eines ganz bestimmten Mannes. So wie die Wellentins es lieber gesehen hätten, wenn Dietmar Barbara von Borken geheiratet hätte. Warum
nur macht man immer wieder jungen Menschen Vorschriften, wen
sie lieben und heiraten sollen. Womit kann ich Ihnen helfen, Alexander?«
»Ich möchte Sascha und Andrea gern einmal herbringen. Aber es kann sein, daß sie aufsässig und abweisend sind. Zu mir sind sie es manchmal auch. Andrea weniger, aber Sascha steht sehr unter dem Einfluß seiner Großmutter, die ihn sehr verwöhnt. Sicher habe ich vieles falsch gemacht. Ich kann mir nur nicht erklären, warum sie besonders in letzter Zeit so renitent geworden sind.«
»Ich werde schon mit ihnen zurechtkommen«, tröstete ihn Denise. »Jedes Kind hat seine Eigenheiten. Wie lange bleiben die beiden?«
»Zehn Tage.«
»Versuchen Sie zu ergründen, warum sie aufbegehren. Vielleicht ist es purer Trotz, weil sie sich in dem Internat nicht wohl fühlen.«
»Es tut so wohl, mit einem Menschen sprechen zu können«, dankte er. »Sie können gar nicht ermessen, Denise, was es für mich bedeutet.«
»Doch, das kann ich. Ich wäre auch verzweifelt, wenn ich Claudia nicht gehabt hätte.« Sie seufzte leicht. »Kopf hoch, Alexander, es wird schon alles gut werden.«
Eigentlich hatte sie in dieser Woche nach Innsbruck fahren wollen, um nach Susanne Berkins Vater zu forschen, aber jetzt schob sie es hinaus. Alexander von Schoeneckers Kinder erschienen ihr im Augenblick noch wichtiger.
*
»Eine ziemlich mickrige Person hast du dir da ins Haus geholt«, stellte Hubert von Wellentin mürrisch fest. »Hast du denn nichts Besseres gefunden?«
Er fand, daß es seinem Prestige abträglich war, wenn ein so bescheidenes Wesen seine Frau auf ihrer Reise begleitete. Aber diesmal hatte sich Irene von Wellentin allein entschieden. Sie wußte selbst nicht, warum sie Edith Gerlach sofort akzeptiert hatte.
Ein wenig erschrocken war sie allerdings doch gewesen, als Edith Gerlach an diesem Vormittag blaß und übernächtigt bei ihr erschienen war. Zwar war ihre Kleidung korrekt, Edith hatte sich im Waschraum des Bahnhofs gewaschen und umgekleidet, aber sie machte doch einen erschreckend hinfälligen Eindruck.
Hubert von Wellentin hatte das Haus nach dieser herben Kritik sofort verlassen. Irene konnte sich so dem jungen Mädchen widmen, das still und bescheiden auf seinem Zimmer gewartet hatte.
»Wenigstens ist sie nicht aufdringlich«, stellte Irene von Wellentin fest. Und scheinbar trägt sie einen Kummer mit sich herum. Seit sie selbst eigene Sorgen hatte, dachte sie mehr über andere nach.
»Nach dem Essen werden wir in die Stadt fahren und Kleidung für Sie kaufen«, sagte sie beiläufig. »Übermorgen reisen wir ab.«
Wenn wir nur schon weit, weit weg wären, dachten sie beide gleichzeitig, ohne dies jedoch voneinander zu wissen.
Hoffentlich haben sie dich gleich gefunden, mein Kleines, dachte Edith unentwegt.
Heute morgen hatte sie schon, als sie in den Spiegel geblickt hatte, fürchten müssen, daß Frau von Wellentin sie wieder wegschicken würde. Sie war sogar verwundert, daß dies nicht der Fall war, nachdem sie von Hubert von Wellentin kalt und herablassend gemustert worden war.
Sie hatte ihr bestes Kleid angezogen. Da sie sehr mager geworden war, hing es an ihr herab, aber ihr feines Gesicht verriet, daß sie aus besseren Verhältnissen stammen mußte.
Davon konnte sich Irene von Wellentin im Verlauf des Nachmittags überzeugen. Edith Gerlachs Benehmen verriet eine gute Erziehung, sie sprach Englisch und Französisch und erwähnte auf Frau von Wellentins Fragen, daß sie das Abitur gemacht hätte, aber noch keinen Beruf ergreifen konnte.
»Haben Sie häusliche Schwierigkeiten gehabt?« erkundigte sich Irene von Wellentin.
»Ich wollte heiraten«, erwiderte Edith leise, »aber…«
»… der Mann hat Sie im Stich gelassen«, ergänzte Irene von Wellentin.
»So ist es«, erwiderte Edith. »Ich kann vorläufig nicht zu meinen Eltern zurückkehren. Bitte, gnädige Frau, geben Sie mir eine Chance. Ich werde mich zutiefst dankbar erweisen.«
Ich werde wenigstens einen Menschen gewinnen, der mir ergeben ist, dachte Irene von Wellentin mit einer Mischung von Resignation und Hoffnung.
»Ihre Papiere sind doch in Ordnung?« erkundigte sie sich.
Es gab nichts auszusetzen. Mündig war Edith Gerlach auch, also konnte nichts passieren.
Sie kauften einige schlichte, aber doch hübsche Kleider und das Zubehör. Natürlich nicht in einem Modesalon, sondern in einem Kaufhaus. Als sie alles Notwendige beisammen hatten und Frau von Wellentin den Auftrag gab, es umgehend in ihr Haus zu schicken, erschrak sie, als die Kassiererin zu einer Packerin sagte: »Bringen Sie bitte die beiden Sendungen nicht durcheinander. Die Babyausstattung geht zu Frau Denise von Wellentin nach Gut Sophienlust.«
Da sie selbst erregt war, fiel es Irene nicht auf, daß Edith beinahe ohnmächtig wurde.
Eine gutgekleidete junge Dame warf Frau von Wellentin einen kurzen Blick zu.
»Packen Sie die Babysachen besser gleich zusammen«, bat sie.
»Ich werde sie selbst mitnehmen.«
»Ich wußte nicht, daß es noch eine Frau von Wellentin gibt«, stammelte Edith in ihrer Verwirrung.
»Davon brauchen Sie auch keine Notiz zu nehmen, mein Kind«, erwiderte Irene kühl. »Wir haben nichts miteinander zu tun.«
»In was bin ich da hineingeraten?« überlegte Edith krampfhaft.
Das ist also Dominiks Großmutter, dachte Claudia, die die Babysachen für die kleine Petra eingekauft hatte, ohne dem Mädchen an Irene von Wellentins Seite einen Blick zu schenken. Wie hätte sie auch ahnen sollen, daß sie in ihr die Mutter der kleinen Petra vor sich hatte.
»Eigentlich sieht die alte Dame gar nicht so übel aus«, überlegte Claudia weiter. Aber so ist es nun mal auf der Welt, da gibt es Großmütter, die ihre Enkel vergöttern, daß sie sie sogar dem Vater wegnehmen möchten, wie es bei den Schoeneckers der Fall ist, und dann gibt es welche, die von ihren Enkelkindern nichts wissen wollen.
»Babysachen kaufen sie«, überlegte Irene von Wellentin. »Es ist ihr tatsächlich ernst mit dem Heim.« Bisher hatte sie daran immer noch Zweifel gehegt.
Die Ungewißheit ließ ihr keine Ruhe. Wieder daheim, überwand sich Irene von Wellentin und rief eine Bekannte an.
Unwillkürlich lauschte Edith, als der Name Sophienlust fiel. »Was du nicht sagst«, vernahm sie Irene von Wellentins erregte Stimme, »ein Findelkind haben sie aufgenommen? Das wird ja immer besser! Ja, natürlich«, sprach sie dann gedämpfter, »das ist sehr menschlich und anerkennenswert. Nein, ich sehe da keinen Weg bei Huberts Einstellung. Ich verreise für sechs Wochen.«
Edith aber war jetzt leichter ums Herz. Sie wußte, daß ihre kleine Petra liebevolle Aufnahme gefunden hatte, und sie konnte jetzt nur wünschen, daß niemand sie, die unglückliche Mutter, fand.
Am nächsten Morgen reisten sie ab.
*
»Jetzt hat das Baby schon Sachen, nun geben wir es nie mehr her«, verlangte Dominik energisch. »Eine richtige Mutti gibt ihr Kind nicht fort.«
»Ich mußte dich auch einmal in ein Heim geben, Nick«, erinnerte Denise ihn. »Darüber war ich auch sehr unglücklich.«
»Aber ich wußte wer ich bin, und du hast mich immer besucht.«
»Petras Mutti ist vielleicht sehr arm«, versuchte Denise ihn zu beschwichtigen.
»Aber dann hätte sie mit dir sprechen können, und du hättest ihr gesagt, daß wir kein Geld wollen. Aber vielleicht hat sie das nicht gewußt. Madame Merlinde hätte ja auch kein Kind ohne Geld aufgenommen.«
Die Realitäten des Lebens waren Dominik nicht unbekannt. Er nahm regen Anteil an allem, was um ihn herum geschah. Mit Mario war er heute morgen ein bißchen böse, denn Mario war gar nicht begeistert von dem Baby, weil Claudia diesem so viel Zeit widmete.
»Du hast deine Mutti und Claudia hat jetzt das Baby«, sagte er bockig. »Mich braucht keiner mehr.«
»Du bist blöd«, antwortete Dominik verärgert. »Was soll denn das werden, wenn noch mehr Kinder kommen? Außerdem hast du Bum. Die anderen Hündchen könnten ja auch beleidigt sein, wenn du dich mehr mit ihm beschäftigst als mit ihnen.«
Diese Logik leuchtete Mario schließlich ein, und der Frieden war wiederhergestellt.
»Nick wird uns eine tüchtige Hilfe sein, wenn es später darum geht, Streit zu schlichten«, lächelte Denise.
»Komisch, daß er so friedfertig ist bei dem gräßlichen Großvater«, meinte Claudia. »Ich habe ihn heute morgen auf der Bank gesehen. Da friert man ja gleich. Seine Frau ist bestimmt auch nicht zu beneiden. Aber machen wir uns nichts daraus. Wir wollen ein friedliches Haus und eine große fröhliche Familie werden.«
»Was dich betrifft, da mache ich mir meine eigenen Gedanken, Claudi. Lutz Brachmann ruft ziemlich häufig an. Ob er mit einer großen fröhlichen Familie einverstanden sein wird?«
»Er kann ja Anteil daran nehmen«, erwiderte Claudia heiter. »Meinst du, ich lasse dich im Stich?«
»Früher oder später wirst du vor die Entscheidung gestellt werden, und ich möchte nicht, daß du dann Rücksicht auf mich nimmst.«
Claudia errötete. »Schau, wir kennen uns ja kaum. Na gut, ich mag ihn gern. Er ist so ehrlich und hilfsbereit. Aber deswegen braucht man doch nicht gleich an Ehe zu denken. Außerdem gibt er sich auch damit zufrieden, wenn wir uns zweimal in der Woche sehen.«
Denise lächelte. Soweit war es also doch schon gediehen. Ihre Gedanken wurden abgelenkt. Draußen fuhr ein Wagen vor. Alexander von Schoenecker kam mit seinen Kindern.
Ein wenig bang war ihr schon. Ob sie auch die Ähnlichkeit, die sie mit ihrer verstorbenen Mutter hatte, bemerkten? Und wie würden sie reagieren?
Sie waren sehr zurückhaltend. Denise spürte förmlich, wie Sascha voller Mißtrauen beobachtete, daß sein Vater ihr die Hand küßte.
Dominik brachte Bewegung in die schweigende Runde. »Guten Tag«, rief er fröhlich. »Du bist Sascha und du Andrea, nicht wahr? Ich habe mir eure Namen gemerkt. Sie gefallen mir. Ich bin Dominik, aber ihr könnt Nick zu mir sagen.«
Es befremdete ihn, daß diese Kinder nicht reagierten.
»Wollt ihr Senta und ihre Jungen sehen?« fragte er kleinlaut.
»Wir mögen keine Hunde«, erwiderte Sascha abweisend.
Es war Dominik unbegreiflich, daß man Hunde nicht leiden konnte. »Na, dann nicht«, sagte er bockig. »Dann mögt ihr wohl auch keine Babies.«
»Doch, Babies mag ich schon ganz gern«, sagte Andrea. »Habt ihr welche?«
»Wie geht es denn Nicki und Bambino?« fragte Alexander die beiden Jungen, denn Mario hatte sich mittlerweile auch herangepirscht, ohne jedoch von sich aus einen Versuch zu machen, den fremden Kindern entgegenzukommen.
»Denen geht es gut. Sie sind auf der Wiese«, erzählte Dominik. »Willst du jetzt das Baby sehen, Andrea, oder gehen wir zu den Ponies?«
Die Meinungen waren geteilt. Sascha wollte zu den Ponies.
Denise fürchtete schon, daß er eine anzügliche Bemerkung darüber machen würde, daß sein Vater die beiden hübschen Tiere hergegeben hatte, aber sie blieb aus. Sie wußte nicht, daß es darüber schon vorher auf Schoeneich eine Diskussion gegeben hatte, bei der Andrea sich allerdings auf die Seite ihres Vaters gestellt hatte.
»Petra schläft jetzt noch«, mischte sich Claudia ein. »Später hole ich sie dann.«
»Wieviel Frauen und wieviel Kinder habt ihr denn hier?« fragte Andrea interessiert, nachdem sie Claudia mit einem Knicks begrüßt hatte, während es Sascha bei einem kurzen Kopfnicken beließ.
»Meine Mutti, Claudia«, begann Dominik aufzuzählen, »und dann natürlich Magda, Lena und die Mädchen.«
»Das sind doch Dienstboten und keine Damen«, belehrte ihn Sascha.
»Dienstboten ist kein nettes Wort«, erwiderte Dominik aggressiv. »Wir haben alle gern.«
Sascha aber antwortete aufsässig:
»Aber einen Vater hast du nicht, und eine Großmama auch nicht.«
»Sascha!« ermahnte Alexander ihn.
»Du hast einen Vater«, sagte Dominik ernst. »Einen Großvater und eine Großmutter hätte ich auch, aber die wollen nichts von mir wissen. Müssen wir darüber streiten?«
Andrea zischte ihrem Bruder zu: »Du bist gemein!« Dann stellte sie sich an Dominiks Seite. »Er redet manchmal dummes Zeug«, erklärte sie. »Mach dir nichts draus!«
»Ich mach’ mir auch nichts draus. Aber er ist doch schon viel älter als ich«, meinte Dominik, »da müßte er auch mehr Verstand haben.«
Das war ein schwerer Schlag für Sascha, aber seltsamerweise nahm er ihn wortlos hin. Erst nach einer Weile stieß er böse hervor: »Das gibt es ja gar nicht, daß Großmütter Kinder nicht mögen.«
»Wenn ich was sage, dann stimmt es auch«, behauptete Dominik. »Ich lüge nie. Meine Mutter sagt, das darf man nicht.«
Ganz verwinden konnte Sascha seine Niederlage nicht, wenn er sich auch verhältnismäßig friedlich im weiteren Verlauf des Nachmittags gab. Magdas wundervollem Schokoladenkuchen konnte selbst er nicht widerstehen, obgleich er zuerst erklärt hatte, daß er keinen Hunger hätte.
»Du hast es ihm ganz schön gegeben«, raunte Andrea Dominik später zu. »Du hast vielleicht Mut. Ich traue mich nicht, so mit ihm zu reden.«
»Du bist ja auch seine Schwester und mußt immer mit ihm auskommen. Aber gefallen lassen würde ich mir nicht alles, auch nicht, wenn ich ein Mädchen wäre.«
Das Baby Petra war von Andrea hingebungsvoll bewundert worden.
»Wir finden sie auch niedlich, nicht wahr, Mario«, meinte Dominik, und der Kleinere pflichtete ihm bei.
Sascha hatte unentwegt überlegt, auf welche Weise er sich an Dominik für die erlittene Demütigung rächen könnte. Endlich war ihm etwas eingefallen.
»Na, warte nur, wenn du mal einen Stiefvater kriegst, dann wirst du schon sehen, was dir blüht«, schrie er völlig unmotiviert.
»Ein Stiefvater? Was ist denn das?« fragte Dominik verwundert.
»Wenn deine Mutti wieder heiratet«, trumpfte Sascha auf.
»Meine Mutti heiratet doch nicht. Sie hat doch mich und Claudia und die Kinder. Wir kriegen noch ganz viele Kinder und brauchen keinen Vater, schon gar keinen Stiefvater«, empörte er sich. »Jetzt habe ich aber bald genug von dir. Andrea ist viel netter als du!«
Sascha wollte nicht, daß dieser Knirps immer das letzte Wort behielt, darum schrie er erbost: »Wenn wir eine Stiefmutter bekommen, dann bekommst du einen Stiefvater!«
Alexander, der mit Denise eben die streitbare kleine Gesellschaft erreicht hatte, blieb wie erstarrt stehen.
»Ich weiß nicht, wie er darauf kommt«, sagte er tonlos. »Es war nie die Rede davon, daß ich wieder heirate.«
»Kinder reden sich manches ein«, beschwichtigte Denise. »Sie sollten einmal offen mit ihnen sprechen, Alexander!«
»Mit tut es nur leid, daß er solchen Unfrieden in Ihr ruhiges Haus gebracht hat, Denise.«
»Oh, darüber machen Sie sich ja keine Gedanken. Wir werden hier noch so manchen Strauß auszufechten haben. Kinder bringen ihren eigenen Charakter mit, und daran kann man nicht viel ändern. Man kann ausgleichen, manches tun, um ihre Persönlichkeit zu formen, aber grundlegend ändern kann man sie nicht. Was in ihnen ist, muß sich entwickeln. Und sicher werde ich wohl auch manche Enttäuschung erleben. Sascha ist ein Dickkopf, aber bestimmt hat er seine guten Seiten.«
»Er steht zu sehr unter dem Einfluß seiner Großmutter«, sagte sein Vater.
»Ich will mich nicht einmischen«, antwortete sie leise, »aber vielleicht haben auch Sie nicht die richtige Einstellung zu ihr.«
Er sah sie bestürzt an. »Sie hat mich als den Mörder meiner Frau hingestellt, weil ich ein paar Hunde gehalten habe.«
»Der Tod ihrer Tochter hat sie ungerecht gemacht. Ich wollte, ich könnte solche Entschuldigung für Dietmars Eltern finden. Aber was für die Kinder gilt, gilt ebenso für die Erwachsenen. Nur Einsicht kann ihre Einstellung ändern. Bitte, nehmen Sie mir diese Bemerkung nicht übel.«
»Wie könnte ich das? Sie sind der erste Mensch, bei dem ich das Gefühl habe, angehört zu werden.«
Ihr Herz begann schmerzhaft zu klopfen.
Der erste Mensch, ging es ihr durch den Sinn. Und seine Frau? Hatte sie ihn nicht angehört?
»Darf ich wiederkommen?« fragte Andrea, als sie sich verabschiedete. »Würdest du es erlauben, Vati, daß ich jeden Tag nach Sophienlust fahre?«
In seinen traurigen Augen kam ein freudiges Lächeln. »Gern, Andrea, wenn du es möchtest.«
»Es war sehr schön. Vielen Dank, Frau von Wellentin«, knickste sie. »Und für Sascha möchte ich mich entschuldigen.«
»Das kann ich selbst«, stieß er hervor. »Ich habe es nicht so gemeint. Jetzt verstehe ich mich ja auch schon ganz gut mit Nick.«
»Die beiden werden sich schon zusammenraufen«, sagte Denise mit einem aufmunternden Lächeln, als sie Alexander ihre Hand entgegenstreckte.
»Auf baldiges Wiedersehen!«
»Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen«, riefen Dominik und Mario dem Wagen nach.
»Wie kamst du eigentlich dazu, mit Nick von einem Stiefvater zu sprechen?« fragte Alexander auf der Heimfahrt.
»Er tat so überlegen. Außerdem kriegt er ja einen Stiefvater, wenn seine Mutter heiratet.«
»Aber sie hat gar nicht die Absicht.«
»Will sie denn ganz allein mit so vielen Kindern fertig werden? Sie ist doch bloß eine Frau!«
»Oh, ich glaube, daß sie besser mit ihnen zurechtkommt als mancher Mann«, erwiderte sein Vater.
»Du magst sie. Du redest sie mit ihrem Vornamen an«, murrte Sascha.
»Ich bewundere und respektiere sie«, erwiderte sein Vater.
»Sascha hat Angst, daß wir eine Stiefmutter bekommen«, mischte sich Andrea ein. »Das hat ihm Großmama eingeredet. Aber du würdest es uns doch sagen, wenn du wieder heiraten willst, Vati?«
»Ich werde nicht wieder heiraten.«
Saschas Augen sahen ihn ernst an.
»Versprichst du uns das?«
»Ja, ich verspreche es euch!«
»Frau von Wellentin wäre bestimmt keine böse Stiefmutter«, meinte Andrea und stürzte ihren
Vater in noch tiefere Verwirrung. »Sie ist sogar zu fremden Kindern nett.«
»Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht.«
»Und Claudia? Sie hat nicht mal selbst ein Kind und ist auch lieb zu ihnen«, fuhr Andrea fort.
»Ich möchte auch gern auf Sophienlust sein. Lieber als in einem Internat. Da sind sie immer streng, und so guten Kuchen bekommen wir nie!«
»Das stimmt«, gab Sascha zu. »Es tut mir jetzt leid, daß ich so ungezogen war, Vati. Aber ich bin ja schon zu groß für die Kinder. Ich muß nächstes Schuljahr in die Oberschule.«
»Würdest du lieber zu Großmama gehen als in ein Internat?« fragte Alexander.
»Ich allein, ohne Andrea? Niemals!«
»Ich möchte lieber nach Sophienlust«, sagte Andrea. »Bei Großmama müssen wir immer so vornehm tun. Außerdem möchte ich dich lieber öfter sehen, Vati!«
»Wirkt Sophienlust Wunder?« fragte er sich. So hatte Andrea noch nie mit ihm gesprochen.
»Ich wäre auch sehr froh, wenn ich euch bei mir haben könnte«, gestand er. »Laßt uns einmal ganz ernsthaft darüber sprechen, ihr
seid jetzt doch schon recht vernünftig.«
»So, wie Nick mit seiner Mutti redet?« fragte Andrea. »Er kann nämlich über alles mit ihr sprechen.«
»Wir sind älter als er, mit uns kann Vati noch vernünftiger reden, wenn er will«, trumpfte Sascha auf.
»Wir könnten es ja versuchen. Ich werde mir Mühe geben«, erwiderte Alexander.
Jetzt war ihm schon etwas leichter ums Herz.
Auf Schoeneich angekommen, ertappte er Sascha, wie er das Bild seiner Mutter lange betrachtete.
»Irgendwie sieht Frau von Wellentin Mami ähnlich. Findest du nicht, Vati? Aber sie sieht aus wie ein Mädchen, gar nicht wie eine Frau. Ist sie eigentlich die richtige Mutti von Dominik, oder hat sie ihn auch nur gefunden?«
»Nein, sie ist seine richtige Mutti.«
»Und stimmt es wirklich, daß seine Großmutter ihn nicht mag?«
»Ist das die Frau von Wellentin von der Fabrik?« fragte Andrea.
Als Alexander, in Gedanken versunken, vergaß eine Antwort zu geben, bemerkte Sascha: »Du hast gesagt, daß wir mit dir über alles sprechen können.«
Nun stand er ihnen Rede und Antwort. Worauf Andrea nach langem Überlegen feststellte: »Hat denn noch niemand Frau von Wellentin gesagt, wie lieb Dominik ist?«
*
»Der gute Alexander von Schoenecker hat auch sein Kreuz zu tragen«, bemerkte Claudia beim abendlichen Plauderstündchen mit Denise.
»Sascha ist in einem schwierigen Alter. Davon werde ich mit Nick auch nicht verschont bleiben.«
»Andrea ist ein süßes Ding. Sie sieht dir sogar ein bißchen ähnlich.«
Gegen ihren Willen errötete Denise. »Ich habe auch eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Frau. Ei, wer kommt denn da?« lenkte Denise ab, als ein Auto vor der Tür bremste.
Heiße Glut schoß in Claudias Wangen. »Du hast doch nichts dagegen, wenn ich noch ein bißchen mit Lutz spazierengehe?«
»Es ist ein schöner Abend, nutze ihn gut!«
»Willst du nicht mitkommen?«
»Liebe Güte, davon würde Lutz kaum erbaut sein. Gute Nacht! Ich werde wohl schon schlafen, wenn du kommst«, lächelte Denise.
»Du hättest doch ruhig hereinkommen können. Warum so schüchtern, Lutz?« begrüßte Claudia den jungen Mann.
»Wir können uns so selten sehen, Claudi. Die Zeit ist so kostbar.« Ein abgrundtiefer Seufzer begleitete seine Worte. »Da trifft man endlich die Frau fürs Leben, und dann ist sie mit einem ganzen Kinderheim verheiratet.«
»Das ist nun auch wieder übertrieben. Weißt du, daß wir uns ganze vierzehn Tage kennen?«
»Tatsächlich? Es ist kaum zu glauben. Mir ist es jedenfalls so, als würden wir uns schon ein ganzes Leben kennen.«
Ihr ging es nicht viel anders. Sie lehnte sich an ihn und träumte vor sich hin.
»Wohin fahren wir?« fragte sie, als er nach rechs abbog, der Stadt zu. »Du willst doch nicht etwa ausgehen?«
»Nein, ich will einen Mondscheinspaziergang mit dir machen. Du gehst wohl nicht gern aus?«
Sie schüttelte den Kopf, sie war lieber mit ihm allein. Aber wer wollte ihr das verdenken, denn die Stunden mit ihm waren wirklich selten und kostbar.
Sie stiegen aus dem Wagen und wanderten ein Stück.
Vor einem Grundstück, das mit Obstbäumen bepflanzt war, blieb er stehen.
»Hier wirst du einmal wohnen, wenn du willst«, sagte er zärtlich. »Wir können mit dem Bau schon bald beginnen. Die Pläne sind fertig, aber du kannst noch Änderungswünsche anmelden. Eigentlich war es ja für einen Junggesellen gedacht.«
»Für welchen?« fragte sie schelmisch.
»Für mich natürlich! Ich kann doch nicht ewig bei meinen Eltern wohnen.«
»Und was sagen deine Eltern, wenn du heiraten willst?«
»Ich werde es dir nicht verheimlichen!«
»Du hast doch nicht etwa schon mit ihnen gesprochen?«
»Natürlich! Zwischen uns gibt es keine Heimlichkeiten. Weißt du, was Vater gesagt hat?«
»Es würde mich schon interessieren«, meinte sie kleinlaut.
»Junge, hat er gesagt, hast du ein Glück. Halt sie nur fest, damit sie dir nicht ein anderer wegnimmt.«
»Die Befürchtung brauchst du nicht zu haben«, flüsterte sie. Stürmisch preßte er sie an sich und küßte sie innig.
»Das will ich auch hoffen.«
»Und was sagt deine Mutter?«
»Sie möchte dich natürlich bald kennenlernen. Das ist doch klar. Du wirst dich mit ihr verstehen, denn du bekommst eine nette Schwiegermutter.«
»Du legst ein Tempo vor«, meinte sie erschrocken.
»Ich habe dich gleich geliebt. Ich kann das nicht so erklären, aber es war einfach da.«
»Und so habe ich es mir immer gewünscht«, raunte sie ihm ins
Ohr. »Man muß es von der ersten Sekunde an wissen: Der oder keiner!«
»Hast du es auch gewußt?«
»Mußt du da noch fragen?«
Er küßte sie wieder, und über ihnen leuchteten die Sterne, und der Mond schien zu lächeln.
*
»Am Mittwich also Kalbsrouladen«, bestimmte Magda, »die mag Nick am liebsten.«
»Dann gibt es am Donnerstag Salzburger Nockerln, die mag Mario«, verlangte Denise.
Magda machte sich ihre Notizen. »Die Frau von Wellentin ist verreist«, wechselte sie sprunghaft das Thema. »Sechs Wochen soll sie fortbleiben. Sogar eine Reisebegleiterin hat sie sich mitgenommen.«
Denise lächelte. Sie hatte sich schon daran gewöhnt, daß alle Neuigkeiten die Runde machten. Aber sie sagte nichts dazu.
»Ihm stinkt es ja furchtbar, daß die Schule nun ohne ihn gebaut wird. Damit hat er nicht gerechnet. Heute war er beim Bürgermeister und hat großspurig erklärt, daß er sein Grundstück dafür hergibt. Darum ging’s ja früher schon. Er hat vielleicht Augen gemacht, daß Herr von Schoenecker bereits eins zur Verfügung gestellt hat. Das ist nämlich wertvolles Land. Dem Schoenecker hat er besonders auf dem Zettel.«
»Wegen Barbara von Borken?« fragte Denise unwillkürlich.
»Nicht nur deswegen. Er ist mal Herrn von Schoeneckers Frau nachgestiegen. So moralisch, wie der Wellentin tut, ist er nämlich gar nicht.«
»Aber, Magda, wird da nicht ein bißchen zuviel geklatscht?« fragte Denise erschrocken.
»Ach was, Klatsch! Die Leute haben doch Augen und Ohren, und geflirtet hat die Sybille immer sehr gern. Es sagt ja keiner, daß sie was mit ihm hatte, aber der Schoenecker hat ihn wohl mal mächtig zur Rede gestellt. Er ist ein Ehrenmann, er hätte seine Frau immer verteidigt, aber man munkelt, daß sie ihn gar nicht geheiratet hätte, wenn ihre Mutter schon vorher den reichen Onkel beerbt hätte. Sie war ja auch älter als der Herr von Schoenecker. Wußten Sie das nicht?«
»Nein, und ich möchte es auch gar nicht wissen«, erwiderte Denise betroffen.
»Ich finde es gut, wenn man was über seine Mitmenschen weiß. Man kann sie dann doch viel besser verstehen.« Magdas Redefluß war nicht einzudämmen, und ganz insgeheim gestand sich Denise ein, daß es ganz interessant war. Ein Körnchen Wahrheit war in allem.
»Sie hat ihn nur so um den Finger gewickelt, jung wie er war«, fuhr Magda fort. »Na ja, sie war eine schöne Frau, und arm ist er ja auch nie gewesen.«
»Mir ist es lieber, wenn wir nicht über Herrn von Schoeneckers Privatangelegenheiten sprechen«, bemerkte Denise jetzt ruhig.
Magda war nicht eine Spur beleidigt.
»Ich dachte nur, daß Sie über ihn auch ganz gern was erfahren würden, denn er ist doch verschlossen wie eine Auster.«
»Dafür haben wir schon recht viel miteinander gesprochen, während dieser kurzen Zeit«, überlegte Denise. Und wenn sie darüber nachdachte, was zwischen den Worten stand, kannten sie sich schon sehr gut.
»Ich hab’s neulich gar nicht glauben wollen«, meinte Magda. »Mit Nick war er gleich ein Herz und eine Seele, und gelacht hat er auch. Da muß man staunen. Sie krempeln ihn schon noch um, gnädige Frau«, fügte sie mit einem rätselhaften Lächeln hinzu.
»Ich habe nicht die Absicht«, erwiderte Denise entschlossen.
»Na, dann reden wir mal wieder über den Küchenplan«, lenkte nun Magda ab.
*
Nach diesem Gespräch trieb es Denise hinaus. Claudia fehlte ihr. Die Kinder schliefen. So viele wirre Gedanken bewegten sie. Die kühle Nachtluft befreite sie ein wenig von den beklemmenden Sorgen, die in ihr erwacht waren. Aber immer wieder kehrten ihre Gedanken zu Alexander von Schoenecker zurück.
Wir werden gute Freunde sein, dachte sie, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Freundschaft konnte unendlich viel bedeuten. Vielleicht mehr als Liebe.
Da sah sie Lutz Brachmanns Auto nahen und glitt rasch in den Schatten eines Baumes. Sie sah, wie Claudia und Lutz ausstiegen, wie sie sich umarmten und küßten. Der Wind trug seine Stimme an ihr Ohr.
»Schlaf gut, mein Liebes, und vergiß mich nicht!«
Sie verschmolzen in einer langen Umarmung. Sie liebten sich. Eines Tages würde Claudia gehen, das war sicher. Denise gönnte ihr ein großes reiches Glück. Sie hatte es verdient. Sie war jung, besaß kein eigenes Kind und konnte nicht ein Leben lang die Verantwortung für fremde Kinder tragen, da es einen Mann gab, der sie liebte und den sie liebte. Schnell war es gegangen, aber so war das Leben.
Und sie, Denise, würde nächste Woche nach Innsbruck fahren, um nach Susanne Berkins Vater zu forschen. Dann würden sie vielleicht bald ein weiteres Kind auf Sophienlust haben.
Sie war fest entschlossen, Sophie von Wellentins Willen zu erfüllen. Fröhliche Kinder sollten in einem Park spielen, sie sollten vergessen, daß sie einmal allein und verlassen waren. Und sie brauchte sich nie mehr von Nick, ihrem Sohn, zu trennen. War das nicht Glückes genug?
Aber blieb nicht doch eine heimliche Sehnsucht? Jetzt wollte sie ihr keinen Raum geben. Leise ging sie zurück ins Haus, hinauf zu den Kindern. Sie schliefen alle fest, auch die kleine Petra. Ob ihre Mutter eines Tages wirklich zurückkommen würde?
Behutsam streichelte sie das Köpfchen des Babys. Wenn sie nicht mehr kommt, wirst du es nie erfahren, dachte sie.
Wir werden schon dafür sorgen, daß du lachen lernst und glücklich wirst. Dazu ist dieses Heim geschaffen worden.
Unwillkürlich faltete sie die Hände und dachte an Sophie von Wellentin, die dies ermöglicht hatte.
»Lieber Gott, gib mir die Kraft, meiner Aufgabe gerecht zu werden!« betete sie. »Es sollen doch noch viele Kinder hier glücklich werden.«