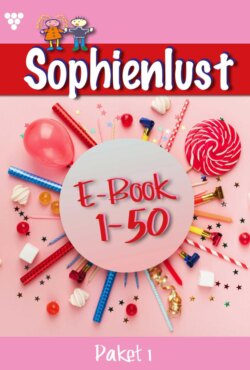Читать книгу Sophienlust Paket 1 – Familienroman - Diverse Autoren - Страница 20
ОглавлениеDer Wagen stand abfahrbereit vor der Tür. Sascha blickte ungeduldig auf seine Armbanduhr.
»Wo nur Nick wieder bleibt«, murmelte er. »Er könnte sich doch wirklich ein bisschen beeilen, wo Edith heute mit uns das Theaterstück einstudieren will.«
»Dazu wird er sicher keine Lust haben«, dachte Denise, denn sie kannte ihren eigensinnigen Sohn.
»Nick, Nick«, rief Andrea laut und gedehnt, aber nichts rührte sich. »Wenn er nicht will, dann will er nicht«, meinte die Zehnjährige kopfschüttelnd. »Ich gucke mal nach ihm.«
Denise ging mit. Wenn es nötig sein sollte, wollte sie Dominik mal wieder die Leviten lesen. Er musste lernen, dass es nicht immer nach seinem Kopf ging. Sascha und Andrea waren viel zu nachgiebig. Aber er war eben der Kleine und durfte sich noch manches erlauben, was sie bereits abgestreift hatten.
Doch diesmal taten sie Nick unrecht. Er saß an seinem Schreibtisch. Sein Kopf war auf die Hände gesunken. Aus fiebrig glänzenden Augen sah er seine Mutter an, als sie hinter ihn trat und ihre Hände auf seine Schultern legte.
»Was ist denn, Nick?«, fragte sie besorgt. »Wir wollen doch nach Sophienlust fahren.«
»Mein Kopf tut aber so arg weh, Mutti«, flüsterte er. »Ich kann gar nicht mehr denken. Ich konnte auch keine Hausaufgaben machen.«
»Aber warum hast du das denn nicht früher gesagt?«, meinte sie kopfschüttelnd. »Rasch ins Bett! Andrea, ruf Dr. Wolfram an.«
»Wenn es schon ein Arzt sein muss, dann Onkel Werner«, brummte Nick müde. »Ich mag Dr. Wolfram nicht.«
»Aber warum denn plötzlich nicht mehr?«, fragte Denise verwundert.
Sie bekam es erst heraus, als Nick schon im Bett lag. »Er ist nicht mehr nett zu Edith«, murmelte er. »Er hat nie mehr Zeit, und sie ist immer traurig.«
»Tatsächlich?«, fragte sich Denise. »Bildete sich Dominik das nicht bloß ein?« Ihr war es noch nicht aufgefallen. Allerdings kümmerte sie sich in letzter Zeit nicht mehr um all die persönlichen Anliegen der Angestellten, wie sie es früher getan hatte, als sie noch von früh bis spät mit ihnen beisammen gewesen war. Sie machte sich Vorwürfe.
»Es ist bestimmt nicht so, wie du denkst, Nick«, meinte sie begütigend. »Schau, jeder Arzt hat viel zu tun, und du weißt doch, wie wenig Zeit Onkel Werner für sein Privatleben hatte.«
»Jetzt hat er aber mehr Zeit, seit Dr. Wolfram da ist«, stellte Nick fest. »Und erst hatte der auch mehr Zeit. Na, meinetwegen soll er doch kommen, aber dann musst du ihn fragen, was er gegen Edith hat. Dir wird er es vielleicht sagen.«
Dazu war Denise auch sofort entschlossen. Sie hatte gelernt, dass Schweigen unselige Folgen haben konnte, und sie war in allen Dingen für Klarheit.
»Sascha und Andrea können ruhig fahren«, murmelte Dominik leise. »Edith braucht sie ja, weil sie Hauptrollen spielen. Ich bin nicht so wichtig. Ich stelle mich ja auch zu dumm an.«
Hatte er etwa Minderwertigkeitskomplexe? Aber nein, er hatte richtiges Fieber. Nicht nur der Kopf, auch seine Hände waren heiß. Die Füße dagegen waren kalt.
Sascha und Andrea mussten erst überredet werden, mit dem Chauffeur nach Sophienlust zu fahren. Sie wollten Nick nicht allein lassen. Aber Denise machte ihnen liebevoll klar, dass sie ihm jetzt gar nicht nützen konnten. Nick war fast sofort eingeschlafen.
Dr. Wolfram kam, wie immer, rasch und zuverlässig. Er untersuchte Nick und machte ein besorgtes Gesicht.
»Das sieht mir ganz nach Scharlach aus«, meinte er. »Wir haben schon ein paar Fälle.«
»Mein Gott«, seufzte Denise, »und ich habe Sascha und Andrea nach Sophienlust fahren lassen.«
»Sie werden sowieso nicht verschont bleiben, wenn die Ansteckung von der Schule ausgeht«, beruhigte sie Dr. Wolfram. »Zum Glück ist Scharlach ja nicht mehr so gefährlich wie früher, und im Grunde ist es besser, wenn sie es alle auf einmal hinter sich bringen und nicht in Abständen. Vorsichtshalber werde ich gleich mal hinüberfahren.« Er machte eine kleine Pause. »Wie ist es mit Ihnen? Hatten Sie schon Scharlach?«
»Ich glaube schon. Ich möchte nur hoffen, dass Petra verschont bleibt, und vor allem muss ich Claudia anrufen, damit sie daheim bleibt. In ihrem Zustand ist es wohl bedenklicher. Übrigens machte Nick da vorhin eine Bemerkung. Sie nehmen es mir doch nicht übel, wenn ich ganz offen mit Ihnen spreche, Dr. Wolfram?«
»Aber gewiss nicht. Nick hat etwas gegen mich in letzter Zeit, nicht wahr? Es ist mir nicht verborgen geblieben.«
»Er findet, dass Sie nicht mehr so nett zu Edith sind wie früher«, gab Denise unumwunden zu.
Leichte Röte stieg in Dr. Wolframs Wangen.
»So ist es nicht, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir einmal darüber sprechen. Es mag sein, dass Sie mehr Einfluss auf Edith haben als ich. Die ganze Geschichte kam durch ein Missverständnis ins Rollen. Edith meinte, ich würde mich für Christel Lufft interessieren.«
»Aber die ist doch inzwischen verheiratet?«, fragte Denise verwundert.
»Verheiratet und glücklich«, erwiderte er. »Das habe ich Edith auch klargemacht. Aber ich bat sie auch, mir etwas über Petras Vater zu erzählen. Ich finde, dass man alles voneinander wissen sollte, wenn man einen Menschen gernhat.«
»Aber sie hat Ihnen nichts erzählt?«, fragte Denise verhalten.
»Doch, das schon. Sie hat viel mitgemacht. Und sie hasst ihn noch so intensiv, dass sie sich nicht davon lösen kann.«
»Ist das nicht verständlich? Er hat sie enttäuscht, hat sie in ihrer Not allein gelassen …«
»Und sie auch noch um ihr Geld gebracht«, warf Dr. Wolfram bitter ein. »Aber was nützt es Edith, dauernd darüber nachzudenken? Sie muss sich davon lösen. Sie muss damit fertig werden, bevor das Kind begreift, dass es einen solchen Vater hat. Ich mag Edith sehr, und ich würde sie auch heiraten.«
Denise sah ihn überrascht an. »Dachten Sie tatsächlich daran?«
»Ich denke noch daran. Ich bin nun eben mal ein seltsamer Knabe, aber ich möchte, dass sie sich von der Vergangenheit vollkommen frei macht, bevor sie ja sagt. Es soll ihr nichts mehr ausmachen, wenn sie ihm eines Tages wieder begegnen sollte.«
»Es braucht Zeit«, meinte Denise. »Sie ist noch jung, und wenn die erste Bindung an einen Mann gleich eine Enttäuschung wird, ist es wohl eine Belastung. Sie sollten sich prüfen, Dr. Wolfram, ob Ihre Gefühle für Edith stark genug sind, um ihr zu helfen, damit fertig zu werden.«
»Wenn sie sich nur helfen ließe«, seufzte er.
Da lag also der Hase im Pfeffer. Denise meinte, dass sie einmal ganz ernsthaft mit Edith sprechen müsse, doch jetzt war dafür keine Zeit. Dominik lag fiebernd im Bett, und sie musste damit rechnen, dass auch die beiden anderen Kinder angesteckt würden.
Was Sascha betraf, konnte Alexander sie beruhigen. Er hatte Scharlach schon im Internat gehabt. Andrea allerdings noch nicht.
*
Auch Ursi, Roli und Toni waren an diesem Tag ziemlich teilnahmslos. Als Sascha und Andrea nach Sopienlust kamen und erzählten, dass Dominik krank geworden sei, setzte Frau Rennert eine skeptische Miene auf. Sie meinte, dass es wohl besser sei, die Theaterprobe ausfallen zu lassen. Aber dagegen protestierten die anderen Kinder, da sie durch das schlechte Wetter schon einige Tage ans Haus gebunden waren und Beschäftigung suchten.
Frau Rennert war froh, als Dr. Wolfram ungerufen kam. Edith weniger. Sie verschwand mit den Kindern gleich im Aufenthaltsraum. Aber nach einer kurzen Unterredung mit Frau Rennert folgte ihnen Dr. Wolfram dorthin.
Ursi, Roli und Toni wurden gleich in die Krankenzimmer im Nebentrakt verfrachtet. Die anderen zeigten noch keine Anzeichen einer beginnenden Krankheit. Sie waren maßlos enttäuscht, dass es mit dem Theaterstück nun vorerst wohl nichts werden würde.
»Ich möchte mir Petra einmal anschauen«, sagte Dr. Wolfram.
Ediths Gesichtsausdruck wurde ängstlich. »Können denn kleine Kinder auch Scharlach bekommen?«, fragte sie besorgt.
»Natürlich können sie das. Bis zum ersten Lebensjahr haben sie noch gewisse Abwehrstoffe, aber Petra ist jetzt schon kein Baby mehr.«
»Aber die Kinder sind doch geimpft«, meinte Edith.
»Was aber nicht besagt, dass sie unbedingt verschont bleiben müssen. Gewiss wird die Krankheit dadurch abgeschwächt, aber bei einer Epidemie nicht verhindert.«
Doch Petra war quietschvergnügt. Sie spielte mit Bauklötzchen und kreischte vor Vergnügen, als Dr. Wolfram kam. Sie war ein besonders reizendes und fröhliches Kind, das man einfach gernhaben musste.
»Dotto«, rief sie ihn, und ein Lächeln flog über sein ernstes Gesicht, als er sie empornahm.
Edith sah ihn nachdenklich an. Immer noch klangen ihr all die eindringlichen Worte, die er ihr vor ein paar Wochen gesagt hatte, in den Ohren. Ja, man müsste alles vergessen können. Aber konnte man es, wenn man das Kind ständig um sich hatte? Musste man sich nicht für das eine oder das andere entscheiden? Den Mann oder das Kind? Nein, von dem Kind wollte sie sich nie wieder trennen. Zu tief hatte sie darunter gelitten, dass es einmal unumgänglich gewesen war. Und von dem Mann? Immer wenn sie ihn sah, wurde ihr schmerzhaft bewusst, wie viel er ihr bedeutete.
»Nun wollte ich Sie einladen, mit mir ein Konzert zu besuchen, aber für die nächsten Wochen werden wir beide wohl vollauf beschäftigt sein«, meinte er. »Mir wäre es schon lieb, wenn wir Petra von den anderen Kindern ganz fernhalten könnten. Sie ist doch recht zart, und ich fürchte, es wird nicht bei den drei Fällen bleiben.«
»Man wird mich brauchen«, meinte Edith. »Ich kann mich nicht nur um mein Kind kümmern. Schließlich verdiene ich mir ja hier unseren Lebensunterhalt.«
Eine Lösung bot sich durch Irene von Wellentin an, die der Arzt zufällig traf, als sie mit Kati auf dem Weg nach Sophienlust war. Kati gehörte zu den Kindern, die schon mal Scharlach gehabt hatten, und Irene von Wellentin erklärte sich sofort bereit, Petra zu sich zu nehmen. Kati war darüber sehr glücklich, denn sie musste ja nun wochenlang auf die Gesellschaft ihrer Spielgefährten verzichten, und da auch die Schule geschlossen wurde, war sie froh, sich mit Petra beschäftigen zu können.
Dr. Wolfram kehrte noch einmal nach Sophienlust zurück und unterbreitete Edith diesen Vorschlag.
»Warum kümmern Sie sich eigentlich noch immer so um mich?«, fragte sie ziemlich aggressiv. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich …«
»Still«, unterbrach er sie energisch. »Ich weiß genau, was Sie mir gesagt haben. Sie brauchen keinen Mann. Sie können gut allein mit Petra leben. Aber warum lehnen Sie auch meine Freundschaft ab, Edith? Meinen Sie, dass man auf die Dauer immer allein mit allem fertig werden kann? Man kann es nicht, glauben Sie mir. Außerdem kümmere ich mich jetzt nicht um Sie, sondern um Petra. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man von einem Krankenbett zum anderen rennen muss, und gar so widerstandsfähig sind Sie auch nicht.«
So siedelte die kleine Petra zu Irene von Wellentin über. Dr. Wolfram brachte sie in die schöne Villa des Fabrikanten, und sie fühlte sich dort auch gleich wohl, wenn sie anfangs auch manchmal nach ihrer Mutter rief.
*
Für die gesunden Kinder war es herrlich, dass sie nicht zur Schule mussten. Für das Personal in Sophienlust war dies eine zusätzliche Belastung.
Man hatte sich alles einteilen müssen. Frau Trenk und Edith betreuten zusammen mit Schwester Resi die kranken Kinder, Wolfgang Rennert und Schwester Gretli die gesunden, die manchmal eine geradezu hektische Betriebsamkeit entwickelten. Alles war anders als sonst.
Nach ein paar Tagen erkrankten auch noch Mario und die kleine Stephanie. Und in Schoeneich hatte sich auch Andrea mit starkem Fieber ins Bett gelegt, während es Dominik schon wieder besser ging. Er jammerte, dass sie nun wohl Dolly, das Hundebaby, nicht rechtzeitig zu den Zwillingen Oliver und Odette bringen könnten.
»Wenn das dein einziger Kummer ist«, tröstete ihn Denise. »Dann kommt sie eben ein paar Wochen später zu ihnen.«
»Aber sie werden denken, dass wir sie ihnen nicht mehr geben wollen«, meinte er kummervoll.
»Ich habe ihnen schon geschrieben, was hier los ist«, stellte Denise beruhigend fest. »Wenn es für dich ein Trost sein sollte, sie sind auch krank. Sie haben die Windpocken.«
»Da tun sie mir aber leid«, versicherte er treuherzig. »Windpocken sind noch schlimmer. Die jucken noch mehr, und man sieht so grässlich aus.«
Der Scharlach zeigte sich im Allgemeinen recht gnädig, nur Roli hatte es arg erwischt. Sie war so geschwächt, dass sie sich nicht einmal aufrichten und malen konnte. Das war für sie das Schlimmste. Und weil Wolfgang Rennert die gesunden Kinder beschäftigen musste, durfte er sie nicht besuchen. Das war fast noch schlimmer, denn mit Wolfgang verstand sie sich besonders gut.
Dr. Wolfram kam jeden Tag nach Sophienlust, manchmal sogar zweimal. Und immer nahm er sich Zeit, ein paar Minuten mit Edith zu sprechen.
Ihr Verhältnis zueinander war in ein eigenartiges Stadium getreten. Sie sprachen weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Er berichtete ihr, dass es Petra gut gehe bei Frau von Wellentin und dass sie ganz gesund sei. Und er stellte immer wieder fest, dass sie nun auch erholungsreif sei.
Das schlechte Wetter hielt an. Es war, als wäre die Sonne auf Reisen gegangen und scheue sich, zurückzukehren. Aber es war November, und von diesem trüben Monat konnte man ohnehin nichts erwarten.
Wieder einmal verließ Dr. Wolfram Sophienlust nach einem Besuch. Diesmal hatte er die tröstliche Zusicherung zurücklassen können, dass nun bald alles wieder seinen normalen Gang gehen würde. Da kam ihm ein Wagen entgegen, an dessen Steuer ein gut aussehender junger Mann saß.
»Das ist doch der Weg nach Sophienlust?«, rief er ihm durch das heruntergekurbelte Fenster zu. Der arrogante Tonfall des Fremden veranlasste Dr. Wolfram nur zu einem kurzen Kopfnicken, aber es beschlich ihn ein ganz unangenehmes Gefühl, das er sich nicht erklären konnte.
Anschließend fuhr er nach Schoeneich, wo er Dominik und Andrea schon wieder ganz mobil antraf, sodass er Sascha endlich wieder zu ihnen lassen konnte, der sich in den letzten Wochen sehr einsam gefühlt hatte.
Dr. Wolfram wusste selbst nicht, wieso er an diesem Tag mit Denise über Edith sprach. Es hatte sich so ergeben.
»Sie ist arg mitgenommen«, stellte er fest, als Denise sich nach ihrem Befinden erkundigte.
»Sie soll einmal ein paar Wochen Urlaub mit der Kleinen machen«, überlegte Denise. »Aber wohin schicken wir sie?«
»Ich glaube nicht, dass ihr das Alleinsein bekommen würde«, gab er zu bedenken. »Sie lebt immer noch in einer panischen Angst, diesem Mann begegnen zu können. Auf Sophienlust fühlt sie sich sicher. Aber wenn er sie finden will, wird er sie auch dort finden.«
»Malen Sie den Teufel nicht an die Wand«, seufzte Denise.
»Das sollte ihr doch wohl erspart bleiben.«
Unwillkürlich musste er wieder an den Fremden mit der arroganten Stimme denken, und wenn er Zeit gehabt hätte, wäre er am liebsten noch einmal nach Sophienlust gefahren und hätte sich erkundigt, wer das gewesen war. Aber in seiner Praxis warteten bereits die Patienten, und seine junge Sprechstundenhilfe, die sich noch nicht ganz eingearbeitet hatte, atmete erleichtert auf, als er endlich eintraf.
*
Frau Rennert saß über ihren Abrechnungen, als es an der Tür klopfte. Sie maß den Fremden, der sofort ihre Antipathie erregte, mit einem kritischen Blick.
»Sie wünschen?«, fragte sie kühl.
»Ich möchte Fräulein Gerlach sprechen.«
»Möchten Sie sich nicht erst einmal vorstellen?«, fragte Frau Rennert im gleichen überheblichen Ton zurück. »In diesem Hause ist das üblich.«
Seine Lippen verzogen sich. »Wolff«, stellte er sich vor. »Fräulein Gerlach kennt mich.«
Frau Rennert war eine gute Menschenkennerin, aber mit Edith Gerlach, diesem stillen Mädchen, ließ sich der Fremde nicht in Einklang bringen. Aushorchen konnte sie ihn allerdings auch nicht.
»Ich werde Fräulein Gerlach von Ihrer Anwesenheit unterrichten lassen«, sagte sie zurückhaltend.
Doch das brauchte sie nicht zu tun, denn Edith erschien gerade, als sie die Tür öffnete, und Frau Rennert konnte beobachten, dass sie totenblass wurde, als sie den jungen Mann sah.
»Herr Wolff möchte Sie sprechen, Edith«, sagte Frau Rennert betont. »Wenn Ihnen daran gelegen ist, können Sie sich hier unterhalten. Ich muss etwas mit Magda besprechen.«
Edith nickte zögernd. Sie sah hilflos und verloren aus, da sie aber nichts sagte, konnte Frau Rennert ihr schlecht zu Hilfe kommen.
Leise schloss sie die Tür hinter sich und fühlte sich versucht, entgegen ihren Grundsätzen, ein wenig zu lauschen. Aber dann schalt sie sich selbst aus und ging schnell zur Küche. Auf dem Weg dahin gab sie aber noch rasch ihrem Sohn Bescheid, damit er ein Auge auf das Büro werfen und zur Stelle sein konnte, falls Edith Hilfe benötigen sollte.
Diese sah den Besucher jetzt mit starren Augen an. »Du wagst es, hierherzukommen?«, stieß sie hervor.
»Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden«, erwiderte er in vorwurfsvollem Tonfall.
»Vor zwei Jahren hättest du mich sehr schnell finden können. Du hattest meine Adresse. Ich hatte sie dir geschrieben«, murmelte sie tonlos.
»Du hattest mir geschrieben?«, fragte er gedehnt. »Ich habe keinen Brief von dir bekommen.«
Er sagte es sehr überzeugend, aber sie glaubte ihm nicht. Zu oft hatte er sie belogen.
»Ich habe dich gesucht«, fuhr er fort. »Bedeutet dir das nichts? Was ist nun mit dem Kind? Hast du es wegbringen lassen?«
»Was geht es dich an?«, fragte sie hart und war froh, dass Petra nicht im Hause war.
Seine Miene war von scheinheiliger Freundlichkeit. »Edith, ich habe dir damals klarzumachen versucht, dass wir unter solchen Voraussetzungen nicht heiraten können. Ich war mit dem Studium nicht fertig.«
»Bist du es jetzt?«, fragte sie ironisch und wunderte sich, wie ruhig sie plötzlich wurde. Sie musste an Dr. Wolfram denken und an alles, was er ihr so eindringlich gesagt hatte.
Er wurde unsicher. »Nein, ich habe mein Studium abgebrochen. Deinetwegen habe ich mich mit meinen Eltern überworfen. Sie waren sehr böse, weil ich das Mädchen nicht heiraten wollte, das sie für mich bestimmt hatten. Deinetwegen habe ich mich in eine Klemme gebracht, aus der ich kaum noch einen Ausweg weiß.«
»Also, das heißt mit wenigen Worten, dass du wieder einmal Geld brauchst«, erklärte sie, »und weil du keine Dümmere findest, komme ich dir gerade wieder recht.«
»Du bist ungerecht«, warf er ihr vor. »Was meinst du, was es für Schwierigkeiten machte, deinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Meinst du, ich würde dafür so viel Zeit vergeuden, wenn du mir nichts bedeuten würdest?«
»Wie gut du lügen kannst«, stieß sie hervor. »Früher habe ich dir alles geglaubt. Aber das ist vorbei. Ein für alle Mal. Außerdem gibt es bei mir auch nichts zu holen.«
Er kniff die Augen zusammen. »Nun, das hier sieht doch alles recht fürstlich aus«, bemerkte er anzüglich. »Du hast dich in ein hübsches Nest gesetzt. Du hast dich gemausert, Edith, das muss ich sagen.«
»Geh«, stieß sie zornig hervor. »Bring mich nicht erneut in Schwierigkeiten. Ich habe deinetwegen schon genug gehabt.«
So schnell gab er nicht auf. »Hör mich einmal ruhig an«, begann er wie früher. »Ja, meine Eltern hätten gegen eine Heirat jetzt nichts mehr einzuwenden. Sie haben in Erfahrung gebracht, dass du ein Kind bekommen hast. Mein Vater hat zufällig deinen Vater kennengelernt, und sie haben darüber gesprochen.«
»Das ist es also«, sagte sie. »Dein langes Suchen nach mir – deine dummen Lügen – Dieter, ich habe dich durchschaut. Es ist zwecklos, dass du weiterhin auf mich einredest.«
»Wo ist das Kind?«, fragte er gereizt. »Du kannst mir nicht verweigern, mein Kind zu sehen.«
»Doch, das kann ich. Es ist mein Kind. Allein mein Kind. Sein Vater ist unbekannt, verstehst du? Er hat kein Anrecht, nicht das geringste. Und das ist mein letztes Wort. Willst du, dass ich dich aus dem Hause weisen lasse? Das geht hier sehr rasch.«
Eine jähzornige Falte erschien auf seiner Stirn. »So lasse ich mich nicht abspeisen«, versuchte er es noch einmal. »Du wirst dir alles in Ruhe überlegen, und ich werde wiederkommen.«
»Ich werde für dich nicht mehr zu sprechen sein«, schleuderte sie ihm ins Gesicht.
»Das werden wir ja sehen.«
Die Tür tat sich auf. Wolfgang Rennert schaute herein. »Sie werden gebraucht, Fräulein Edith«, sagte er ruhig.
Dieter Wolff maß ihn mit einem zornigen Blick. »Dein neuer Freund?«, fragte er zynisch.
»Natürlich bin ich ihr Freund«, erklärte Wolfgang Rennert fest. »Edith hat hier nur Freunde.« Sein Tonfall war drohend, und Edith war ganz verblüfft, denn so hatte sie Wolfgang Rennert noch nie sprechen hören.
»Vielen Dank«, sagte sie leise, als Dieter Wolff gegangen war. »Sie kamen im richtigen Augenblick.«
»Das dachte ich mir«, erwiderte er lächelnd. »Wenn Sie jemanden brauchen, Edith, wir sind zur Stelle.«
Es war ein beruhigendes Gefühl, denn Edith ahnte, dass dies nicht die letzte Begegnung mit Dieter Wolff sein würde. Wieder musste sie an Dr. Wolfram denken. Nein, sie empfand keinen Hass mehr. Nur Widerwillen und Scham, dass sie einem solchen Mann einmal vertraut hatte.
Sie glaubte ihm kein Wort mehr. Zu oft hatte er sie belogen. Sie glaubte auch nicht, dass ihr Vater mit seinem Vater gesprochen habe. Wie immer er auch ihren Aufenthaltsort in Erfahrung gebracht hatte, dass ihre Eltern überhaupt noch ihren Namen erwähnten, konnte sie nicht glauben. Aber darin sollte sie sich getäuscht haben.
*
Ein paar Tage danach erhielt Edith einen Brief, auf dem sie sofort die Handschrift ihres Vaters erkannte, die überaus sauber und korrekt war, so wie er selbst, der zuverlässige Beamte, für den es eine Schande bedeutete, dass seine Tochter ein uneheliches Kind bekommen hatte.
Ihr Herz zog sich zusammen, als sie den Brief an sich nahm. Lange konnte sie sich nicht entschließen, ihn zu lesen. Erst am Abend, als alles schlief, nahm sie allen Mut zusammen und öffnete den Brief.
Liebe Edith,
wir haben schon fast zwei Jahre nichts mehr von Dir gehört, schrieb ihr Vater.
Edith begann nachzudenken. Ja, fast zwei Jahre war es her, dass ihr Kind auf die Welt gekommen war. Damals hatte sie sich noch einmal ein Herz gefasst und an ihre Eltern geschrieben. Doch die Antwort ihres Vaters war so ausgefallen, wie sie es eigentlich erwartet hatte.
»Wie man sich bettet, so liegt man«, hatte er ihr mit nüchternen Worten mitgeteilt.
Jetzt schrieb er anders. Ich lernte neulich durch Zufall Herrn Direktor Wolff kennen. Wir kamen auf Dich zu sprechen, und er bedauerte sehr, nicht schon früher meine Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich war in meiner Eigenschaft als Steuerprüfer bei ihm, wie ich Dir nicht verheimlichen möchte. Du weißt, dass ich zeit meines Lebens ein korrekter Mann war und bin. In dieser Eigenschaft lernte er mich wohl nun auch schätzen und gab auch zu, dass er einige Sorgen mit seinem Sohn hätte, der seit einiger Zeit eine Stellung in seiner Abteilung bekleidet.
Wir einigten uns dahingehend, dass dieses unglückselige Ereignis aus der Welt geschafft werden müsse, und er erklärte sich auch damit einverstanden, dass sein Sohn Dich heiratet.
Wie ich nun hörte, machte Dieter Wolff auch den Versuch, sich mit Dir zu einigen, wurde von Dir aber unverständlicherweise abgewiesen. Ich möchte Dir sagen, wie sehr ich das bedauere, denn Du solltest doch an deinen Ruf denken und daran, dass Dein Kind einen ehrlichen Namen bekommt.
Ediths Augen füllten sich mit Tränen. Armer, verblendeter Vater, dachte sie. Ist unser Name nicht ehrlich? Wäre es dir wirklich recht, dass ich einen solchen Lumpen heirate, nur damit ich nicht als uneheliche Mutter gelte? Sie konnte das nicht verstehen, und sie suchte auch nach Beweggründen, die Dieter Wolffs Vater zu einem so plötzlichen Meinungsumschwung veranlasst haben könnten.
Als Steuerprüfer war ihr Vater bei ihm gewesen. Lag da der Haken? Brauchte man seine Nachsicht, sein Wohlwollen? War man dafür sogar bereit, Zugeständnisse zu machen, die man sonst nie gemacht hätte?
Früher hätte sie dergleichen nie gedacht, aber die schlimme Zeit, die sie erlebt hatte, hatte sie misstrauisch gemacht. Wie glücklich wäre sie gewesen, wenn sich ihre Eltern vor einigen Jahren besonnen und ihr die Hand gereicht hätten, aber ihnen ging es wohl nur darum, dass sie den Vater dieses Kindes heiratete, selbst wenn es ihr Unglück bedeutete. Ihr wurde ganz übel bei dem Gedanken, und zornig zerknüllte sie den Brief. Aber dann warf sie ihn doch nicht weg, wie sie es zunächst vorgehabt hatte.
*
Es war gut, dass Denise am nächsten Tag nach Sophienlust kam, um wieder einmal nach dem Rechten zu sehen, und es war auch gut, dass sie Gelegenheit hatte, mit Edith zu sprechen.
»Es war alles sehr anstrengend«, meinte Denise behutsam, als sie Ediths blasses Gesicht sah.
»Das ist es nicht«, erwiderte Edith niedergeschlagen.
»Private Sorgen?«, tastete sich Denise vor.
Edith nickte. »Ich möchte Sie nicht belästigen, aber …« Sie geriet ins Stocken.
»Sie belästigen mich doch nicht. Schütten Sie Ihr Herz aus, Edith. Wir sind doch immer eine große Familie gewesen, daran soll sich nichts ändern.«
»Ich habe von meinem Vater einen Brief bekommen. Wenn ich Ihnen den zeigen dürfte?«
»Freuen Sie sich nicht, dass Ihr Vater Ihnen geschrieben hat?«
»Soll ich mich darüber wirklich freuen?«, fragte Edith zurück und reichte ihr den zerknitterten Brief.
Denise hob leicht die Augenbrauen, als sie ihn gelesen hatte. Das war allerdings kein Anlass zur Freude. Erst recht nicht für ein so sensibles Geschöpf, wie Edith es war. Es war sogar sehr hart, wenn man es als Unbeteiligte las.
»Dieser Herr Wolff war hier«, sagte Edith. »Hat es Ihnen Frau Rennert nicht erzählt?«
Denise schüttelte den Kopf. »Frau Rennert ist keine Klatschbase, Edith. Sie wollte es sicher Ihnen selbst überlassen, darüber zu sprechen oder darüber zu schweigen.« Und nach kurzem Zögern fragte sie: »Und wie wollen Sie sich nun verhalten?«
»Ich will von diesem Mann nichts mehr wissen. Das Ansinnen empört mich. Soll ich meinem Vater überhaupt antworten?«
»Das müssen Sie selbst wissen«, erwiderte Denise, »aber ich würde es an Ihrer Stelle tun, und zwar klar und deutlich. Ich würde mir den Weg nicht verbauen, aber wenn das Interesse Ihres Vaters nur dahin geht, Sie verheiratet zu wissen, würde ich schon die Konsequenzen ziehen. Mittlerweile sind Sie ja mündig. Und Sie sind nicht allein, Edith. Ich hoffe, dass wir Ihnen wenigstens dieses Gefühl vermitteln konnten.«
»Ich möchte hierbleiben und nie mehr etwas von früher hören«, stöhnte Edith auf.
»Aber Sie müssen mit den Tatsachen fertig werden. Sie müssen auch einen Schlussstrich ziehen können, damit Sie Ihrem Kind eine fröhliche Mutter sein können.«
»Das hat Dr. Wolfram auch schon einmal zu mir gesagt«, erwiderte Edith leise.
»Er meint es auch so. Nicht alle Männer sind gleich, Edith. Es gibt solche und solche. Es ist sehr schlimm, wenn man an den Verkehrten gerät, wenn man jung und unerfahren ist. Aber es braucht nicht ein Hemmschuh für das ganze Leben zu sein. Man schleppt manchmal zu lange einen Ballast mit sich herum, den man viel früher hätte abwerfen können. Man muss nur überzeugt sein, dass man damit fertig geworden ist, und das sollten Sie eigentlich. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen dieser Mann noch bedeutet.«
»Das ist es eben. Er bedeutet mir gar nichts mehr. Ich kann nicht begreifen, dass ich einmal so dumm war.«
»Nicht dumm«, lenkte Denise ein, »nur unerfahren. Und wenn man unerfahren ist, fällt man halt auf schöne Worte herein.«
»Und lässt sich ausnehmen«, sagte Edith bitter. »Er bekam doch genügend Geld, aber es reichte nie. Dabei gingen wir nie aus. Wahrscheinlich hat er das Geld, das er mir abnahm, mit anderen Frauen durchgebracht, und ich dumme Gans habe immer wieder gegeben.«
»Aber Sie haben daraus gelernt, und nun machen Sie am besten Schluss mit der Vergangenheit. Endgültig, Edith. Wenn Ihr Vater dafür kein Verständnis hat, ist er nur zu bedauern. Aber sich selbst dürfen Sie jetzt nicht mehr bedauern. Sie haben ein süßes Kind, eine Heimat und Menschen, die Ihre Freunde sind und Ihnen immer helfen werden. Sie brauchen keine Angst zu haben und müssen sich nicht verkriechen. Wir wissen jetzt alles von Ihnen.«
»Und Sie verdammen mich nicht?«
»Dummes Mädchen«, lächelte Denise, »das sollten Sie eigentlich längst wissen. Wir haben Sie gern, aber das können wir Ihnen nicht jeden Tag erzählen. Ihr Schicksal ist doch kein Einzelschicksal. Denken Sie doch einmal darüber nach, wie vielen Mädchen das Gleiche geschieht. Manche werden damit fertig, andere nicht, aber ich möchte, dass Sie zu denen gehören, die damit fertig werden, Edith.«
»Ich möchte es auch«, kam die leise Erwiderung.
»Nun, dann beweisen Sie es. Sich selbst, den anderen und vor allem Ihrem Kind, das Sie braucht.«
»Danke, Frau Schoenecker«, sagte Edith leise.
»Sie wird den Schatten überspringen«, dachte Denise. »Sie wird es schaffen.«
*
Der Steueramtmann Wilhelm Gerlach rückte seine Brille zurecht. Ein gereiztes Knurren ging seiner Ansprache voran, die er seiner verschüchterten Frau halten wollte.
»Typisch deine Tochter, Irmgard«, zischte er. »Da wird ihr die einmalige Chance geboten, doch noch zu heiraten, und sie lehnt es strikt ab. Ich finde ihren Brief empörend.«
Irmgard Gerlach hatte in ihrer Ehe zu schweigen gelernt, aber heute konnte sie das nicht. Ihr hatte es imponiert, was Edith geschrieben hatte.
»Ich weiß nicht, Wilhelm, ob diese Ehe eine so einmalige Chance wäre«, sagte sie entschlossen. »Dieser junge Wolff hat es doch zu nichts gebracht. Sein Vater hat ihn in seiner Firma untergebracht, als er sein Studium hat abbrechen müssen. Und wie ein Kavalier hat er sich damals auch nicht benommen. Jetzt sind zwei Jahre vergangen, und nur, weil Herr Direktor Wolff es verstanden hat, dir Honig um den Mund zu schmieren, machst du eine Kehrtwendung. Für mich ist es klar, dass er sich davon nur einen Vorteil verspricht. Sind seine Bücher eigentlich in Ordnung?«
Wilhelm Gerlach lief rot an. »Wie redest du mit mir?«, empörte er sich. »Ich will für Edith das Beste, und du unterstellst mir Dinge, die ungeheuerlich sind. Ich war immer korrekt.«
»Ja, du warst immer korrekt, aber bist du es augenblicklich auch? Schmeichelt es deiner Eitelkeit nicht ein bisschen zu sehr, dass Herr Direktor Wolff, der doch bisher nichts von unserer Tochter wissen wollte, dich in sein Haus einlädt und dich fürstlich bewirtet?«
»Du bist nur gekränkt, weil man dich nicht auch eingeladen hat«, brauste er auf.
»Ich verzichte dankend darauf. Dieter Wolff hat unsere Tochter verführt. Edith war immer ein anständiges Mädchen, und wie du aus ihrem Brief entnehmen kannst, hat er sie auch noch schamlos ausgenutzt.«
»Das eben kann ich nicht glauben«, knurrte er. »Sie leben in den besten Verhältnissen. Sie haben ein schönes Haus und Geld genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zutrifft, was Edith da schreibt.«
Sie richtete sich auf. »Ihm glaubst du, aber unserer Tochter nicht«, stieß sie hervor. »Ich habe dir immer nachgegeben, Wilhelm. Ich habe auch damals geschwiegen um des lieben Frieden willen, ja, ich habe Edith auch nicht verstanden. Aber heute frage ich mich, ob wir nicht auch schuldig geworden sind, weil das Kind kein Vertrauen zu uns hatte.«
»Sie rückte erst mit der Wahrheit heraus, als sie bereits im Schlamassel drinsteckte. So ist es immer bei den Mädchen«, sagte er zornig.
»Das sagst du jetzt. Und was sagtest du damals? Dieser leichtsinnige Fatzke, dem man nicht über den Weg trauen könnte! Sie war noch viel zu jung, um das unterscheiden zu können. Damals hättest du seinen Vater aufsuchen sollen, dann wäre manches Unheil verhindert worden.«
»Ich hatte keinen Grund dazu. Sie erklärte doch immer großspurig, dass er sie heiraten wolle. Ich habe gleich gewusst, dass es nicht gut gehen würde.«
»Du widersprichst dir selbst. Jetzt will er sie angeblich heiraten. Wie soll ich das verstehen? Damals war sie seinen Eltern nicht gut genug. Damals warst du ja auch erst Oberinspektor und nicht Steuerprüfer.«
Sein Gesicht färbte sich blaurot. Mit einem lauten Krachen flog gleich darauf die Tür ins Schloss und dann auch die Haustür. Irmgard Gerlach war allein. Sie war keine Frau impulsiver Entschlüsse, doch diesmal traf sie einen Entschluss, ohne an sich selbst, ihre Ehe und ihren Mann zu denken. Sie wollte ihre Tochter persönlich sprechen. Auge in Auge mit ihr wollte sie den Dingen auf den Grund gehen.
*
»Mir brauchst du nichts vorzumachen, Dieter«, sagte fast gleichzeitig Ferdinand Wolff zu seinem Sohn. »Wenn wir diesen Gerlach nicht auf unsere Seite bringen, sitzt du in einer bösen Patsche, und ich mit. Ich habe nicht die geringste Lust, meine Stellung nun auch noch aufs Spiel zu setzen, nach allem, was ich bereits für dich getan habe. Du musst Edith heiraten. Dem Mann seiner Tochter wird Herr Gerlach den Weg nicht verbauen wollen. Sein Name würde in diese Steuerhinterziehung mit hineingezogen, und das würde er nicht überleben. Er ist wirklich ein korrekter Mann, und wenn mir das Wasser jetzt nicht selbst bis zum Halse stünde, hielte ich mich heraus. Zum Teufel, was hast du mir alles eingebrockt! Ich dachte, du würdest zur Vernunft kommen, aber jetzt muss ich bedauern, dass ich dir noch mal eine Chance gegeben habe.«
»Überrede du Edith doch«, erklärte Dieter Wolff frivol. »Aber vielleicht gibt es doch noch eine bessere Lösung. Die Tochter des Finanzpräsidenten soll ein sehr ansehnliches Mädchen sein …«
»Hast du denn gar keine Moral?«, ächzte Ferdinand Wolff.
»Was heißt Moral? Edith hat mich abgeschüttelt wie ein Stück Dreck. Soll ich mir so etwas bieten lassen. Ich, dein Sohn?«
Was ist er anderes als ein Stück Dreck, dachte Ferdinand Wolff in jäher Verzweiflung. Alles hatte er versucht, um seinen einzigen Sohn auf eine solide Bahn zu bringen, aber immer wieder war er enttäuscht worden. Und welche Pläne hatte er mit ihm gehabt, bis er damals gekommen war und gesagt hatte, dass Edith Gerlach ein Kind erwarte.
Nein, Dieter hatte nicht die Absicht gehabt, sie zu heiraten. Er hatte nur Angst gehabt, dass sie sich an seine Eltern wenden könnte, deshalb hatte er diese in die Sache eingeweiht.
Aber Edith Gerlach hatte nichts von sich hören lassen, und Dieter hatte schließlich frech erklärt, dass dieses Kind wohl gar nicht von ihm sei. Dann hatte er sich mit einer Fabrikantentochter verlobt, die die Verlobung aber schon nach vier Wochen wieder gelöst hatte, weil sie ihn rasch durchschaut hatte.
»Du bist doch ein vertrauenserweckender Mann, Vater«, stellte Dieter Wolff jetzt mit einem arroganten Lächeln fest. »Wahrscheinlich hat Edith mir nicht geglaubt, dass ihr nun mit einer Heirat einverstanden seid. Wenn du es ihr aber selbst sagen würdest, würde sie sicher zugänglicher sein. Sie ist eine Mimose, und ich habe halt nicht das Talent, den Frauen schönzutun. Sie haben es mir immer leicht gemacht.«
»Aber am Ende wollte keine etwas von dir wissen«, schleuderte der Vater seinem Sohn ins Gesicht. »Unser guter Name steht auf dem Spiel, Dieter.«
»Und dafür wirst du sicher manches tun, alter Herr«, erwiderte dieser zynisch.
Einen Augenblick hatte es den Anschein, als wollte sein Vater ihm ins Gesicht schlagen, aber dann wandte sich Ferdinand Wolff ab.
»Geh«, sagte er heiser. »Geh, bevor ich mich vergesse.«
*
»Dotto, Dotto«, freute sich die kleine Petra, als Dr. Wolfram in die Villa Wellentin kam, um nach den Kindern zu sehen. Sie waren beide in bester Verfassung, aber Irene von Wellentin bestand darauf, dass der Arzt jeden zweiten Tag nach ihnen schaute.
»Petra lieb«, jauchzte die Kleine, als er sie auf den Arm nahm.
»Petra ist sehr lieb«, bestätigte er.
»Sie wird uns fehlen«, meinte Irene von Wellentin. »Kati hat sich schon zu einem perfekten Kindermädchen entwickelt.«
Kati strahlte. »Kleine Kinder sind süß«, stellte sie fest. »Mutti hatte auch viel Spaß mit Petra.« Nicht eine Spur von Eifersucht war ihr anzumerken. Sie war ein liebes, dankbares Kind, überglücklich, eine so gütige Mutter bekommen zu haben. Nie mehr würde jene fremde Frau kommen dürfen, die behauptet hatte, ihre Mutter zu sein, da war sich Kati ganz sicher.
Dr. Wolfram hatte allerdings Bedenken, denn Hanna Ebert tauchte von Zeit zu Zeit immer wieder in der Stadt auf. Doch damit wollte er Irene von Wellentin nicht beunruhigen.
»Nun sind alle Kinder wieder gesund, und Kati kann wieder nach Sophienlust fahren«, meinte er. »Da sieht sie Petra ja dann jeden Tag. Und Sie auch, gnädige Frau.«
Irene von Wellentin lächelte ein wenig wehmütig. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so zur Mutter eigne«, meinte sie. »Ich hätte am liebsten immer mehrere Kinder um mich. Und Kati auch.«
»Sie haben ja ein ganzes Heim so nahe«, erwiderte Dr. Wolfram verständnisvoll. »Ja, es ist eine schöne Aufgabe.«
»Besonders, wenn man älter wird und begreift, dass alles Glück aus Kinderherzen kommt.«
Wirklich alles Glück?, fragte er sich. Vielleicht, wenn man älter wurde, aber wenn man jung und voller Wünsche war, suchte man das Glück doch zuerst in einem anderen Menschen, der das eigene Ich ergänzte. Er wusste jetzt, wie sehr er sich dies wünschte, nachdem er Edith in den letzten Wochen täglich gesehen hatte.
Etwas war anders geworden in diesen Wochen. Seine stille, unerfüllte Liebe zu Claudia hatte an Bedeutung verloren, je mehr er sich mit Ediths Schicksal beschäftigte. Ja, man musste sich mit den Tatsachen abfinden. Claudia war eine glückliche Frau Brachmann geworden, die sich auf ihr erstes Kindchen freute. Und wie sie sich freute. Von Tag zu Tag wurde sie hübscher. Er traf sie oft, doch jetzt schmerzte es nicht mehr, in ihr reizvolles Gesicht zu blicken, in die strahlenden Augen, in denen sich die Liebe zu einem anderen Mann widerspiegelte.
»Dotto dableiben«, verlangte Petra, als er sich verabschiedete.
»Heute kommst du ja zu deiner Mutti, Schätzchen«, erwiderte er zärtlich.
Irene von Wellentin sah ihn verwundert an, aber sie sagte nichts. Er ist doch noch jung, dachte sie. Kann man da schon über solche Probleme hinwegsehen, die ein fremdes Kind mit sich bringt? Aber schuf man sich die Probleme nicht auch selbst?
*
»Edith!« Ganz plötzlich standen sie sich gegenüber. Dr. Bert Wolfram und die junge Frau, die seine Gedanken ständig umkreisten. Er war heimgefahren, um nachzusehen, ob er noch Krankenbesuche machen müsse. Seine Sprechstundenhilfe Ilse notierte stets alles, bevor sie heimging.
»Ilse ist gerade gegangen«, flüsterte Edith. »Ich wollte auf Sie warten.«
Sie zitterte am ganzen Körper. Ihre Hände, die er mit warmem Griff umfing, waren eiskalt.
»Was ist denn, Mädchen?«, fragte er besorgt.
»Meine Mutter ist nach Sophienlust gekommen«, flüsterte sie. »Ich bin davongelaufen.«
Sollte er ihr wieder einen Vortrag halten? Nein, er tat etwas Besseres. Er nahm sie in die Arme und küsste ihre bangen Augen.
»Wie lange willst du noch davonlaufen, Kleines?«, fragte er leise. »Aber diesmal bist du wenigstens zu mir gekommen.«
Sie schluchzte leise auf. »Ach, Bert, es ist alles so schwierig. Wenn ich darüber nachdenke, fühlte ich mich stark, und wenn es an mich herankommt, verlässt mich aller Mut.«
»Wird es besser sein, wenn du weißt, dass ich bei dir bin?«, fragte er. »Immer, wenn du mich brauchst. Ich habe so klug dahergeredet, Liebes, aber ich habe nicht gedacht, dass man manche Dinge zu zweit besser bewältigt. Wir werden heiraten und dann einen dicken Strich unter die Vergangenheit ziehen. Diese Reihenfolge ist wohl besser, als erst den Strich zu ziehen.«
»Den Strich habe ich doch schon gezogen«, flüsterte sie, »aber jetzt tauchen plötzlich alle aus der Vergangenheit auf. Erst er, dann Vater mit einem Brief und nun Mutter. Sie haben sich doch die ganze Zeit nicht um mich gekümmert.«
»Nun erzählst du mir alles mal hübsch der Reihe nach, Edith«, meinte er behutsam. »Mir, deinem zukünftigen Mann. Aber zuerst möchte ich wissen, ob du mich überhaupt heiraten willst.«
»Willst du mich denn?«, fragte sie leise. »Mich und Petra?«
Er lächelte. »Ich habe dir soeben einen Heiratsantrag gemacht und selbstverständlich schließt er auch Petra ein, wenn du es noch mal bestätigt haben willst. Und jetzt will ich eine klare Antwort.«
»Ich liebe dich«, sagte sie bebend. »Gleich vom ersten Augenblick an habe ich gewusst, dass du der einzige Mann bist, den ich lieben kann.«
»Du hast es meisterhaft verstanden, mir das zu verbergen«, brummte er.
»Du hattest nur Mitleid mit mir.«
»So hast du es gesehen. Nein, Edith, so war es nicht. Ich wusste nur nicht, ob ich dich mehr lieben könnte als Claudia. Aber jetzt weiß ich es, und nun weißt du es auch.«
Sanft küsste er ihren bebenden Mund, um sie dann ganz fest in seine Arme zu nehmen. Sie fühlte, dass er es ehrlich meinte, und plötzlich war alles ausgelöscht, was sie quälte. Zärtlichkeit, Sehnsucht und Glück berauschten sie. Ja, mit ihm war alles leichter. Seine Kraft gab ihr Kraft und Mut – viel Mut.
*
Gemeinsam holten sie Petra ab und fuhren dann nach Sophienlust, wo Frau Gerlach noch immer wartete.
Frau Rennert hatte inzwischen lange mit ihr gesprochen, aber als Dr. Wolframs Wagen vorfuhr, war sie aufgestanden und hatte gesagt: »Ihre Tochter kommt, Frau Gerlach.«
Irmgard Gerlach stand auf. Vom Fenster aus sah sie, wie der Mann sich von Edith verabschiedete, wie er dem Kind über das Köpfchen strich und Edith dann kurz über die Wange. So viel Liebe und Güte drückte diese kleine Geste aus, dass sie ein tiefes Schamgefühl überkam.
Langsam ging sie Edith entgegen. Ihre Lippen zitterten. Sie brachte kein Wort hervor.
»Guten Tag, Mutter«, sagte Edith ruhig. »Du willst mit mir sprechen? Ich bringe nur Petra zu Bett.«
Hilflos ließ Irmgard Gerlach die Arme sinken. »Darf ich sie mir nicht erst einmal ansehen?«, fragte sie mit klangloser Stimme.
»Sie ist müde, da ist sie manchmal launisch«, erwiderte Edith ruhig.
»Dotto«, murmelte Petra schläfrig. »Dotto dableiben.«
»Dotto kommt morgen wieder«, meinte Edith tröstend. »Sie meint Dr. Wolfram. Sie hängt sehr an ihm«, erklärte sie ihrer Mutter.
»Soll ich sie Ihnen abnehmen, Edith?«, fragte Frau Rennert freundlich.
Edith schüttelte den Kopf. »Ich bringe sie schon selbst zu Bett. Meine Mutter kann mich ja begleiten.«
Wie ruhig sie ist, dachte Frau Rennert. Völlig verwandelt. War das Dr. Wolframs Werk?
»Du hast es sehr schön hier«, sagte Frau Gerlach, als sie mit Edith in der reizend eingerichteten kleinen Wohnung angekommen war, die im Seitenflügel des Gutshauses lag.
»Ja, es ist sehr schön, und ich bin sehr glücklich«, erwiderte Edith. »Und ich werde mir dieses Glück um keinen Preis zerstören lassen.«
»Deswegen bin ich nicht gekommen«, ließ Frau Gerlach sich leise vernehmen. Mit verschleierten Augen blickte sie auf das Kind.
»Sie ist schon fast zwei Jahre alt«, murmelte sie.
»Neunzehn Monate«, erwiderte Edith.
»Bist du ebenso lange hier?«
»Nein.«
»Was hast du vorher getan?«
»Müssen wir darüber sprechen, Mutter? Ich bin eben dabei, es ganz aus meiner Erinnerung zu streichen. Dr. Wolfram und ich werden heiraten.«
»Er will dich heiraten?«, fragte Frau Gerlach atemlos.
»Ja, stell dir vor, er will mich heiraten. Ein Akademiker heiratet eine Frau mit einem unehelichen Kind. Und er liebt mich sogar und das Kind auch.«
Frau Gerlach ließ den Kopf sinken. »Ich kann deine Bitterkeit mir gegenüber verstehen, Edith«, sagte sie befangen. »Ich bin auch nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich Vaters Einstellung nicht billige. Ich wollte es dir Auge in Auge sagen, damit du nicht denkst, dass Papier geduldig ist. Wenn ich dir sage, dass mir alles leidtut …«
»Das brauchst du nicht, Mutter. Ich bin darüber hinweg. Du standest zwischen Vater und mir und hast dich für ihn und den guten Ruf entschieden. Es ist verständlich, denn du musst mit ihm leben.«
»Kannst du mir verzeihen?«
»Verzeihen? Ich verstehe dich doch. Das ist viel besser. Bert hat mich gelehrt, dass Verstehen viel mehr bedeutet als alles andere. Er hat mich auch die Männer wieder achten gelehrt, wenigstens die Männer, die etwas taugen. Dieter Wolff taugt nichts, aber das wird Petra nie erfahren. Sie wird einen Vater bekommen, den sie lieben kann und der ihr Vorbild sein wird. Um es ganz klar auszudrücken, Mutter, ich bin bereit zu leugnen, dass Dieter Wolff der Vater meines Kindes ist. Der Name des Vaters: Unbekannt! So steht es in den Papieren. Und schon bald wird darin stehen: Dr. Bert Wolfram.«
Petra war schon eingeschlafen. Frau Gerlach betrachtete das süße Gesichtchen.
»Ich bin froh für dich, dass alles so gekommen ist«, flüsterte sie. »Ich weiß, dass wir uns deine Zuneigung verspielt haben. Man kann nichts ungeschehen machen.«
»Nein, Mutter, man kann nichts ungeschehen machen«, erwiderte Edith ernst. »Aber die Zeit ist gnädig. Man vergisst, was man vergessen will. Ich danke dir für deinen guten Willen, denn ich weiß, was es für dich bedeutet, dich gegen deinen Mann zu behaupten. Wenn du deswegen Schwierigkeiten mit ihm bekommen solltest, weißt du, wohin du kommen kannst. Sophienlust hat für viele bedrängte Seelen Platz.« Sie machte eine kleine Pause. »Es ist schon spät. Du kannst heute nicht mehr zurückfahren. Wenn du willst, kannst du gern hierbleiben.«
*
Mit wuchtigen Schritten lief Wilhelm Gerlach durch das Haus, das so verlassen wirkte. Das wagte seine Frau ihm anzutun! Sie hinterließ ihm einen kleinen Zettel mit ein paar Zeilen und verschwand einfach.
Fast fünfundzwanzig Jahre waren sie verheiratet. Tag für Tag – er kannte es nicht anders – hatte sie ihn erwartet. Sein Essen stand bereit. Sie hatte ihn umsorgt, ihm niemals widersprochen. Und nun das!
»Ich fahre zu Edith!« Wie eine Drohung sprangen ihm die Worte ins Gesicht.
Es dauerte mehr als eine Stunde, bis er einen klaren Gedanken gefasst hatte, dann rief er Herrn Direktor Wolff an.
»Bedauere, der Herr Direktor ist verreist«, wurde ihm erwidert. Auch das noch. Wie hatte sein Vorgesetzter heute zu ihm gesagt? Er solle besonders sorgsam die Buchführung in dieser Abteilung in Augenschein nehmen. Der junge Wolff stecke bis über beide Ohren in Schulden und man hätte einen Hinweis bekommen, dass es in der Abteilung nicht mit rechten Dingen zugehe.
Wilhelm Gerlach vermeinte wieder die anzüglichen Worte seiner Frau zu vernehmen. »Damals warst du ja auch erst Oberinspektor und nicht Steuerprüfer!« Er starrte vor sich hin. Sollte seine Frau intuitiv das Richtige erfasst haben? Brauchte man ihn und Edith nur als Mittel zum Zweck?
Nein, mit ihm konnte man das nicht machen. Nicht einen Schritt breit war er zeit seines Lebens vom rechten Weg abgewichen. Und niemand und nichts konnte ihn jetzt dazu veranlassen.
Er war bereit gewesen, seine Tochter zu verleugnen, um seinen guten Ruf zu wahren. Eben deshalb war er auch bereit gewesen, diese Ehe zu befürworten. Aber man sollte ja nicht denken, dass man ihn, den korrekten Beamten, auf die schiefe Bahn locken konnte. Er war ein Ehrenmann. War es Direktor Wolff auch?
*
»Darf ich Petra einmal in den Arm nehmen, bevor ich gehe, Edith?«, fragte Frau Gerlach.
Zaghaft klopfte es an die Tür. Roli stand draußen. Sie sah noch sehr blass und angegriffen nach der schweren Krankheit aus.
»Ein Herr Direktor Wolff möchte dich sprechen, Tante Edith«, sagte sie schüchtern.
Frau Gerlach ächzte leise. Edith sagte: »Du lieber Himmel!« Und dann zu Roli: »Ist schon gut, ich komme gleich.«
»Was mag er wollen?«, kam es gequält über Frau Gerlachs Lippen.
»Vielleicht hat Vater ihn hinterhergehetzt«, meinte Edith nachdenklich.
»Das kann ich nicht glauben.«
»Nun, wir werden ja sehen«, stellte Edith gelassen fest. »Kannst du Petra inzwischen füttern, Mutter?«
»Wenn ich darf? Aber wenn sie nun weint?«
»Ach, wenn sie Hunger hat und etwas zu essen bekommt, weint sie bestimmt nicht«, lächelte Edith.
Als sie ging, dachte sie: Mutter ist glücklich, das Kind einmal für sich zu haben. Das Leben ist schon eigenartig. Zuerst schämen sie sich, dass ihre Tochter ein Kind bekommt, und dann, wenn sie es sehen, wollen sie es nicht mehr hergeben. Diesem Herrn Direktor Wolff werde ich jedoch nicht gestatten, Petra anzuschauen, sonst bekommt er auch noch großväterliche Gefühle.
Nun war ihr regelrecht spottlustig zumute. Und alles nur, weil sie wusste: Es gibt Bert. Er steht auch hinter mir, wenn er gar nicht zugegen ist. Auf ihn kann ich mich in allen Situationen verlassen. Welch ein beglückendes Gefühl …
Der grauhaarige Mann erhob sich, als Edith den Salon betrat. »Fräulein Gerlach? Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte er heiser.
»Guten Tag«, erwiderte sie schlicht. »Kommen Sie als Fürsprecher Ihres Sohnes?«
Ein so selbstsicheres Auftreten hatte er nicht erwartet. Ein hübsches Mädchen war sie außerdem. Jetzt verstand er Dieter erst recht nicht mehr. Sein eigenes Selbstbewusstsein war stark erschüttert. Er fürchtete schon jetzt, dass sie ihn nicht rücksichtsvoller behandeln würde als seinen Sohn.
»Wir lernen uns leider viel zu spät kennen«, begann er stockend.
»Das ist nicht meine Schuld«, entgegnete Edith bedächtig.
»Ich weiß. Sie dürfen mich nicht missverstehen, mein liebes Kind«, erwiderte er jovial.
»O nein, ich verstehe ganz richtig. Ich habe Dieter aus dem Haus gewiesen, und nun schickt er Sie. Was soll dies alles eigentlich für einen Sinn haben, Herr Direktor Wolff?«
»Können Sie sich das nicht denken? Wir wollen etwas gutmachen. Ich bedauere zutiefst …« Verlegen unterbrach er sich.
»Sie haben keinerlei Veranlassung, sich zu entschuldigen«, sagte sie freundlich. »Zwischen uns gibt es keinerlei Verbindung.«
»Und das Kind?«, entfuhr es ihm.
»Das Kind? Mein Kind meinen Sie? Möchten Sie den Geburtsschein sehen? Vater unbekannt, steht darin. Ich möchte doch annehmen, dass dies einmal sehr dem Wunsch Ihres Sohnes entsprochen hat.«
»Dieter ist älter und reifer geworden«, warf er tonlos ein.
Am liebsten hätte sie laut herausgelacht, aber sie unterdrückte es, als sie seine verzweifelte Miene sah.
»Er wird nie erwachsen werden, solange Sie ihm immer alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumen«, erwiderte sie nachdenklich. »Er hat kein Verantwortungsbewusstsein, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Sicher haben Sie es, aber damit tun Sie ihm keinen Gefallen. Es gab einmal eine Zeit, in der er mir immer wieder versprach, mich seinen Eltern vorzustellen. Damals wäre ich sehr glücklich gewesen, Sie kennenlernen zu dürfen. Jetzt bin ich es nicht, weil Ihr Besuch völlig vergeblich ist, Herr Wolff. Ich werde in absehbarer Zeit heiraten. Nicht Dieter, sondern einen Mann, der von innen heraus gut und wertvoll ist. Und ich glaube auch, dass Sie sehr gut wissen, wie wenig Ihr Sohn taugt. Mit meinem Kind hat er nichts zu schaffen.«
»Fräulein Gerlach, ich bitte Sie«, stotterte er, »ich bin gekommen, um Ihnen die Verhältnisse klarzulegen. Ich fühle mich mitschuldig an dieser Affäre.«
»An welcher Affäre? Wollen Sie Dieters Schulden bezahlen?«, fragte sie gelassen. »Es sind fast dreitausend Euro. Ich habe teuer bezahlt in jeder Hinsicht, aber nicht umsonst. Ich habe dafür Erkenntnisse eingehandelt, die man wirklich nicht teuer genug bezahlen kann.«
»Sie haben ihm Geld gegeben?«, fragte Ferdinand Wolff voller Entsetzen.
»Das hat er Ihnen wohl nicht gesagt«, antwortete sie. »Vielleicht hätte ich lieber schweigen sollen, aber vielleicht ist für Dieter doch noch nicht alles verloren, wenn Sie die ganze Wahrheit erfahren. Für mich ist es bedeutungslos geworden, aber er ist Ihr Sohn, Ihr einziger Sohn. An Geld kann man es fehlen lassen, an Liebe nicht. Sie glaubten das wohl, weil Sie die Möglichkeit hatten, ihm alles erlauben zu können. Ich werfe mich nicht zum Richter auf. Sie tun mir leid, Herr Wolff, genauso, wie mir meine Eltern leidtun. Ich habe sie enttäuscht. Ihr Sohn hat Sie enttäuscht. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich sehe meinen ganz klar vor mir.«
Ein langes Schweigen lastete zwischen ihnen. Endlich hatte er sich wieder gefangen.
»Fräulein Gerlach«, kam es stockend über seine Lippen, »ich weiß nicht einmal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Könnte ich das Kind wenigstens einmal sehen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, Herr Wolff, aber es ist besser für Sie und auch für mich, wenn wir uns trennen, ohne das Kind noch einmal zu erwähnen. Es hat mit dem Namen Wolff nichts zu schaffen, das muss ich noch einmal betonen.«
»Ich verstehe, dass Sie verbittert sind«, stöhnte er, »aber …«
»Ich bin nicht verbittert«, fiel sie ihm ins Wort. »Ich bin fertig mit der Vergangenheit. Vor mir liegt eine Zukunft, wie ich sie mir erträumte. Es tut mir leid, dass Sie den weiten Weg umsonst gemacht haben.«
Er starrte blicklos zum Fenster hinaus. »Ich hätte es mir denken müssen«, murmelte er. »Ich bitte Sie demütig um Verzeihung für alles, was mein Sohn Ihnen angetan hat. Würden Sie mir gestatten, die Schuld zu begleichen?«
Mitfühlend verneinte Edith. »Es war ein gut angelegtes Kapital«, erwiderte sie mit einem flüchtigen Lächeln. »Es ist mir bereits vielfach zurückgezahlt worden.«
*
Denise schenkte sich bereits den zweiten Cognac ein. Alexander von Schoenecker beobachtete es unter halb geschlossenen Augen. »Seit wann bist du alkoholsüchtig, Liebling?«, fragte er belustigt.
Irritiert blickte sie ihn an. »Wieso?«, fragte sie.
»Weil du dir innerhalb von zehn Minuten den zweiten Cognac eingeschenkt hast. Mit wem hast du vorhin telefoniert?«
»Mit Frau Rennert. Edith hat gestern Besuch bekommen, ihre Mutter, und heute wieder, Herrn Direktor Wolff. Ich hätte doch wohl lieber hinüberfahren sollen.«
»Sie ist erwachsen, mein Liebes«, meinte er nachsichtig. »Und du wirst bald einen Schwips haben.«
»Das ist auch mal ganz hübsch«, erwiderte sie mit einem leisen Lachen. »Ich möchte wissen, was sich da drüben tut.«
»Du kannst sie morgen fragen. Wenn es dich beruhigt, kann ich dir sagen, dass Dr. Wolfram und Edith heiraten werden.«
Ihre Augen wurden ganz weit. »Woher weißt du das?«
»Von ihm. Ich habe ihn vorhin getroffen. Und nun zerbrich dir über Edith nicht den Kopf, mein Schatz. Mit einem solchen Mann im Rücken dürfte ihr nicht mehr allzu viel passieren, meine ich.«
»Ihr Männer nehmt alles so leicht«, seufzte sie.
Er lachte schallend. »Das hättest du vor ein paar Monaten noch nicht gesagt. Aber daran ist wohl nur der Cognac schuld, Denise.« Er nahm ihr das Glas aus der Hand und trank es aus. »Sonst gerätst du noch ins Philosophieren«, lächelte er. »Wir sind heute bei Werner und Babs eingeladen, da wirst du noch allerlei trinken müssen, mein Liebes. Immerhin – du bist süß, wenn du einen Schwips hast.«
»Ich habe keinen«, widersprach sie. »Ich versuche, klar und nüchtern zu denken.«
»Du versuchst es, es gelingt dir nicht. Mach dir keine Sorgen, es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen.«
Es war so herrlich, von seinen Armen umfangen zu sein, an seiner Brust zu liegen, keine eigenen Probleme mehr zu haben. Sie genoss es und erwiderte seine Küsse, die so sehnsüchtig und voller Verlangen waren, mit Hingabe.
»Mir ist ganz schwindelig«, seufzte sie.
»Ich sage ja, dass du keinen Alkohol verträgst«, meinte er nachsichtig.
»Das bisschen. Es ist etwas anderes«, murmelte sie. »Meine Knie sind so schwach.«
Die Farbe wechselte in ihrem Gesicht. Besorgt blickte er auf sie herab. Er hatte doch nur gescherzt. Es waren wirklich nur zwei kleine Schlückchen gewesen, die sie genommen hatte. Aber Denise schwankte.
Er hob sie empor und trug sie zum Sofa. Sie lächelte verzeihungsheischend zu ihm empor.
»Ich vertrage wirklich nichts«, flüsterte sie. »Aber es geht mir gleich wieder besser. Holst du mir bitte ein Glas Wasser?«
Er holte es, und gleich färbten sich ihre Wangen wieder rosig. Aber als sie bei Werner und Barbara Baumgarten waren, wiederholte sich dieser Zustand.
Dr. Baumgarten grinste verheißungsvoll, nachdem er sich Denise ein paar Minuten gewidmet hatte.
»Na, dann herzlichen Glückwunsch, alter Junge«, sagte er zu Alexander, der ihn verständnislos anschaute.
»Was soll das heißen?«, fragte er.
»Hast du immer eine so lange Leitung? Du wirst Vater«, lachte Dr. Werner Baumgarten. »Das Quartett wird vollständig. Schlagzeug, Gesang und Klavier – das nächste wird Gitarre lernen müssen.«
»Denise«, flüsterte Alexander und presste sein erglühendes Gesicht in ihre Hände. »Mein Geliebtes.«
*
Es war spät, als Irmgard Gerlach ihr Haus betrat. Es war dunkel in allen Räumen und still. Doch plötzlich flammte das Licht auf, und zu seiner vollen Größe aufgerichtet stand ihr Mann vor ihr.
»Du kommst doch zurück?«, fragte er höhnisch.
Sie rang einen Augenblick mit sich. »Ich kann auch wieder gehen«, erwiderte sie. »Es liegt in deinem Ermessen.«
»Und wohin willst du gehen?«, fragte er.
»Zu meiner Tochter.«
»Braucht sie ein Kindermädchen?« Wütend stieß er es hervor, aber seine Stimme war schon unsicher geworden.
»Gewiss nicht, aber sie würde mich nicht wegschicken – wie wir sie einmal weggeschickt haben. Du täuschst dich, wenn du meinst, dass Edith gebrochen ist. Sie ist stärker als du und ich zusammen. Sie wird heiraten.«
Er starrte sie an. »Hat sie sich also doch entschlossen?«, fragte er.
»Sie wird nicht Dieter Wolff heiraten, sondern Dr. Wolfram, einen Arzt.«
»Das kannst du mir doch nicht weismachen«, brauste er auf. »Zeige mir den Mann, der so was tut.«
»Dazu müsstest du schon nach Sophienlust fahren«, erwiderte sie ruhig. »Hierher wird er bestimmt nicht kommen. Übrigens war Herr Direktor Wolff auch dort und wollte Edith umstimmen.«
Er sank kraftlos in einen Sessel. »Er war dort? Und?«
»Ich sagte es dir doch schon. Edith wird Dr. Wolfram heiraten. Im Übrigen kann ich dir nur sagen, dass wir ein entzückendes Enkelkind haben, das wir gar nicht verdienen. Und eine Tochter, die sehr gut ohne uns zurechtkommt.«
Er sagte nichts mehr. Ganz still saß er da und starrte auf den Teppich.
»Es bereitet dir Freude, mich mürbe zu machen«, murmelte er nach geraumer Zeit.
»Nein, Wilhelm, das gewiss nicht. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Wir haben uns beide nichts vorzuwerfen. Grund dafür hätte nur Edith, aber sie ist uns weit voraus. Ich bin froh, dass sie so gefestigt ist und einen Mann bekommt, der sie besser versteht, als wir sie verstanden haben.«
Immer noch starrte er vor sich hin. »Wir sind fast fünfundzwanzig Jahre verheiratet«, murmelte er.
»Ich weiß«, nickte sie.
»Das kann man doch nicht fortwischen.«
»Das will ich doch gar nicht.«
»Du hast aber etwas getan, was du früher nie getan hättest«, brummte er. »Weißt du, wie es ist, wenn man heimkommt und das Haus leer ist?«
»Und man kein Essen vorfindet«, fuhr sie fort. »Hast du auch daran gedacht, wie oft Edith kein Essen bekam und wie allein sie war?«
»Sie wollte es doch so«, begehrte er auf.
»Wir zwangen sie dazu. Aber es ist zu ihrem Glück gewesen. Zu einem wahrhaften Glück. Sie trägt uns nichts nach. Wir sind ihr jederzeit willkommen. Auch zu ihrer Hochzeit, Wilhelm! Sophienlust ist ein himmlisches Stückchen Erde. Dort schweigt aller Groll. Dort herrschen Güte und Verstehen. Unser Kind fand dort das, was wir ihm versagt haben.«
»Werde ich mir nun für den Rest meines Lebens deine Vorwürfe anhören müssen?«, fragte er unwillig.
»Nein«, erwiderte sie mit einem feinen Lächeln. »Wir können nichts ungeschehen machen, aber es gibt immer eine Brücke, wenn man guten Willens ist.«
Er hob den Kopf und sah sie mit blicklosen Augen an. »Warum machst du mir keine Vorwürfe?«, fragte er tonlos.
»Ich denke an Edith und Petra«, erwiderte sie sanft. »Mein Herz hat Ruhe gefunden, Wilhelm.«
*
»Sie will also heiraten«, sagte Dieter Wolff zu seinem Vater, und seine Augen funkelten boshaft. »Hat sie dir auch gesagt, wen?«
»Ich habe sie nicht gefragt.«
»Das ist doch nur eine Finte, damit sie fein vor dir dasteht. Wer sollte sie schon heiraten?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere Männer gäbe, die sich glücklich schätzen würden«, schleuderte ihm der Vater ins Gesicht.
Dieter lachte höhnisch. »Da habe ich ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Schließlich ist es ja mein Kind.«
»Besinnst du dich plötzlich darauf? Mir scheint, sie würde das lieber ableugnen, als dir auch nur das geringste Recht einzuräumen. Sie hat mehr Rückgrat als du.«
Dieter sah ihn wütend an. »Sie hat dich ganz schön eingewickelt, muss ich feststellen. Nun, ich werde die Sache noch einmal selbst in die Hand nehmen.«
»Willst du deine Schulden bei ihr bezahlen?«, fragte Ferdinand Wolff eisig.
Dieters Augen verengten sich. »Ach, auf die Tour kommt sie jetzt, und du nimmst ihr natürlich alles ab.«
»Warum sollte ich nicht? Du hast doch bei jedermann Schulden, und bisher habe ich sie immer bezahlt. Auch diese hätte ich bezahlt, ein letztes Mal, aber sie will das Geld nicht. Ich rate dir, lass dieses Mädchen in Ruhe und schau lieber zu, wie du aus deinen Schwierigkeiten herauskommst. Auf mich kannst du nicht mehr rechnen.«
Diesmal war es ihm ernst. Dieter Wolff merkte es. Schritt für Schritt wich er zurück.
»Wir tragen den gleichen Namen«, sagte er warnend. »Denkst du plötzlich nicht mehr an Mutter? Willst du uns alle ruinieren?«
»Das hast bereits du getan. Ich bin am Ende. Ich werde meine Stellung aufgeben und mich mit Mutter aufs Land zurückziehen. Für uns reicht das, was uns noch geblieben ist. Und du wirst wohl oder übel einmal richtig arbeiten müssen.«
»Daran ist nur sie schuld«, schrie Dieter unbeherrscht. Dann knallte er die Tür hinter sich zu.
Müde sank Ferdinand Wolff auf seinen Stuhl und vergrub sein Gesicht in den Händen. Das kommt davon, wenn man zu nachsichtig ist, wenn man Elternliebe gleich Großzügigkeit setzt, dachte er.
*
Bert Wolfram und Edith hatten einen langen Spaziergang gemacht. »Nun ist ja wirklich allerhand passiert innerhalb kurzer Zeit«, meinte er mit einem Lächeln, »aber du hast dich gut gehalten, Kleines.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich sehe es dir an. Du bist um ein paar Zentimeter gewachsen und schaust nicht mehr wie ein ängstlicher kleiner Hase aus. Nun werden wir uns mal über den Hochzeitstermin den Kopf zerbrechen.«
»Ich kann doch jetzt nicht auf und davon gehen«, murmelte sie.
»Willst du die gleiche Hinhaltetaktik einschlagen wie Denise bei Alexander von Schoenecker?«, fragte er. »Bei uns liegen die Dinge doch wohl etwas anders. Petra muss sich an ihren Vati gewöhnen, bevor sie richtig zu denken anfängt.«
»Darüber muss ich aber erst mit Frau von Schoenecker sprechen, Bert. Sie dachte bestimmt, dass ich immer in Sophienlust bleiben würde.«
»Das, mein Liebes, dachte sie ganz bestimmt nicht«, widersprach er.
»Du bist sehr sicher.«
»Wir haben öfter über dich gesprochen, als du glaubst«, lächelte er. »Sie weiß ganz sicher, dass meine Absichten ernst sind.«
Röte stieg in ihre Wangen. »Ihr habt über mich gesprochen«, murmelte sie.
»Und uns sehr den Kopf zerbrochen, wie man dir helfen könnte. Das brauchen wir nun nicht mehr. Nun, wann wollen wir heiraten?«
»Hast du es dir auch reiflich überlegt?«, fragte sie leise.
Er seufzte abgrundtief. »Jetzt fängt sie schon wieder an. Natürlich habe ich es mir überlegt. Du solltest doch wissen, dass ich keine übereilten Entschlüsse treffe. Ich habe schon viel zu lange gezögert.«
»Ich kann deinen Mut nur bewundern«, flüsterte sie.
»Ich deinen, Arztfrau zu sein ist kein leichtes Leben, mein Mädchen.«
»Ich stelle es mir sehr schön vor.«
Zärtlich umschloss er ihr Gesicht mit beiden Händen. »Ja, du wirst eine prächtige Arztfrau sein. Ich bin froh, dass wir nun wenigstens so weit sind, Edith. Ich schlage vor: Mit Beginn des neuen Jahres feiern wir auch den Beginn eines neuen Lebens.«
»Das Dorf kommt aus den Aufregungen nicht mehr heraus«, meinte sie mit einem leisen Lachen. »Alle halbe Jahr gibt es eine Hochzeit.«
»Dann wird ja wohl eine Weile Schluss sein. Es sei denn, Frau Rennert entschließt sich, Justus zu heiraten, und Frau Trenk zaubert auch noch einen Mann herbei. Roli ist ja glücklicherweise noch zu jung, sonst hätte ich schon gewisse Bedenken.«
»Wieso?«
»Nun, sollte es dir entgangen sein, wie sie Wolfgang Rennert anhimmelt?«
»Das ist doch nur mädchenhafte Schwärmerei«, meinte Edith.
»Aus der sehr schnell mehr werden kann. Aber darüber wollen wir uns nicht den Kopf zerbrechen. Jedenfalls ist Roli schon alt genug, um die Kinder mit zu beaufsichtigen, und intelligent ist sie auch.«
»Du meinst, dass ich schnell zu ersetzen bin«, sagte sie kleinlaut. »Das ist kein beglückender Gedanke.«
»Wir müssen uns aus der Vorstellung lösen, dass wir unersetzlich sind, Edith«, meinte er ernst.
»Für Menschen, mit denen wir ganz innig verbunden sind, gewiss, aber sonst gibt es immer einen Ersatz. Es geht ja auch, dass Denise von Schoeneich aus ihr Auge auf Sophienlust hat. Außerdem hat wohl niemand das Recht, von einem anderen völlige Selbstaufgabe an eine Sache zu verlangen, solange er jung und voller Wünsche ist. Man kann anderen nicht dienen, wenn man sich selbst kasteit. Das ist wenigstens mein Standpunkt. Es ist einfach unnatürlich. Und es gibt viele Menschen, denen Sophienlust am Herzen liegt und die immer wieder zur Stelle sein werden, wenn einmal Not am Mann sein sollte. Auch du und ich.«
*
»Nun wird Edith doch den Dr. Wolfram heiraten«, sagte Roli beiläufig, während sie an einer Kohlezeichnung strichelte. Für solche entwickelte sie in letzter Zeit ein besonderes Talent, wohl weil ihr Wolfgang Rennert ein so guter Lehrmeister war. Das Modell zu diesem Bild war ein winziges Fohlen gewesen, das auf stakeligen Beinen auf der Weide stand. Roli wollte das Bild Dominik zu Weihnachten schenken, weil es ihm so sehr gefiel.
»Sie passen gut zusammen«, bemerkte Wolfgang Rennert.
»Wer?« Roli war mit ihren Gedanken schon wieder bei ihrer Malerei.
»Dr. Wolfram und Edith«, lächelte er. »Außerdem bekommt Edith ja eine tüchtige Nachfolgerin.«
»Wen denn?«, fragte sie beiläufig.
»Na dich«, erwiderte er verwundert. »Wen sonst?« Eigentlich müsste ich schon langsam Sie zu ihr sagen, überlegte er. Sie wird erwachsen und manch einer könnte Anstoß daran nehmen, dass ich sie duze. Aber sie sah ihn völlig verstört an, als er es erwähnte. »Alle sagen du zu mir«, erwiderte sie trotzig.
»Du wirst eine junge Dame, Roli«, neckte er.
»Ich werde nie eine junge Dame. Ich möchte so bleiben, wie ich bin.«
Ein seltsamer Ausdruck war in ihren Augen, als sie ihn ansah, schwer deutbar und melancholisch. Ihm wurde ganz eigen zumute dabei.
»Mit den Jahren wird sich manches ändern«, stellte er fest. »Die Kinder werden größer, wir werden älter.«
»Und eines Tages werden Sie heiraten«, entfuhr es ihr.
Jetzt war er bestürzt. »Wer sollte mich schon heiraten?«, meinte er leichthin.
Ihr feines Gesicht überschattete sich. Intensiv widmete sie sich dem Bild. »Wollen Sie weg von Sophienlust – ich meine, später einmal?«, fragte sie leise.
»Vielleicht. Was weiß man schon, was kommt. Es ist ja nicht gesagt, dass ich hier immer gebraucht werde.«
»Natürlich werden Sie immer gebraucht. Es wird immer Kinderheim bleiben, das hat Frau von Schoenecker neulich erst wieder gesagt.«
»Willst du hier alt werden, Roli? Zieht es dich nicht hinaus in die Welt? Du bist begabt. Du brauchst neue Eindrücke. Man wird deine Bilder kaufen, und eines Tages wirst du berühmt sein.«
»Ich will nicht berühmt werden, wenn ich von Sophienlust weggehen muss«, erwiderte sie aggressiv. »Ich habe hier Eindrücke genug. Die Kinder, die Tiere. Ich möchte nichts anderes malen. Ich mag die lauten Städte nicht, die Menschen, die andern immer wehtun. Ich habe doch niemanden, der mich gernhat.«
Seine Hand legte sich auf ihre Schulter, und als sie rasch den Kopf wandte, streifte sie ihre Wange.
Roli war sechzehn, und ihr Herz gehörte bereits ihm. Er spürte es mit einem Gemisch von Glück und Angst zugleich.
»Du ahnst gar nicht, wie rasch man erwachsen wird, Roli«, flüsterte er.
Ein zauberhaftes Lächeln blühte um ihren jungen, unberührten Mund. »Manchmal möchte ich schnell erwachsen werden, dann wieder möchte ich ewig Kind bleiben«, sagte sie. »Wie reimt sich das zusammen?«
»Bleib so lange Kind, wie es irgend geht«, sagte er gedankenvoll. »Ich werde darüber wachen, damit du es unbeschwert sein kannst.«
»Und wenn ich erwachsen bin, Wolf?«, fragte sie träumerisch.
Sein Zeigefinger strich ihre Nase entlang.
»Dann werde ich dich vielleicht einmal fragen, ob du meine Frau werden willst, wenn inzwischen nicht ein anderer kommt.«
»Es wird nie einen anderen geben«, sagte sie mehr zu sich selbst. Und nach kurzem Überlegen schrieb sie das Datum des Tages an den unteren Rand des Bildes.
»Möchten Sie das Bild haben, Wolf?«, fragte sie leise. »Ich werde für Nick ein anderes malen.«
»Danke, Roli«, entgegnete er verhalten.
»Sie werden sich dann immer an diesen Tag erinnern?«
Er nickte. »Vergiss aber nicht, dass du sechzehn bist und ich fünfundzwanzig.
»In vier Jahren sind Sie neunundzwanzig und ich zwanzig«, sagte sie mit leisem Lachen, in dem eine Glocke zu schwingen schien.
»Komisch, wie die Jahre zusammenschrumpfen.«
Eine heiße Zärtlichkeit erfasste ihn, als er in ihre leuchtenden Augen blickte. Seine erste Liebe war dieses halbe Kind, aber er wusste genau, dass sie seine große Liebe bleiben würde.
»Wolf«, sagte seine Mutter wenig später mahnend, als er zu ihr kam, »du befasst dich zu viel mit Roli. Schaff keine Probleme zwischen euch.«
»Dazu habe ich sie zu lieb, Mutter«, erwiderte er mit rauer Stimme.
»Sie ist ein Kind«, sagte sie eindringlich.
»Aber sie wird eines Tages erwachsen werden, Mutter.«
»Vergiss nicht, was wir Frau von Schoenecker zu verdanken haben«, murmelte sie.
»Nicht einen Augenblick. Sei unbesorgt.« Er straffte sich und wirkte plötzlich viel männlicher. Nein, sie brauchte sich jetzt um ihn keine Sorgen mehr zu machen. Keinen Fußbreit würde er von dem Weg abweichen, den er nun ging. Er hatte ein Ziel. Er hatte zu sich selbst gefunden.
»Roli, willst du nicht auch kommen?«, rief Frau Rennert das Mädchen.
Zierlich und anmutig kam Roli mit wippendem Faltenrock auf sie zu, ihren Zeichenblock unter dem Arm.
»Darf ich Sie auch mal malen, Frau Rennert?«, fragte sie.
»Mich? Ach du lieber Gott«, lächelte Frau Rennert. »Da gibt es aber hübschere Motive.«
Roli sah sie offen an. »Was gibt es Schöneres als eine Mutter?«, erwiderte sie sinnend. Dann ging sie rasch zu den anderen Kindern.«
Unwillkürlich faltete Frau Rennert die Hände. »Lieber Gott«, flüsterte sie, »alles liegt in deiner Hand. Lass keinen Reif fallen auf diese junge Liebe, die doch erst im Erblühen ist. Bewahr sie vor den Stürmen. Gönne mir das Glück, eines Tages zwei Kinder zu haben.«
*
»Dotto kommt, Dotto kommt«, jauchzte Petra, als sie den grauen Wagen nahen sah.
Er war das gleiche Modell wie der Wagen von Dr. Wolfram, aber nicht er entstieg ihm, sondern Dieter Wolff.
Edith hatte kaum die Kraft, das zappelnde Kind festzuhalten, das dann jedoch enttäuscht den Finger in den Mund steckte und sich hinter ihr versteckte, als es merkte, dass es sich getäuscht hatte.
Edith war zur Bildsäule erstarrt, denn nie und nimmer hätte sie geglaubt, dass Dieter Wolff es noch einmal wagen würde, nach Sophienlust zu kommen.
Drinnen im Haus sangen die Kinder. Niemand war in der Nähe, der ihr zur Hilfe kommen konnte. Langsam, ihre Angst auskostend, kam er auf sie zu.
»Das ist also meine Tochter«, sagte er. »Nett, dass ich sie nun doch mal sehe.«
Bert, dachte sie, und es war, als gebe ihr der Gedanke an ihn Kraft. »Es ist meine Tochter«, stieß sie hervor. »Was willst du hier?«
»Mich davon überzeugen, was du meinem Vater für Unsinn erzählt hast«, erklärte er dreist. »Du gefällst dir wohl in der Rolle der Rächerin, Edith.«
»Wofür sollte ich mich rächen? Für meine eigene Dummheit?«, fragte sie ruhig.
»Dumm ist es allerdings, wenn du ausschlägst, was man dir bietet«, meinte er unverfroren. »Es kann alles gut werden.«
Er streckte seine Hand nach dem Kind aus, aber Petra wich zurück.
»Ein hübsches Kind«, stellte Dieter Wolff fest. »Sie wird sich schon noch an mich gewöhnen. Und du wirst endlich zur Vernunft kommen, Edith.«
»Das bin ich vor zwei Jahren«, erwiderte sie mit bebender Stimme. »Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ich habe nie etwas von dir gefordert.«
»Du hast mich doch geliebt und wolltest so gern meine Frau werden. Nun kannst du es werden.«
»Ich verzichte dankend«, murmelte sie.
Er schlug einen anderen Ton an. »Lass uns doch vernünftig miteinander reden, Edith«, fuhr er freundlich fort. »Ich weiß, dass du eine schlechte Meinung von mir hast, aber ich habe über uns nachgedacht. Du kannst doch nicht leugnen, dass ich Petras Vater bin.«
»O doch, ich kann es leugnen«, erklärte sie stolz. »Ich könnte einen x-beliebigen Mann als ihren Vater ausgeben. Ich kann auch sagen, dass ich seinen Namen gar nicht kannte. Meinst du, dass man es mir nicht abnehmen würde?«
»Rede nicht solchen Unsinn. Du weißt es und ich weiß es, dass es unser Kind ist.«
»Edith, Dr. Wolfram ist am Telefon«, rief eine Stimme aus dem Haus.
Gott sei Dank, dachte sie, nahm Petra und ließ Dieter Wolff einfach stehen.
Er biss sich auf die Lippen. Dr. Wolfram? War das vielleicht der Mann, den sie heiraten wollte? Es versetzte seiner Eitelkeit einen Schock, denn vorhin war er an dem Haus vorbeigefahren und hatte das Schild gelesen: Dr. med. Bert Wolfram. Lohnte es sich, den Dingen auf den Grund zu gehen? Nun, man konnte ja mal ein bisschen auf den Busch klopfen. Sein rachedurstiges Herz verlangte nach einer Genugtuung.
Noch während Edith mit Dr. Wolfram telefonierte, hörte sie den Wagen davonfahren.
»Jetzt verschwindet er«, sagte sie erleichtert. »Ach, Bert«, die Stimme versagte ihr, aber er wusste ohnehin, wie ihr zumute war.
*
»Wolff-Wolfram. Was gäbe es noch für eine Steigerung?«, sagte Dieter Wolff zynisch, als er dem verblüfften jungen Arzt gegenüberstand.
»Finden Sie nicht, dass Sie reichlich unverschämt sind?«, antwortete Dr. Wolfram ruhig
»Bin ich das? Finden Sie nicht, dass ich ein älteres Anrecht auf Edith habe?«
»Ich kann höchstens feststellen, dass Sie keinerlei Anrecht auf sie haben«, erwiderte der Arzt eisig. »Was wollen Sie eigentlich?«
»Mich einmal mit Ihnen unterhalten«, meinte Dieter Wolff leichthin. »Ich finde es sehr amüsant, dass gewisse Ähnlichkeiten zwischen uns bestehen.«
»Ich wüsste nicht welche«, entgegnete Bert Wolfram steif.
»Vom Namen abgesehen haben wir beide den gleichen Wunsch, die gleiche Frau zu heiraten. Ich habe allerdings einen Vorteil.«
»Meinen Sie?«
»Ich bin Petras Vater«, erwiderte Dieter Wolff herablassend.
»Das müssten Sie erst beweisen«, stellte Bert Wolfram schnell gefasst fest.
Dieter Wolff war konsterniert. »Soll ich das so verstehen, dass Ediths Vorleben Sie nicht interessiert?«
Nur sehr mühsam konnte Bert Haltung bewahren. Am liebsten hätte er den anderen am Kragen gepackt und hinausgeworfen. Aber damit hätte er alles nur noch schlimmer gemacht, wurde ihm noch rechtzeitig bewusst.
»Ich habe keinerlei Veranlassung, mich über meine Ansichten zu äußern«, erklärte er beherrscht. »Allerdings bin ich gern bereit, Ihnen zu erklären, was ich von Ihnen halte, falls Sie daran interessiert sind.«
»Aber bitte, tun Sie sich keinen Zwang an.«
»Sie sind mies, ganz einfach mies«, stieß Bert zwischen den Zähnen hervor. »Genügt Ihnen das?«
»Vielleicht haben Sie sich allzu einseitig informiert? Interessiert es Sie nicht einmal vom männlichen Standpunkt aus, gewisse Umstände zu erfahren?«
»Nein, es interessiert mich nicht«, entgegnete Bert eisig. »Meine Zeit ist zu kostbar, um mir Ihr Geschwätz anzuhören.«
»Aber vielleicht hören sich andere dieses Geschwätz gerne an?«, fragte Dieter Wolff anzüglich. »Diese netten, einfältigen Leute hier haben sehr moralische Ansichten, möchte ich meinen.«
»Über Moral kann man verschiedener Ansicht sein. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich Edith Gerlach als meine zukünftige Frau betrachte und dass Sie daran nichts ändern werden.«
»Meinen Sie?« Er lächelte süffisant. »Nun, wir werden es sehen.«
*
Nun, er bekam es zu spüren, wie moralisch diese netten, einfältigen Dorfbewohner waren. Im ›Roten Ochsen‹ ging es eine Stunde später hoch her. Es war schon lange nicht mehr passiert, dass jemand solche Prügel bezogen hatte wie Dieter Wolff.
Glücklicherweise befand sich zufällig Dr. Baumgarten in der Nähe, sodass es Bert Wolfram erspart blieb, ihm Erste Hilfe zu leisten. Er wurde von seinem Kollegen erst später davon in Kenntnis gesetzt, aber da war Dieter Wolff bereits über alle Berge. Trotz seiner beträchtlichen Schmerzen hatte er es vorgezogen, das Weite zu suchen.
»So ein mieser Bursche«, hatte der Wirt geschimpft. »Wenn der sich noch mal hier blicken lässt, dann brechen wir ihm alle Knochen.«
»Er wird euch wegen schwerer Körperverletzung anzeigen«, hatte Dr. Baumgarten gewarnt.
»Soll er nur«, meinten sie. »Wir haben nichts gesehen und nichts gehört.«
Alle waren sich einig. Da kam so ein Fremder daher und wollte jemandem, der zu ihnen gehörte, Übles nachreden. Früher hätte er wohl manches geneigte Ohr gefunden, aber das hatte sich geändert, seit Sophienlust ein Bestandteil der Gemeinde geworden war. Man wollte seinen Frieden haben, und niemand durfte es wagen, einen von ihnen anzugreifen.
Die Edith Gerlach kannten sie besser, und wenn ein Mann wie Dr. Wolfram sie zur Frau haben wollte, war alles in bester Ordnung.
Treuherzig sahen sie den Dr. Baumgarten an, als er ihnen klarmachen wollte, dass sie deshalb kein Recht zur Lynchjustiz hätten.
»Wer hat ihm denn schon was getan?«, meinten sie. »Er ist halt über die Türschwelle gestolpert und blöd gefallen. Dafür können wir doch nichts. Wir haben ganz friedlich an unserem Stammtisch gesessen. Und wir haben doch auch gleich den Arzt gerufen.«
»Wenn es so ist«, brummte Dr. Baumgarten und machte sich auf den Heimweg. Natürlich erstattete er vorher Bert Wolfram Bericht, und der brachte es Edith vorsichtig bei.
»Und du willst mich immer noch haben?«, fragte sie niedergeschlagen.
»Nun erst recht«, erwiderte er aufmunternd. »Was meinst du wohl, wie ich an mich halten musste, um ihn nicht selbst zu verprügeln. Aber nun siehst du wenigstens, dass niemand etwas gegen dich hat, du Angsthase.«
»Gönnen wir ihnen die Abwechslung«, meinte auch Alexander von Schoenecker. »Was haben sie sich früher gerauft. Der Frieden ist ja fast unheimlich geworden.«
Denise lachte leise. »Glücklicherweise hat der Krieg nicht lange gedauert. Wenn es nur immer so wäre und es stets nur bei ein paar Beulen bliebe.«
Die Kinder stürmten ins Zimmer. »Habt ihr’s schon gehört? Im ›Roten Ochsen‹ hat es eine tolle Rauferei gegeben«, riefen sie durcheinander. »Schade, dass wir nicht dabei sein konnten.«
»Hier ist doch nie was los«, murrte Dominik. »Immer nur Hochzeiten und Kindstaufen. Und wenn es hoch kommt, geht mal ein Pferd durch.«
»Immerhin sind zwei Ärzte voll beschäftigt«, lächelte Denise, »und das langt.«
»Und wir fliegen übermorgen nach Düsseldorf und bringen den Zwillingen Dolly«, mischte sich Andrea ein. »Aber Senta wird traurig sein, wenn sie eines ihrer Kinder hergeben muss.«
*
Dass die Zwillinge Odette und Oliver ein wunderschönes Elternhaus hatten, wussten sie nun. Dolly war gut untergebracht. Sascha meinte zwar, dass sie mächtig verwöhnt werden würde, aber das wurde von Andrea und Dominik gutgeheißen. Wenn man nur ein Hundchen hatte, durfte man es ruhig etwas verwöhnen.
»Ich möchte nur wissen, ob Senta Dolly noch erkennt, wenn sie uns mal besuchen«, überlegte Dominik.
»Mütter vergessen ihre Kinder nie«, versicherte Andrea.
»Na, ich weiß nicht«, meinte Sascha ernsthaft. »Aber vielleicht ist es bei Menschen anders als bei Tieren.«
»Dolly hat nicht mal gejault, als wir weggefahren sind«, empörte sich Dominik.
»Sie weiß eben, dass sie zu lieben Menschen gekommen ist«, erklärte Denise.
»Tiere haben Instinkt«, fügte Alexander hinzu.
»Und Menschen – was haben die?«, wollte Dominik wissen.
»Erklärst du es ihm, Denise?«, fragte Alexander lächelnd.
»Willst du dich drücken?«, neckte sie ihn.
»Hunde schnuppern halt«, versuchte es Andrea zu erklären.
»Ich kann manche Leute auch nicht riechen«, erklärte Dominik. »Die Eltern von den Zwillingen sind nett, aber ich verstehe nicht, warum sie ihre Kinder nicht immer mitgenommen haben. Noch dazu, wo sie eine so liebe Großmama haben.«
Alexander und Denise tauschten einen langen Blick. Er hatte ganz vergessen, wie alles gewesen war.
Jetzt glaubte auch er daran, dass Angelika und Frank Frobenius die richtigen Eltern von den Zwillingen seien, und dabei waren erst ein paar Monate vergangen, seit sie die Kinder adoptiert hatten.
Sascha schmiegte sich ganz eng an Denises Seite. »Er ist ja noch klein«, flüsterte er. »Wir wissen, warum es so ist, nicht wahr, Mutti? Aber das brauchen wir ihm ja nicht zu sagen.«
»Mein großer Junge«, sagte sie zärtlich und fuhr ihm mit den Fingern durch das Haar.
»Ich bin so froh, dass du unsere Mutti bist«, raunte er.
»Und ich bin sehr froh, dass ich euch habe.«
»Kannst du das leiden, wenn Sascha mit Mutti schmust, Papi?«, fragte Dominik gekränkt.
»Warum sollen sie nicht mal schmusen? Sie haben sich eben lieb.«
»Wir haben uns doch alle lieb.«
»Gott sei Dank«, erwiderte Alexander aus tiefstem Herzen.
Senta jedenfalls schien, trotz ihrer großen Kinderzahl, Dolly zu vermissen. Aufgeregt umkreiste sie die Heimgekehrten, zeigte aber nicht jene temperamentvolle Freude, die sie sonst sogar nach kurzer Anwesenheit der Bewohner von Gut Schoeneich bekundete. Mit traurig-vorwurfsvollem Blick betrachtete sie einen nach
dem anderen und zog sich dann schmollend zu ihren anderen Jungen zurück, die sie nicht mehr aus den Augen ließ.
Als Dominik sich ihr näherte, begann sie leise zu knurren, was noch niemals passiert war. Tiefbetrübt hockte er sich neben ihr nieder und sprach begütigend auf sie ein.
»Du musst nicht böse mit uns sein, Senta«, sagte er eindringlich. »Ja, du bist eine gute Mutter, eine ganz liebe sogar, aber du kannst ja nicht alle Kinder behalten. Dolly hat es ganz schön, wie die Zwillinge auch. Sie sind lieb mit Dolly, und sie hat ein wunderschönes Körbchen.« Nick kraulte Senta liebevoll hinter dem Ohr, dann ging er zu seinen Eltern.
»Ich muss jetzt immer an Odette und Oliver denken«, sagte er. »Und auch an Susi, Golo und Heiner. Wie es den Zwillingen geht, wissen wir ja nun, aber die anderen schreiben so wenig.«
»Das ist nun mal so, wenn man längere Zeit getrennt ist«, tröstete ihn Alexander. »Man lernt andere Freunde kennen, und man lebt in einer anderen Umgebung, jeder hat seine Aufgaben, da wird es mit dem Schreiben immer weniger.«
»Aber Susi war meine richtige Freundin. Na ja, sobald wird ja nun keiner mehr von Sophienlust weggehen. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben.«
Alexander legte seinen Arm um Denise und sagte lächelnd: »Nun werden wir unseren Kindern langsam sagen müssen, dass wir Zuwachs bekommen.«
»Jetzt schon? Sie werden uns mit Fragen peinigen und ungeduldig sein. Vor allem Dominik.«
»Sie sollen sich doch mit uns freuen.«
Denise schloss die Augen. Würden sie sich wirklich freuen können? Schließlich waren sie schon in einem Alter, das von den Babyschuhen weit entfernt lag. Ein kleines Wesen konnte alles verändern. Ja, sie würde es genießen, dieses Kind, Alexanders Kind, aber ein ganz klein wenig fürchtete sie doch, dass sich die anderen drei zurückgesetzt fühlen könnten.
*
Liebe Susi, schrieb Dominik bedächtig, es wird Zeit, dass Du mal wieder was von Dir hören lässt. Bei uns ist Winter, aber es liegt noch kein Schnee, und so ist es ziemlich langweilig. Bei Euch ist ja immer Sommer. Du könntest mal wieder eine Ansichtskarte schicken mit einer schönen Briefmarke. Sascha und ich sammeln jetzt welche. Besser wäre es ja noch, wenn Du mal kommen würdest, aber Du hast ja nun einen kleinen Bruder und brauchst uns nicht mehr.
Wir haben die Zwillinge besucht, und Scharlach hatten wir auch. Die Zwillinge hatten die Windpocken. Jetzt haben sie Dolly bekommen. Wir würden Euch ja auch einen Hund schicken, aber Mutti meint, dass das zu große Schwierigkeiten macht. Bist du auch so groß geworden? Ich bin ein mächtiges Stück gewachsen.
Edith wird den Dr. Wolfram heiraten. Nun kriegt Petra auch einen Vater. Die kann froh sein, denn er ist sehr nett. Marco wünscht sich auch Eltern. Wisst ihr nicht welche für ihn? Seine Eltern leben bestimmt nicht mehr wie die von den Zwillingen. Das war ein Zufall. Jetzt muss ich aber Hausaufgaben machen. Das Bild, das Roli von Dir gemalt hat, hängt immer noch bei mir im Zimmer. Siehst Du noch genauso aus?
Es grüßt Dich Dein Nick.
So viel hatte er noch nie geschrieben, und er war richtig müde darüber geworden. Es war ohnehin nicht verlockend, an die Hausaufgaben zu denken, aber Lehrer Brodmann konnte ganz schön streng sein.
Andrea übte Klavier. Auch dazu hatte Nick heute nicht viel Lust. Das machte das Wetter, hatte Martha gesagt. Da wird man ganz trübsinnig. Man hatte auch so komische Gedanken. Warum war Vati eigentlich so besorgt um Mutti, und warum trank sie nie mehr Kaffee, sondern immer solchen komischen Tee? Und warum ritt sie nicht mehr aus? Früher war sie bei Wind und Wetter mit Vati unterwegs gewesen. Ob sie krank war? Nein, krank sah sie eigentlich nicht aus, aber nach dem Flug war es ihr schlecht gewesen.
»Du bist heute vielleicht ein Langweiler«, tönte Andreas Stimme an sein Ohr. »Wir wollten doch vierhändig spielen. An wen hast du denn da geschrieben?«
»An Susi.«
Andrea konnte nur staunen, aber sie sagte lieber nichts, denn Dominik konnte sehr empfindlich reagieren.
»Mutti ist komisch«, wechselte Dominik das Thema.
»Wieso denn? Weil sie mit Vati über früher redet?«
»Ich mag das gar nicht so gern«, stellte Andrea fest. »So, wie es jetzt ist, gefällt es mir.«
»Aber sie trinkt immer Tee und reitet nicht mehr aus.«
»Sicher wegen dem Baby«, meinte Andrea leichthin.
»Wegen welchem Baby?«, fragte er atemlos.
»Na, wegen unserem. Sie haben zwar nichts gesagt, aber ich glaube bestimmt, dass wir eins kriegen.«
»Warum glaubst du das?«
»Weil Martha gesagt hat, dass das Südzimmer ideal für das Baby wäre.«
»Ach, was Martha immer redet«, meinte Dominik wegwerfend. »Zuerst müssten sie es ja uns sagen.«
Nun hatte er noch ein Problem, das aber noch an diesem Tage gelöst werden sollte, denn die Kinder wurden davon unterrichtet, dass sie in ein paar Monaten zu viert sein würden.
»In wie viel Monaten?«, erkundigte sich Andrea interessiert.
»In sechs«, erwiderte Denise zögernd.
»Claudia kriegt ihres schon in drei Monaten«, bemerkte Dominik mit herbem Vorwurf. »Warum geht es bei ihr schneller?«
Denise warf Alexander einen Hilfe heischenden Blick zu, aber solchen Fragen fühlte er sich auch nicht gewachsen.
»Sie hat es früher gewusst«, half ihnen Andrea aus der Verlegenheit heraus.
Dominik sah seine Mutter kritisch an. »Mag das Baby diesen komischen Tee, den du immer trinkst? Vielleicht mag es lieber Milch?«, meinte er.
»Die mag Mutti aber nicht«, mischte sich nun Sascha ein.
»Na, ich würde mich schön bedanken,wenn ich dieses Zeug immer trinken müsste«, äußerte sich Dominik. »Und das noch sechs Monate.«
Für ihn war diese Angelegenheit vorerst uninteressant geworden. Sechs Monate, wenn man sie vor sich hatte, waren eine endlos lange Zeit. Diese Ansicht teilte Denise allerdings mit ihrem Sohn.
*
Das Baby beschäftigte nun natürlich auch die Familie Wellentin und den Freundeskreis. Wenn Irene von Wellentin mit Kati in die Stadt fuhr, wurden schon niedliche kleine Sachen gekauft. Und Kati war ganz begeistert, wenn sie mit auswählen durfte.
Aber an diesem kalten Wintertag zeigte sie ganz plötzlich kein Interesse mehr. Eben noch hatte sie munter auf Irene von Wellentin eingeschwatzt und sie auf dieses und jenes aufmerksam gemacht, doch nun war sie plötzlich verstummt. Ganz blass und spitz sah ihr Gesicht aus.
»Dich friert«, stellte Irene von Wellentin besorgt fest. »Wir werden uns in dem Café aufwärmen.«
»Ich möchte lieber heimfahren, Mutti«, sagte Kati bittend.
»Fühlst du dich nicht wohl?«, fragte Irene von Wellentin besorgt.
»Doch. Aber ich möchte lieber heim. Entschuldige bitte.«
Was hat sie nur, überlegte Irene betroffen, denn Kati konnte gar nicht schnell genug zum Wagen kommen. Sie bebte wie Espenlaub, als Irene den Arm um sie legte.
»Kindchen, so sag mir doch, was dich ängstigt«, bat sie.
»Ich habe die Frau gesehen, Mutti, die Frau, die ich nicht leiden kann.«
Irene von Wellentins Herzschlag setzte fast aus. Sie wusste sofort, wen Kati meinte: Ihre Mutter – Hanna Ebert.
»Du hast dich sicher nur getäuscht, mein Liebes«, erwiderte Irene von Wellentin stockend.
»Nein, ich habe mich gewiss nicht getäuscht«, stieß Kati angstvoll hervor. »Wenn sie nun wiederkommt, Mutti?«
»Sie wird nicht wiederkommen«, sagte Irene von Wellentin beruhigend, aber wohl war ihr dabei nicht. Wenn die Adoption doch nur endlich ausgesprochen und rechtsgültig wäre, dachte sie, schalt sich aber zugleich, dass sie sich deshalb noch Sorgen machte. Sie hatte nie den geringsten Zweifel gehegt, dass sich ihr Wunsch erfüllen würde.
Aber dann, als ihr Mann zugeben musste, dass das Verfahren ins Stocken geraten war, bekam auch sie es mit der Angst.
»Es sind eben so unklare Verhältnisse«, erläuterte Hubert von Wellentin bedrückt. »Der Vater muss erst für verschollen erklärt werden, und das dauert seine Zeit. Aber sie kann doch nichts mehr rückgängig machen.«
Konnte sie es wirklich nicht? Dieser Gedanke quälte Irene von Wellentin. Es wäre nicht der erste Fall, dass in einer Mutter verspätete Liebe zu ihrem Kind erwachte. Aber für Kati und auch für sie wäre es schrecklich. Ein Leben ohne dieses Kind, das so viel Freude in ihr Leben brachte, schien ihr undenkbar.
*
Ethische Bedenken waren Hanna Ebert bisher noch nicht gekommen. Sie merkte nur, dass auch viel Geld schnell zusammenschmolz, wenn man es mit vollen Händen ausgab. Sie hatte ihr Leben einmal so richtig genießen wollen, und dies hatte sie auch getan. Sie hatte sich hübsche Kleider gekauft und schöne Reisen gemacht – aber immer wieder zog es sie in diese Stadt.
Zu Hause war sie nirgends, und das wurde ihr doch manches Mal bewusst. Gewiss hatte sie Männer kennengelernt, aber immer wieder hatte sie die Erfahrung machen müssen, dass diese jetzt nur auf ihr Geld aus waren, wo sie sich früher mit ein paar amüsanten Stunden begnügt hatten.
Im Innern wünschte sie sich einen Mann, der sie nicht nur ausnützen wollte, sei es in dieser oder jener Hinsicht.
Und es gab auch einen, den sie schon lange kannte und mit dem sie reden konnte, der sich aber zugleich nichts vormachen ließ. Es war Rudolf Schneider, der als Obermonteur in den Wellentin-Werken beschäftigt war. Früher schon, noch bevor sie nach Australien gegangen war, hatte er ein Auge auf sie geworfen. Aber was sollte sie, die sich so viel vom Leben erhoffte, mit einem Witwer, der zwei Kinder hatte?
Als sie zurückgekommen war, war sie ihm einmal kurz begegnet, und in seiner rauen Art war er auch recht nett zu ihr gewesen.
»Glück hast du gehabt«, hatte er gesagt, »dass deine Kleine in Sophienlust untergekommen ist. Da geht es ihr gut, und du bist die Sorge los.«
Aber seit sie das Geld von Hubert von Wellentin bekommen hatte, war Hanna ihm aus dem Weg gegangen. Und jetzt starrte sie trübsinnig in das Weinglas, das leer vor ihr auf dem Tisch stand. Sie hatte ein einfaches Lokal aufgesucht, nachdem sie Kati mit Frau von Wellentin gesehen hatte, und war eben zu der Erkenntnis gekommen, dass sie das Geld, das ihr noch geblieben war, besser einteilen musste.
»Na, Hanna, auch wieder im Lande?«, sagte plötzlich eine dröhnende Stimme neben ihr. Es war Rudolf Schneider, ein Mann wie ein Schrank, groß, stark, mit borstigen graumelierten Haaren und einem breiten Gesicht, das große Willensstärke verriet.
»Setz dich doch«, sagte sie, aber er war schon dabei, sich zu setzen. Danach musterte er aus engen Augen ihre elegante Kleidung.
»Dann stimmt es also, dass Wellentin dir einen Haufen Geld für das Kind gegeben hat?«, brummte er.
Dieser Ton behagte ihr nicht. »Was geht es dich an?«, fragte sie barsch.
»Natürlich nichts. Du kannst machen, was du willst. Waren es wirklich fünfzigtausend?«
Sie presste die Lippen zusammen. »Das ist meine Angelegenheit«, erwiderte sie unwillig.
»Ich frage mich nur, warum du dich noch hier blicken lässt«, brummte er.
»Vielleicht, um mit dir zu reden, weil ich sonst niemanden habe«, stieß sie hervor.
»Na, dann rede doch«, munterte er sie auf. »Geld allein macht wohl auch nicht glücklich? Oder hast du schon alles verjubelt? Danach, wie du aussiehst, könnte man es annehmen. Hanna, kommst du denn nie zur Vernunft? Dein Kind ist gut untergebracht. Besser könnte es der Kleinen gar nicht gehen. Die Wellentins sind ganz vernarrt in sie, das weiß jeder. Du taugst so wenig zur Mutter wie ich zum Vater. Na, glücklicherweise sind meine Kinder jetzt schon aus dem Gröbsten heraus.«
»Was machen sie denn?«, erkundigte sie sich beiläufig.
»Sie sind ganz tüchtig. Der Karl hat seine Schlosserlehre beendet, und Wilma ist Verkäuferin. Sie verdienen ihr Geld und versorgen sich selbst.«
»Und du hast immer noch nicht wieder geheiratet?«, bemerkte sie. »Du musst doch jetzt eine ganz gute Stellung haben.«
»Bin zufrieden. Viel unterwegs ist man ja, aber verdienen kann man bei den Montagen auch ganz anständig. Ich bin jedenfalls zufrieden, aber du bist es anscheinend nicht mit all dem Geld. Fang doch was Ordentliches damit an. Oder überleg es dir noch mal, Hanna, denn die Jüngste bist du doch jetzt auch nicht mehr. Heirate mich, ich traue mir schon zu, dass ich dich noch umkremple und eine vernünftige Frau aus dir mache. Du brauchst eine feste Hand.«
»Du bildest dir allerhand ein«, murrte sie.
»Na, aufdrängen will ich mich nicht, aber vielleicht hast du doch ein bisschen Verstand. Über die Liebe machen wir uns doch wohl beide keine Illusionen mehr. Ich habe genug Frauen kennengelernt, die schlimmer waren als du und die es besser verstanden, die Männer auszunutzen. Du zahlst doch immer drauf.«
»Nun, einmal habe ich jedenfalls nicht draufgezahlt«, erwiderte sie aggressiv.
»Aber da hattest du auch was einzusetzen, was einem andern wertvoll war: die Kati. Du hast doch nicht etwa die Absicht, dem Kind das Leben zu zerstören?« Mit seiner kräftigen Hand packte er ihren Arm, dass sie einen leisen Schmerzensschrei ausstieß. »Lass die Finger davon, Hanna. Wenn du so was vorhaben solltest, wären alle gegen dich. Ich auch. Aber wenn du dir alles mal durch den Kopf gehen lässt, dann kannst du ruhig zu mir kommen. Und gib dein Geld nicht so leichtsinnig aus.«
»Bist du auch scharf darauf?«, fragte sie wütend.
»Scharf nicht gerade, aber es ist immer gut, wenn man was im Rücken hat. Die Liebe ist schnell dahin, das wirst du ja schon selber gemerkt haben. Vor allem, wenn man nichts zu beißen hat. Ich bin ja auch kein Hungerleider. Aber ich muss noch immer hart arbeiten und am Drücker bleiben. Man muss fürs Alter vorsorgen. Es kommt schneller, als man denkt.«
Daran dachte Hanna Ebert, als sie sich von ihm verabschiedet hatte. Wenn seine Worte auch nicht gerade sanft tönten, ehrlich meinte er es wohl doch. Und wenn man so oft enttäuscht worden war wie sie, dann fühlte man es, wenn es jemand ehrlich meinte. Aber noch hatte Hanna andere Ideen. So begehrenswert war Rudolf Schneider nun auch wieder nicht, und ein Honigschlecken würde ein Leben mit ihm auch nicht sein. Immerhin hatte sie doch noch etwa zwanzigtausend Euro, die sie noch vermehren konnte, wenn sie es schlau anfing.
*
Irene von Wellentin fühlte sich in ihrem Haus wieder einmal unsicher, und Katis Unruhe trug noch dazu bei. Immer hockte sie in ihrem Zimmer, nie ging sie in den Garten, obgleich nun herrlicher Schnee gefallen war. Oft stand sie am Fenster und blickte ängstlich auf die Straße. Verreisen konnten sie jetzt nicht, denn es waren keine Ferien, und Hubert von Wellentin meinte auch, dass man nicht dauernd davonlaufen könnte.
Irene von Wellentin fasste schließlich den Entschluss, mit Kati nach Sophienlust zu gehen, aber Denise schlug ihr daraufhin vor, nach Schoeneich zu kommen.
Die beiden Frauen verstanden sich jetzt ausnehmend gut, und in Sophienlust waren im Augenblick einige Umstellungen nötig, da Ediths Hochzeit heranrückte. Jetzt waren ja nur noch elf Kinder ständig im Heim, und mit dieser kleinen Zahl konnte man leicht zurechtkommen, ohne die zarte Roli zu sehr einspannen zu müssen.
Mit den Kindern hatte man eigentlich kaum Sorgen. Sie waren alle glücklich und zufrieden. Nur Marco verfiel manchmal in seine Melancholie, denn er glaubte noch immer daran, dass seine Eltern eines Tages kommen würden, um ihn nach Hause zu holen. Und niemand brachte es übers Herz, dem kleinen Kerl zu erklären, dass seine Eltern tot und begraben waren wie die Großmama Wellentin.
»Sie sind bestimmt nur ganz, ganz weit fort und brauchen lange, bis sie wieder heimkommen«, sagte er eben wieder. »Ich träume doch jede Nacht von ihnen und weiß ganz genau, wie sie aussehen. Mutti hat schönes blondes Haar. Es ist richtig silbrig, und sie sieht aus wie ein Engel. Und Vati ist groß und stark und trägt mich immer auf den Schultern.«
Roli, die sich viel mit ihm beschäftigte, wurde es manchmal ganz unheimlich, wenn er so sprach. Sie konnte sich die beiden Menschen, von denen er träumte, so richtig vorstellen, aber sie wusste ja, dass es sie nicht wirklich gab.
»Tante Claudia sagt, wenn man sich etwas ganz fest wünscht, dann geht es auch in Erfüllung. Zu Weihnachten habe ich mir das Feuerwehrauto gewünscht, und ich habe es auch bekommen.«
»Den Wunsch hat dir das Christkindchen erfüllt«, sagte Roli rasch.
»Dann hätte ich mir vom Christkind wünschen sollen, dass Mutti und Vati kommen«, schluchzte Marco in sich hinein. »Das hat mir keiner gesagt.«
Und keiner hätte ihm den Wunsch erfüllen können, dachte Roli betrübt und nahm ihn tröstend in die Arme.
»Wir haben dich doch alle so lieb, Marco. Wir würden dich sehr vermissen.«
»Die Zwillinge hatten wir auch lieb, aber so sehr vermissen wir sie gar nicht.« Er starrte verloren zum Fenster hinaus.
*
Hanna Ebert wollte nicht mehr an Rudolf Schneiders mahnende Worte denken. Sie wollte die innere Stimme, die sie mahnte, auf ihn zu hören, zum Schweigen bringen und suchte ein Tanzlokal auf.
Es war ein teures Lokal, doch in ihrem eleganten Kleid fiel sie nicht unangenehm auf. Sie hatte auch bald einen Tänzer, der recht gut aussah und auch nicht den Eindruck machte, als suche er eine zahlungsfähige Partnerin. Er wollte sich ganz einfach mal amüsieren und gab das auch zu. Er war auf einer Geschäftsreise, und bestimmt war er verheiratet, wenngleich er keinen Ring trug. Hanna hatte einen Blick dafür bekommen. Aber was machte es ihr aus. Sie kam wenigstens mal wieder auf andere Gedanken, denn er war auch nicht kleinlich, sondern führte sie später noch in eine elegante Bar. Und dort wurde sie ganz zufällig Zeugin eines Gesprächs, das sie aufhorchen ließ.
Zwei gut gekleidete Männer mittleren Alters saßen an der Bar neben ihnen. Hannas Begleiter hatte schon ziemlich viel getrunken und geriet in eine rührselige Stimmung, für die die erfahrene Bardame mehr Verständnis zeigte als Hanna, die gespannt der Unterhaltung der beiden Herren lauschte.
»Wenn ich nur wüsste, wie Ingrid zu helfen wäre, Bob«, sagte der große, breitschultrige Mann zu seinem Nachbarn. »Sie verwindet Marcs Tod einfach nicht. Sie verzweifelt noch an ihren Selbstvorwürfen. Mein ganzes Vermögen würde ich geben, wenn ich das Kind lebendig machen könnte.«
Hanna warf ihm einen abschätzenden Blick zu. Er sah recht vermögend aus, und es ging um ein Kind. Ob sie noch mehr erfahren konnte? Hellwach war sie plötzlich.
»Aber ihr habt doch noch Daniel und Evelyn«, sagte der andere nun. »Schließlich ist es nicht so, dass Marc euer einziges Kind war.«
»Aber er war der Kleine, und du weißt ja, wie das ist. Sie hatte ihn immer um sich. Sie hat ihn abgöttisch geliebt und kann sich nie verzeihen, dass sie ihn diese beiden Tage allein ließ, um mich nach Brüssel zu begleiten. Und ausgerechnet da musste es passieren.« Er machte eine kleine Pause und seufzte schwer. »Und sie kann es auch Dan und Evi nicht verzeihen, dass sie nicht besser auf ihn aufpassten. Aber wer misst der Tatsache, dass sich ein Kind an einem rostigen Nagel ritzt, schon eine Bedeutung bei. Wer glaubt denn daran, dass man daran sterben kann. Ingrid zermürbt sich und uns. Aber ich kann Marc nicht lebendig machen. Mein Gott, ich leide auch darunter, aber …« Er brach ab und versank in Schweigen. »Ich fürchte, Bob«, sagte er nach einer Weile, »Ingrid wird gemütskrank. Immer, wenn sie ein Kind sieht, das ihm auch nur annähernd gleicht, bekommt sie einen Nervenzusammenbruch.«
»Dann such doch ein Kind, das ihm gleicht. Es gibt doch so viele Waisenhäuser«, brummte der andere.
»Sie will unser Kind, unseren Marc, begreif das doch! Und schließlich ist sie deine Schwester, Bob. Du kennst sie doch.«
»Gut«, sagte der Mann, der Bob genannt wurde, »sie hat einen Schuldkomplex, den sie auch auf Dan und Evi ausdehnt. Sie hat außerdem einen Mutterkomplex, das ist mir bekannt. Vielleicht geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass sie Marc bekommt, sondern irgendein Kind, dem sie all die Liebe geben kann, die sie Dan und Evi augenblicklich nicht geben will. Mit sechzehn und siebzehn haben die Kinder ja auch schon andere Vorstellungen. Jedenfalls dürfen wir nichts unversucht lassen.«
Die beiden versanken in Schweigen und tranken ihren Whisky. Hanna aber hielt es nun für richtig, sich einzumischen. Ganz plötzlich war ihr die Idee gekommen, eine glänzende Idee, wie sie, schon selbst nicht mehr ganz nüchtern, meinte.
»Entschuldigen Sie bitte, mein Herr«, sagte sie zu dem hochgewachsenen Mann an ihrer Seite, »zufällig hörte ich Ihre Unterhaltung an. Vielleicht kann ich Ihnen helfen.«
Zwei kluge graue Augen starrten sie befremdet und abschätzend an. »Helfen?«, fragte der Mann mit schwerer Stimme. »Wie meinen Sie das?«
»Sie sprachen über ein Kind, und ich kann Sie gut verstehen, denn auch ich habe ein Kind hergeben müssen.« Es gelang ihr, ihrer Stimme einen wehmütigen Klang zu geben, als sie hinzufügte: »Aber das ist wohl nicht der richtige Ort, sich über solche Dinge zu unterhalten.«
Der Blick des Mannes gab ihr deutlich zu verstehen, wie er sie einschätzte. Er vermutete einen ungewöhnlichen Annäherungsversuch und schwieg.
Hanna fuhr fort: »Ich will mich gewiss nicht aufdrängen, aber was ich ungewollt hörte, hat mich sehr erschüttert.«
»Warum sollen wir uns nicht anhören, was sie zu sagen hat, Henning«, meinte jetzt Bob. »Es ist doch egal, wie wir die Zeit totschlagen.«
*
Nun saßen sie in einer stillen Ecke eines Weinlokals, in dem sich nur noch wenige Gäste aufhielten. Hannas Kavalier war an der Bar zurückgeblieben. Er war schon so benebelt gewesen, dass er ihr Weggehen gar nicht mehr bemerkt hatte.
In aller Eile hatte Hanna sich eine rührselige Geschichte zurechtgelegt. So einfach, wie sie es sich vorgestellt hatte, war es gar nicht, denn sie sagte sich, dass sie Kati unmöglich ein zweites Mal verschachern könne. Aber in Sophienlust gab es doch noch mehr Kinder. Und wenn sie es geschickt anfing und auch noch Druck auf die Wellentins ausübte, konnte dabei vielleicht doch noch etwas für sie herausspringen.
Nur war Henning van Droemen allerdings ein Mann, den man nicht so leicht überzeugen konnte. Zwar hatte er sich geduldig angehört, wie man Hanna Ebert ihrer Tochter sozusagen beraubt hatte, aber die Geschichte kam ihm doch ziemlich unwahrscheinlich vor.
»Ihr Kind war also in diesem Heim untergebracht«, stellte er bedächtig fest. »Und Sie befanden sich in Australien.«
Hanna nickte, und es gelang ihr, ein paar Tränen hervorzupressen. »Man hat es mir entfremdet«, seufzte sie.
»Aber was hat das alles nun mit meiner Geschichte zu tun, der Sie ein so großes Interesse zukommen lassen?«, fragte er zurückhaltend.
»Sie sagten, dass Sie Ihr ganzes Vermögen opfern würden, wenn Sie Ihrer Frau das Kind zurückgeben könnten. Ich brauche Geld, um mein Kind zurückzuholen. Ich brauche einen Anwalt.«
»Zu Diensten«, sagte Robert Quirin spöttisch. »Ich bin Anwalt.«
Er hatte sie bereits durchschaut. Sie wollte ein Geschäft machen, aber sie war diesem Geschäft nicht gewachsen. Ihre Intelligenz reichte nicht aus. Immerhin war es dennoch ganz interessant, ihr zuzuhören.
»In Sophienlust gibt es viele Kinder, die keine Eltern haben«, fuhr Hanna jetzt überstürzt fort. »Wenn Sie nun dort eines finden würden, das Ihrem Sohn ähnlich sieht, und wenn ich vermitteln würde, dass Sie es bekommen, würde dann für mich dabei auch etwas herausspringen?«
Nun hatte sie die Katze aus dem Sack gelassen und war auch wieder in die Sprache zurückgefallen, die ihr vertraut war.
Henning van Droemen sah seinen Schwager an. Eine Verrückte, sagte sein Blick. Doch Robert Quirin sah es anders. Er sah es richtig. Sie will Geld, dafür begibt sie sich aufs Glatteis, und sie wird ganz gehörig auf die Nase fallen.
»Man könnte sich darüber unterhalten«, meinte er leichthin. »Sie haben uns sehr aufmerksam zugehört, Frau … Wie ist doch Ihr Name?«
Hanna Ebert hatte einen lichten Moment. »Das spielt im Augenblick noch keine Rolle«, erwiderte sie rasch. »Ich muss ja auch meine Interessen wahren.«
»Dafür stelle ich mich als Anwalt gern zur Verfügung«, bemerkte Robert Quirin hintergründig.
Hanna überlegte. »Kann ich Sie morgen sprechen?«, fragte sie.
Wieder tauschten die beiden Männer einen Blick, dann nahm Robert Quirin eine Karte aus seiner Brieftasche. »Sie können mich im Hotel erreichen«, erklärte er zur Überraschung seines Schwagers.
Hanna nickte mechanisch. »Dann kann ich Ihnen mehr sagen«, murmelte sie.
*
»Du nimmst dieses Geschwätz doch nicht ernst?«, sagte Henning van Droemen zu seinem Schwager, nachdem sie Hanna Ebert in ein Taxi verfrachtet hatten.
»Ernst genug. Diese Frau führt etwas im Schilde, was annähernd kriminell sein dürfte. Als Vertreter des Rechts sehe ich mich veranlasst, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und sei es nur, um andere vor einer Erpressung zu schützen. Morgen wird sie nüchtern sein und mag es sich anders überlegt haben. Vielleicht aber auch nicht. Immerhin, Henning, sie sprach von einem Kinderheim, und wir überlegten doch vorhin, wie Ingrid zu helfen sei. Sophienlust – das gehört doch den Wellentins.«
»Ach, das ist alles Unsinn«, meinte Henning van Droemen wegwerfend. »Sinnlos vergeudete Zeit.«
»Vielleicht doch nicht. Du weißt doch, dass ich eine besondere Vorliebe für geheimnisvolle Fälle habe. Irgendetwas steckt dahinter, das sagt mir mein kleiner Finger.«
»Ich will Ingrid helfen, sonst nichts«, knurrte der andere. »Aber man soll eben nicht so intime Dinge an der Bar besprechen.«
»Wer weiß, wozu es gut ist. Ich bin gespannt, ob sie noch aufkreuzt.«
»Dann musst du allein mit ihr fertig werden. Ich fliege morgen zurück.«
»Und ich werde die Verhandlungen mit Wellentin zum Abschluss bringen und ihn ein wenig aushorchen.«
*
»Ich fahre nach Sophienlust«, sagte Denise zu ihrem Mann. »Überarbeite dich nicht.«
»Es scheint mir fast, als würdest du dich als Ehefrau schon ziemlich langweilen«, brummte er. »Du warst doch erst gestern dort.« »Aufregungen schaden einer werdenden Mutter, vergiss das nicht.«
»Ich vergesse es nicht«, versprach sie. »Ich hole dann die Kinder von der Schule ab.«
»Ist nicht nötig. Ich bringe sie mit. Ich muss doch in die Fabrik. Dieser Dr. Quirin will doch heute den Vertrag abschließen, und Hubert möchte, dass ich dabei bin.«
»Worum geht es da eigentlich?«, fragte Denise.
»Um die neue Siedlung.«
»Da werden wir ja bald eine Stadt«, seufzte Denise. »Hätten wir das Land nicht aufkaufen können?«
»Wozu, Liebes? Außerdem hätten sie es uns nicht verkauft.«
»Bisher waren es Wiesen und Felder, und nun wollen sie Siedlungen bauen«, meinte sie betrübt.
»Das ist der Zug der Zeit. Wir können uns nicht davor verschließen. Die kleinen Bauern können nicht existieren. Sie verdienen in der Fabrik mehr. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Und mir reicht das Land, das wir bewirtschaften müssen. Das Stück, das wir hergeben, wirft sowieso nichts ab.«
Er gab ihr einen zärtlichen Kuss und zog ihr das Pelzkäppchen weiter über die Ohren. »Damit du dich ja nicht erkältest«, meinte er besorgt.
»Im Auto ist es ja warm und in Sophienlust auch«, lächelte sie.
*
Kaum in Sophienlust eingetroffen, musste Denise unwillkürlich an Kati denken, die zwischen zwei Müttern stand. Der einen, die um sie zitterte, und der anderen, die Kapital aus ihr geschlagen hatte.
Diese Gedanken musste ihr ein fremder Wille aufgezwungen haben, denn kurz darauf stand Hanna Ebert vor ihr.
Sehr selbstsicher trat sie auf.
»Ich wollte Frau von Wellentin aufsuchen, aber ich habe sie nicht in ihrem Haus angetroffen«, eröffnete sie das Gespräch. »Wo ist Kati?«
Denise hatte sich schnell gefasst. »In der Schule«, erwiderte sie kühl. »Was bezwecken Sie, Frau Ebert?«
»Ich habe es mir anders überlegt. Ich will Kati zurückhaben.«
»Ich bin zwar nicht berechtigt, mich einzumischen, aber ich nehme an, dass Sie dann auch bereit sind, die fünfzigtausend Euro zurückzuzahlen?«, entgegnete Denise kühl.
»Selbstverständlich«, erwiderte Hanna Ebert zu Denises Entsetzen. »Es sei denn«, sie unterbrach sich und ließ ihren Blick aus dem Fenster schweifen zu dem schneebedeckten Rasen, auf dem die Kinder lachend herumtollten, »wir könnten eine Einigung erzielen.«
»Wir?«, fragte Denise gedehnt. »Das wäre wohl Angelegenheit meiner Schwiegereltern.«
»In diesem Fall auch Ihre«, erwiderte Hanna Ebert überheblich. »Ich denke, dass wir uns im gegenseitigen Interesse einigen werden, Frau von Schoenecker.«
*
Dr. Robert Quirin setzte seine Unterschrift unter den Vertrag, den Hubert von Wellentin und Alexander von Schoenecker gegenzeichnete.
»Das wäre also erledigt«, sagte er dann mit einem zufriedenen Lächeln. »Wir werden bald mit dem Bau beginnen. Ich hätte jetzt noch eine persönliche Frage an Sie zu richten, Herr von Wellentin.«
»Bitte«, kam die knappe Erwiderung. Hubert von Wellentin wusste genau, dass er in Dr. Quirin ein Gegenüber hatte, bei dem man sich jedes Wort überlegen musste.
»Durch Zufall hörte ich, dass Ihr Besitz Sophienlust jetzt ein Kinderheim ist.«
»Es war der Besitz meiner Mutter«, erklärte Hubert von Wellentin gelassen. »Übrigens ist Sophienlust unverkäuflich, wenn Sie darauf hinauswollen. Herr von Schoenecker wird es bestätigen. Er ist der Gatte meiner Schwiegertochter Denise, und diese ist wiederum die gesetzliche Vertreterin meines Enkels, dem Sophienlust gehören wird.«
»Ich will Sophienlust nicht kaufen«, erwiderte Dr. Quirin mit einem verbindlichen Lächeln. »Es interessiert mich aus anderen Gründen. Wenn ich Ihnen diese auseinandersetzen dürfte?«
Hubert von Wellentin warf Alexander von Schoenecker einen vielsagenden Blick zu, doch dieser blickte unruhig auf die Uhr.
»Ich muss die Kinder von der Schule abholen, Hubert«, sagte er. »Es tut mir leid, wenn ich mich verabschieden muss. Die Zeit drängt.«
»Wenn Sie mir noch zehn Minuten opfern könnten, Herr von Wellentin?«, sagte Dr. Quirin höflich, als Alexander gegangen war.
Hubert von Wellentin hätte sich gern gedrückt, aber die gesellschaftlichen Formen geboten es, dass er sich Dr. Quirins Anliegen anhörte. Das sollte er allerdings nicht bereuen.
»Hanna Ebert«, ächzte er bald darauf. »Es kann sich nur um sie handeln. Wissen Sie, dass Sie mir eben einen riesengroßen Gefallen getan haben, Herr Dr. Quirin?«
Der Rechtsanwalt konnte sich ein leises Triumphgefühl nicht versagen. Siehst du, Henning, mein Riecher hat mich doch nicht getäuscht, dachte er. Es steckt viel mehr dahinter als anzunehmen war.
»Offenheit gegen Offenheit«, sagte Herr von Wellentin, »es geht um Kati. Zugegeben, sie ist Hanna Eberts Tochter, aber doch nur, weil sie sie geboren hat. Jetzt ist sie unser Kind, und wir werden sie nicht mehr hergeben, und wenn es mich mein ganzes Vermögen kostet.«
»Solche Worte habe ich gestern schon einmal aus dem Munde meines Schwagers vernommen«, erwiderte Dr. Quirin. »Auch er wäre bereit, sein ganzes Vermögen zu opfern, um seiner Frau ihr Kind wiederzugeben. Aber dieses Kind ist tot. Man kann nicht mehr darum kämpfen. Sie haben einen Vorteil, Herr von Wellentin. Das Kind, um das es Ihnen geht, lebt. Aber meine Schwester, Henning van Droemens Frau, hat ihren jüngsten Sohn verloren. Wegen eines lächerlichen rostigen Nagels musste er sterben, und sie richtet sich mit Selbstvorwürfen zugrunde. Wir haben diese Hanna Ebert für verrückt gehalten – verrückt aus Geldgier – vielleicht aber auch nur für sinnlos betrunken. Jetzt bekommt alles ein anderes Gesicht.«
»Und vielleicht geht auch meine Frau daran zugrunde«, stöhnte Hubert von Wellentin auf und ging mit schweren Schritten zum Fenster.
Seine Finger trommelten auf die Scheiben. »Fünfzigtausend Euro habe ich ihr gegeben. Bar auf die Hand«, rang es sich von seinen Lippen. »Die Adoption bereitet uns Schwierigkeiten, weil der Vater erst für verschollen erklärt werden muss. Herrgott, ich bin ja bereit zu zahlen, wenn sie uns das Kind lässt. Dieses Satansweib …«, er stockte und stöhnte laut auf, »wie sagt man doch: Wenn man vom Teufel spricht …«
Er schwankte, und schnell trat Dr. Quirin an seine Seite, um ihn zu stützen. Auch er sah, was diesen Mann um die letzte Fassung brachte. Er sah Hanna Ebert, die durch das Fabriktor trat. Doch im selben Augenblick ging mit raschen Schritten ein Mann auf sie zu.
»Schneider«, murmelte Hubert von Wellentin, »was hat Schneider mit ihr zu schaffen?«
*
»Was machst du hier, Hanna?«, fragte Rudolf Schneider rau.
»Was geht dich das an?«, fragte sie zornig zurück.
»Eine ganze Menge. Hast du vergessen, dass hier jeder jeden kennt? Man munkelt so allerlei. Was führst du im Schilde, Hanna? Heraus mit der Sprache!«
»Lass mich los, du tust mir weh«, fauchte sie ihn an.
»Vielleicht hat man dir bisher noch nicht genug wehgetan«, gab er zurück. »Willst du dich um Kopf und Kragen bringen, du dummes Schaf?«
Sie starrte ihn an. »Was soll das heißen?«, fragte sie stockend.
»Dass wir zwei mal ganz ernsthaft miteinander reden müssen, bevor du in Teufels Küche gerätst. Ich weiß selber nicht, weshalb ich solchen Narren an dir gefressen habe, aber ich will nicht, dass du dich vollends ruinierst. Los, komm mit!«
»Kannst du denn jetzt weg während der Arbeitszeit?«, fragte sie tonlos.
»Ich bin kein Arbeiter. Ich bin Obermonteur«, erwiderte er selbstbewusst. »In ein paar Tagen bin ich wieder außer Landes, und wenn du noch einen Funken Verstand hast, dann kommst du mit mir, damit du aus diesem Dilemma herauskommst. Die machen dich fertig, Hanna, wenn du den Wellentins Kati wegnehmen willst. Verstehst du? Der ganze Ort ist gegen dich. Alle passen auf, dass du nur ja nicht in die Nähe des Kindes kommst.«
»Du redest zu viel«, stieß sie hervor.
»Und du willst zu viel«, herrschte er sie an und zerrte sie mit sich fort. Sie kam erst richtig wieder zu sich, als sie in seinem Auto saß.
»Wohin bringst du mich?«, fragte sie noch immer störrisch.
»Zuerst mal in meine Wohnung. Und wenn ich dir gesagt habe, was gesagt werden muss, werden wir weitersehen.«
Gemütlich war seine Wohnung nicht, man merkte, dass die Frau fehlte. Alles war nüchtern und schmucklos. Aber es war sauber.
»Setz dich und erzähl. Ich will es aus deinem Munde hören«, sagte er heiser.
Sie schluckte ein paar Mal. »Es wird schon so sein, wie die andern reden«, stieß sie dann hervor. »Du verschwendest deine Zeit, Rudolf.«
»Herrgott im Himmel«, stöhnte er, »einer muss dich doch zur Räson bringen. Du warst doch nicht immer so. Hübsch warst du eben und hast dir weiß Gott was darauf eingebildet. Aber jetzt kommen die Falten. Schau doch mal in den Spiegel, Hanna, und sei ehrlich mit dir. Willst du im Gefängnis landen?«
*
»Sie haben alles begriffen, Herr
Dr. Quirin?«, fragte Hubert von Wellentin resigniert. »So stehen die Dinge.«
»Es gibt für Sie keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen«, meinte der Jüngere zuversichtlich. »Vielleicht bringt dieser energische Mann sie zur Vernunft. Es sei denn, Sie entlassen ihn.«
»Ich werde ihn erst einmal anhören müssen.«
»Und ich werde nach Sophienlust fahren«, erwiderte Dr. Quirin freundlich. »Ich möchte es mir einmal ansehen.«
In Sophienlust hatte man von dieser Unterredung keine Ahnung. Alexander von Schoenecker war doch mit beträchtlicher Verspätung bei der Schule angekommen, und so waren die Kinder bereits mit dem roten Bus nach Sophienlust gefahren.
Selbstverständlich war auch Kati dabei, und damit Irene von Wellentin sich nicht ängstigte, hatte man sie gleich in Schoeneich angerufen.
Für die Kinder gab es jetzt vieles für Ediths Hochzeit vorzubereiten. Sie knüpften gemeinsam an einem Teppich und entwickelten dabei eine bemerkenswerte Geschicklichkeit. Auch die Jungen waren ganz bei der Sache, nur Marcos kleine Finger waren noch sehr ungeschickt, und so kam er sich wieder einmal überflüssig vor.
Für Denise war das wieder einmal ein aufregender Tag, und er sollte noch aufregender werden.
Edith war mit Bert Wolfram in die Stadt gefahren, um noch einige Möbel auszusuchen, und Alexander, der sich überzeugt hatte, dass die Kinder auch ohne sein Dazutun wohlbehalten in Sophienlust angekommen waren, berichtete seiner Frau gerade ausführlich über die Verhandlungen, die erfolgreich zum Abschluss gebracht worden waren, als Dr. Quirin eintraf.
»Nanu, was will er denn hier?«, rief Alexander erstaunt aus. »Will er dir jetzt auch noch Sophienlust abschwatzen?«
Denise wusste zunächst nicht, was er meinte, aber als er es ihr rasch erklärte, lachte sie.
»Das wird niemandem gelingen«, sagte sie. »Und dabei hätte Dominik ja auch noch ein Wörtchen mitzureden.«
Aber jetzt war Dr. Robert Quirin nur Privatmann, und für einen Junggesellen, als den er sich sofort zu erkennen gab, zeigte er ein ungewöhnliches Interesse an Kindern.
Alexander und Denise, die ja beide noch keine Ahnung von seinen Beweggründen hatten, tauschten manchmal erstaunte Blicke miteinander, weil er sich so eingehend über die einzelnen Kinder informierte. Wie alt sie wären, welcher Herkunft und wie sie nach Sophienlust gekommen wären.
»Tante Isi, wir brauchen neue Wolle!« Mit diesem Ausruf kam Kati unbefangen ins Wohnzimmer. Verlegen wich sie zurück, als sie den Fremden gewahrte, von dessen Anwesenheit sie nichts gewusst hatte.
»Das ist also Kati«, stellte Dr. Quirin fest, als Denise mit dem Kind den Raum verlassen hatte.
Verblüfft sah ihn Alexander an. Dr. Quirin lächelte. »Herr von Wellentin sprach mit mir über das Kind«, erwiderte er erklärend.
»Aber wieso das?«, fragte Alexander von Schoenecker bestürzt.
»Es ist eine verwickelte Geschichte. Ich denke, dass Herr von Wellentin sie Ihnen erzählen wird, wenn sich die Dinge geklärt haben. Ich bin ganz zufällig hineingeraten, aber vielleicht war es doch mehr Bestimmung, wenn man alles insgesamt betrachtet. Darf ich mir die Kinder jetzt einmal ansehen?
Sie haben wirklich alles, was sie sich nur wünschen können«, meinte Dr. Quirin gedankenvoll.
»Ich habe nicht geglaubt, dass es ein solches Kinderheim geben könnte, und ich möchte gar zu gern die ganze Geschichte dieses Heimes erfahren …« Er stockte, denn draußen rief jemand laut: »Marco, du sollst doch nicht ohne Jacke hinausrennen.«
»Will mir nur das Auto angucken«, erwiderte der Kleine. »Wer ist denn jetzt gekommen?«
»Das ist zurzeit der Jüngste hier«, erklärte Alexander, aber Dr. Quirin eilte schon an ihm vorbei auf den Jungen zu.
Kopfschüttelnd blickte Alexander ihm nach. Ein wenig merkwürdig war Dr. Quirins Benehmen schon. Erst all diese Fragen – und nun dieses intensive Interesse an Marco.
Die fürsorgliche Roli brachte Marcos Janker. Sie war eine Sekunde früher bei dem Jungen als Dr. Quirin.
»In so einem Auto werden auch mal meine Mutti und mein Vati kommen«, hörte er Marco sagen. »Ich habe es geträumt.«
An diese Träume glaubte Roli zwar nicht so recht, aber warum sollte man Marcos Phantasie Einhalt gebieten, wenn er dabei glücklich war?
»Es ist mein Auto«, sagte Dr. Quirin. »Möchtest du mal damit fahren?«
Marco warf ihm einen abschätzenden Blick zu. »Das darf ich nicht. Ich warte auch lieber, bis meine Mutti mit ihrem Auto kommt. Aber sie kommt bestimmt, wenn es auch keiner glaubt.«
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte Roli. »Er denkt sich so viel aus.« Sie nahm den Jungen bei der Hand. »Komm, Marco, du kannst in den Wintergarten gehen und mit Petra spielen.«
Aber Marco wollte nicht. »Kommst du von weit her?«, fragte er Dr. Quirin.
»Ziemlich weit.«
»Die Welt ist sehr groß, nicht wahr, und wenn man am anderen Ende ist, dauert es lange, bis man hierherkommt. Wie lange hast du gebraucht?«
»Sehr lange«, erwiderte Dr. Quirin impulsiv.
Die dunklen Augen des Kindes waren fragend auf ihn gerichtet. »Meine Mutter ist sehr schön. Sie hat ganz silberblondes Haar und sieht aus wie ein Engel. Hast du sie vielleicht schon mal gesehen?«
Robert Quirins Herzschlag stockte.
Ingrid hatte silberblondes Haar, und er selbst hatte sie einmal mit einem Rauschgoldengel verglichen, damals, als sie noch glücklich war mit dem kleinen Marc.
Marc – Marco – spricht über eine blonde Frau, auf die er wartet. Dem nüchternen Rechtsanwalt wurde ganz heiß.
»Ja, ich glaube, dass ich sie schon mal gesehen habe«, erwiderte er mechanisch.
Ein glückliches Leuchten kam in die dunklen Kinderaugen. »Vielleicht siehst du sie noch einmal. Sagst du ihr dann, dass ich so auf sie warte? Hast du meinen Vater vielleicht auch gesehen?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte Dr. Quirin, dem es nun doch ein wenig unheimlich wurde.
»Komm, Marco«, drängte Roli, der das Gespräch peinlich war.
Marco sah den Fremden noch einmal an. »Sie glauben mir alle nicht, dass meine Eltern auch kommen werden«, sagte er ernsthaft. »Aber ich träume jede Nacht davon.«
Dann folgte er Roli gehorsam, und Denise kam zurück. »Unser kleine Träumer«, sagte sie mit einem liebevollen Ausdruck. »Es ist schlimm, wenn man Kindern so sehnsüchtige Wünsche nicht erfüllen kann. Er wartet so sehr auf seine Eltern, aber sie sind tot. Und keiner bringt es fertig, ihm seine Illusionen zu rauben.«
»Gnädige Frau, halten Sie mich bitte jetzt nicht für verrückt, aber vielleicht kann ihm dieser Wunsch doch erfüllt werden. Darf ich mit Ihnen ganz offen darüber sprechen, was mich hierher nach Sophienlust geführt hat?«
*
»Guter Gott«, seufzte Denise, als Dr. Quirin sich verabschiedet hatte. »Was kommt heute noch alles zusammen? Hast du alles begriffen, Alexander?«
»Mir brummt der Schädel. Ruf die Kinder zusammen. Wir fahren heim. Du hast dir viel zu viel zugemutet, Liebes. Seit diese Geschichte mit den Zwillingen passiert ist, sind wir alle ein bisschen durcheinander. So etwas wiederholt sich doch nicht. Marco ist ein sensibles Kind, und diese Frau van Droemen ist doch allem Anschein nach gemütskrank.«
»Vielleicht wird ihr geholfen – und Marco auch.«
»Du hoffst immer auf das Gute, aber ich bin froh darüber, dass du so bist, mein Geliebtes. Wo wäre ich denn ohne dich und ohne deinen Glauben und die Liebe?«
»Es kommt alles, wie es Gott bestimmt. Früher habe ich das so dahingesagt, jetzt ist es mir schon so oft bewiesen worden. Schau, es kann doch nicht nur ein Zufall sein, dass diese beiden Männer, die auch für uns eine Bedeutung haben, mit Hanna Ebert zusammentrafen.«
»Ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich nicht erklären lassen. Nun bin ich sehr gespannt, was sich in der Fabrik noch getan hat.«
*
»Hast du mich jetzt verstanden, Hanna?«, fragte Rudolf Schneider eindringlich. »Hast du es endlich begriffen mit deinem Spatzenhirn?«
Er hatte eine raue Sprache geführt, und sie hatte viel einstecken müssen. Ein paarmal hatte sie davonlaufen wollen, aber irgendwie war es doch in ihr Bewusstsein gedrungen, dass er in allem recht hatte.
»Ich bin weiß Gott kein zartbesaiteter Mann«, fuhr er fort. »Aber was du getan hast, ist unglaublich, und was du vorhast, ist kriminell. Eigentlich sollte ich dich deinem Schicksal überlassen. Dann kannst du hinter Gittern darüber nachdenken, was ein Mensch einfach nicht tun darf.«
»Lässt du denn kein einziges gutes Haar an mir?«, fragte sie kleinlaut.
»Das ist es ja eben. Ich suche noch immer nach Entschuldigungen für dich, sonst hätte ich dich schon längst hinausgeschmissen.«
»Du solltest vielleicht lieber wieder an deine Arbeit gehen, damit du deine Stellung nicht verlierst.«
Er packte sie bei den Schultern und schüttelte sie. »Versprichst du mir, dass du hierbleibst und auf mich wartest?«
Versprechen konnte sie es ja. Überlegen konnte sie es sich auch noch. Sie war ziemlich durcheinander, denn er hatte pausenlos auf sie eingeredet. Aber so hatte noch niemand mit ihr gesprochen, und so klar war es ihr noch nie geworden, dass er recht hatte.
Nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, sah sie sich in der Wohnung um und überlegte, wie lange er schon allein war. Vor mehr als zehn Jahren war seine Frau gestorben, erinnerte sie sich. Die Kinder hatte er allein großgezogen. Bilder hingen von ihnen an der Wand. Zwei ansehnliche Kinder waren es – nun jedoch schon erwachsen. Als Mann hatte er geschafft, was sie sich nicht zugetraut hätte.
Es war kein schönes Gefühl, ihm so unterlegen zu sein. Und er hatte sich außerdem beruflich Schritt für Schritt emporgearbeitet, bis er es zu dieser guten Position gebracht hatte.
Und sie? Innerhalb weniger Monate hatte sie Unsummen vergeudet, war dem Vergnügen nachgelaufen und hatte immer nur an sich gedacht.
Heiraten will er mich, trotz allem, überlegte sie. Er weiß, wie ich bin und was er von mir zu halten hat, und gibt dennoch nicht auf. War es nicht gut, einen Menschen zu haben, der daran glaubte, dass noch nicht alles verloren war? Dass sie wirklich noch einmal ein anständiges Leben führen könnte?
Konnte es sein? Sie versank in Grübeln. Wenn er nun ihretwegen auch noch Unannehmlichkeiten bekam.
Zum ersten Mal machte sie sich auch Gedanken um einen anderen und darum, in welche Situation sie ihn gebracht hatte.
*
Es hatte allerdings den Anschein, als wäre Rudolf Schneider in eine sehr prekäre Situation geraten. Als er in die Fabrik zurückkam, sagte man ihm, dass der Chef ihn sofort zu sprechen wünsche.
Hubert von Wellentin unterbrach sofort sein Diktat, als ihm Rudolf Schneider gemeldet wurde, und einen Augenblick schien es, als würde er sich zu einem Zornesausbruch hinreißen lassen. Aber dann sagte er ruhig: »Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Schneider. Was ich mit Ihnen zu besprechen habe, lässt sich nicht mit ein paar Worten sagen.«
Es war Rudolf Schneider während seiner langen Betriebszugehörigkeit noch nie passiert, dass ihn der Chef persönlich empfangen hatte. Der große, ungeschlachte Mann war leicht verwirrt. Schwerfällig ließ er sich auf dem angebotenen Stuhl nieder und faltete die Hände in seinem Schoß.
»Ich kann mir denken, weshalb Sie mich sprechen wollen, Herr von Wellentin. Ich habe unerlaubt die Fabrik verlassen, aber das hatte besondere Gründe. Ich werde sie Ihnen auch erklären.«
»Das möchte ich sehr hoffen, aber zuerst will ich wissen, was Sie mit Hanna Ebert zu schaffen haben.«
Rudolf Schneider drehte seine Daumen umeinander. Der Chef wusste es also schon. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Ich will sie heiraten«, stieß er hervor. »Ja, ich will sie heiraten, wenn manche auch meinen, dass sie ein Luder ist. Vielleicht ist sie auch eins, aber ich werde sie schon zurechtbiegen.«
Das wiederum hatte nun Hubert von Wellentin nicht erwartet. Er war momentan fassungslos.
»Versprechen Sie sich finanzielle Vorteile aus dieser Verbindung?«, stieß er rau hervor.
»Hanna kann ja nicht mit Geld umgehen«, meinte Rudolf Schneider ausweichend. »Natürlich ist es mir nicht unwillkommen, wenn sie ein bisschen was mitbringt. Geld kann man immer brauchen, warum soll ich das abstreiten? Aber wenn sich keiner um sie kümmert, wird sie noch ganz abrutschen, und von dem Geld wird sowieso nicht mehr viel übrig sein. Ich meine von dem Geld, das Sie ihr für Kati gegeben haben.«
»Sie wissen es?«
»Das weiß doch ein jeder, und alle wissen auch, wie Ihre Frau an Kati hängt.«
»Nicht nur meine Frau, ich auch. Und ich bin bereit, alles menschenmögliche zu tun, damit wir sie behalten können. Wollen Sie nun auch Forderungen stellen, dafür, dass Sie sich Hannas annehmen?«
Rudolf Schneiders Gesicht bekam einen grimmigen Ausdruck. »Das werden Sie doch nicht von mir denken, Herr von Wellentin? Bin ich nicht mein Leben lang ein anständiger Mensch gewesen? Ich will es auch bleiben. Ich habe Hanna ganz gehörig meine Meinung gesagt, das können Sie mir glauben. Das mit Kati, das habe ich ihr ausgeredet.«
»Das haben Sie ihr ausgeredet?«, fragte Hubert von Wellentin atemlos.
»Schandbar ist es, dass sie ihr Kind verkauft hat, hab’ ich ihr gesagt, aber zur Mutter taugt sie ohnehin nicht. Aber es war Geld genug. Und jetzt soll sie auch mal daran denken, was sie dem Kind antut, und auch Ihnen, wenn sie alles noch mal von vorne anfangen will. Und das, was sie da mit den beiden Herren geredet hat, das ist doch purer Unsinn. Ihr Verstand reicht halt nicht weit. Sie weiß ja gar nicht, in was für eine Lage sie sich da bringen kann. Wenn doch die Frauen nur nicht so viel reden würden.«
Dass er jetzt selbst wie ein Wasserfall redete, entging ihm, aber Hubert von Wellentin war ihm deshalb nicht böse. Er hatte in diesem Mann unerwartet einen Bundesgenossen gefunden, und er konnte nur hoffen, dass Rudolf Schneiders guter Wille auch zu einem Erfolg führen würde. Dafür wollte er gern noch etwas tun.
»Wenn Sie Hanna heiraten, besorge ich Ihnen eine Position, mit der Sie zufrieden sein werden, Herr Schneider. Eine, wo Sie nicht dauernd unterwegs sein müssen.«
»Damit ich immer ein Auge auf sie haben kann«, meinte Schneider mit einem verschmitzten Grinsen. »Das wäre nicht übel, und das würde ich auch annehmen. Schenken lasse ich mir nichts, ich arbeite gern.«
»Aber es wird sehr weit entfernt von hier sein«, fügte Hubert von Wellentin hinzu.
»Das wäre mir auch recht, dann käme Hanna wenigstens nicht mehr in Versuchung. Aber erst muss ich sie mal auf Nummer Sicher haben. Würden Sie erlauben, dass ich wieder heimgehe? Sie wartet dort nämlich hoffentlich«, fügte er nicht gar so zuversichtlich hinzu.
»Hoffentlich«, seufzte auch Hubert von Wellentin. »Alles Weitere können wir dann morgen besprechen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Schneider. Sie haben mir einen großen Gefallen erwiesen.«
*
Ein reizendes Kinderzimmer hatten Bert Wolfram und Edith für Petra ausgesucht. Edith gab sich noch schwärmerischen Betrachtungen darüber hin, wie hübsch es ihr Kind haben würde.
»Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Bert, dass du alles so selbstverständlich hinnimmst«, sagte sie leise.
»Ich mag nichts von Dankbarkeit hören«, brummte er. »Wir lieben uns und wir lieben unser Kind. Es wird unser Kind sein, Edith, und sie wird es niemals anders wissen, wenn sie heranwächst.«
Glücklich schmiegte sie sich in seinen Arm, als er plötzlich seine Aufmerksamkeit auf eine kleine Menschenansammlung richtete, die sich rasch unweit von ihnen gebildet hatte.
»Einen Arzt, wir brauchen einen Arzt«, rief eine aufgeregte Mädchenstimmt. »Mama …« Und in diesen aufgeregten, angstvollen Ausruf mischten sich noch zwei andere Kinderstimmen.
»Ich glaube, da werde ich gebraucht, Edith«, sagte Dr. Wolfram und eilte schnell zu der Menschenansammlung.
Eine Frau war zusammengebrochen. Totenbleich, schwer atmend lag sie am Boden, und um sie herum standen drei Kinder und sprachen flehend auf sie ein.
»Ich bin Arzt«, sagte Dr. Wolfram und bahnte sich einen Weg durch die Neugierigen, die diesem Schauspiel hilflos zusahen.
Bert Wolfram sah sofort, dass hier dringend ärztliche Hilfe nötig war. Allem Anschein nach lag eine Vergiftung vor, wie er nach einer kurzen Diagnose vermutete.
»Edith, ruf den Krankenwagen, rasch! Sie muss sofort in die Klinik«, stieß er hervor.
Die beiden kleineren Kinder, etwa fünf und sieben Jahre alt, begannen zu weinen. Das größere Mädchen hielt sich tapfer und versuchte ihrer Mutter noch Trost zuzusprechen, aber diese hatte bereits das Bewusstsein verloren.
Mit Sirenengeheul kam bald darauf der Krankenwagen angerast. Nun wich die Menschenmenge doch zurück und machte den Sanitätern Platz, die die Bewusstlose auf die Trage betteten.
»Kümmere du dich bitte um die Kinder«, sagte Bert Wolfram rasch
zu Edith. »Ich fahre mit in die Klinik.«
»Wir wollen zu Mama«, riefen die beiden Kleinen.
»Ihr müsst jetzt vernünftig sein«, sprach Edith auf sie ein. »Eure Mutter wird schon wieder gesund werden, aber jetzt dürft ihr nicht jammern.«
»Aber wo sollen wir denn hin?«, fragte das größere Mädchen. »Wir haben doch kaum noch Geld. Wir sind nur auf der ›Durchreise‹ und wollten zu unserer Tante, aber sie ist nicht da.«
»Ich nehme euch mit. Ihr werdet inzwischen gut untergebracht«, tröstete Edith die Kinder, um sie dann zu Berts Wagen zu führen, zu dem sie glücklicherweise die Schlüssel hatte, weil er froh war, wenn er mal nicht am Steuer sitzen musste.
Verschüchtert hockten die Kinder auf ihren Sitzen.
»Wie heißt ihr denn?«, fragte Edith, um sie auf andere Gedanken zu bringen.
»Thorsten«, erwiderte das größere Mädchen. »Ich bin Renate und werde fünfzehn. Das ist Fred, er ist sieben und das ist Corinna, sie ist fünf. Mama wird doch wieder gesund werden?«, fragte sie dann ängstlich. »Da sind bestimmt die blöden Krabben dran schuld, die sie gegessen hat.«
»Bestimmt«, mischte sich der Junge ein. »Ich kann das Zeug nicht leiden. Sie haben auch so komisch gerochen.«
»Ihr habt nichts davon gegessen?«, fragte Edith rasch.
»Nur Corinna, aber die hat’s gleich wieder ausgespuckt. Aber Mama hat gesagt, wir dürfen jetzt nichts mehr umkommen lassen, bis mit Vater alles wieder in Ordnung ist.«
»Was ist mit eurem Vater?«, erkundigte sich Edith. »Wo ist er?« Aber die Kinder schwiegen plötzlich, als wäre ihnen der Mund versiegelt.
»Wohin bringst du uns?«, fragte der Junge nach einer Weile misstrauisch.
»In ein Kinderheim.«
»Wir wollen aber nicht in ein Heim«, begehrten alle drei gleichzeitig auf.
»Es ist ja nur vorübergehend«, beschwichtigte Edith die aufgeregten Kinder. »Irgendwo müsst ihr doch bleiben, bis eure Mutter wieder gesund ist. Ich bin schon lange in diesem Heim beschäftigt. Es ist sehr schön. Es wird euch bestimmt gefallen.«
»Kein Heim ist schön«, sagte Renate leise. »Mama sagt, das ist das Schlimmste, was man Kindern antun kann. Deswegen haben sie uns auch immer mitgenommen, wenn Vater ins Ausland musste.«
»Pst, du sollst nichts von Vati sagen«, raunte der Junge.
Da stimmt doch etwas nicht, dachte Edith. Aber wenn sie erst Zutrauen gefasst haben, werden wir es schon herausbekommen.
Nun kamen wieder einmal Kinder nach Sophienlust, nachdem einige Zeit immer nur welche abgeholt worden waren.
Lena schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Wochenlang ist Ruhe, aber heute kommt wieder mal alles zusammen«, ächzte sie, als sie von Edith kurz unterrichtet wurde.
Frau Rennert dagegen redete nicht viel, sondern brachte die drei verstörten Kinder erst einmal in den Waschraum.
Edith rief vorsichtshalber in der Klinik an und bat darum, Dr. Wolfram zu unterrichten, dass es sich bei Frau Thorsten wahrscheinlich um eine Krabbenvergiftung handelte.
Dann musste Edith sich kurz um Petra kümmern, die ungeduldig nach ihr rief. Und danach war Frau Rennert so weit, dass Edith ein paar Worte mit ihr sprechen konnte.
»Wir werden die Kinder hierbehalten, bis die Mutter gesund ist. Da man weiß, worum es sich aller Wahrscheinlichkeit handelt, wird man ihr auch helfen können«, meinte sie. »So weit ich aus dem Gespräch mit den Kindern entnommen habe, sind sie ziemlich mittellos.«
»Sie sind aber gepflegt und gut gekleidet«, warf Frau Rennert ein.
»Vielleicht handelt es sich um eine vorübergehende Notlage. Mit dem Vater scheint etwas nicht zu stimmen.«
Darauf kamen sie später, als sie die kleine, müde Corinna zu Bett brachten.
»Die bösen Polizisten dürfen Vati doch nicht festhalten«, jammerte sie leise. »Er hat nichts getan. Er tut nie etwas Böses. Vati hat gesagt, wir sollen schön achtgeben auf Mama, und nun ist sie krank. Hätte sie doch bloß nicht die Krabben gegessen.«
Edith versuchte, mehr von Renate zu erfahren, aber das Mädchen blieb stumm wie ein Fisch.
Dann schliefen in der Geborgenheit von Sophienlust wieder einmal drei angstgepeinigte Kinder ein, deren Zukunft ungewiss war, denn trotz der schnellen Hilfe, die Frau Thorsten zuteilwurde, ging es ihr sehr schlecht, wie Edith um Mitternacht von Bert Wolfram erfuhr.
»Bis zu unserer Hochzeit werden uns noch einige Aufregungen bevorstehen, Liebes«, meinte er entsagungsvoll, und damit sollte er nicht übertrieben haben.
*
Für Irene und Hubert von Wellentin klärte sich der Himmel jedoch schon am nächsten Tag.
Nach einer nochmaligen Aussprache mit Rudolf Schneider war nun beschlossen, dass er Hanna vorerst mit auf seine Montagetour nehmen sollte. Bis zur Beendigung dieser Tour würde seine Zukunft geklärt sein. Hubert von Wellentin wollte ihm den Bescheid unterwegs zustellen lassen, damit die beiden gar nicht mehr hierher zurückkehren brauchten.
Hanna war jetzt mit allem einverstanden. Sie beugte sich dem energischen Mann, der ihr ein Gefühl der Geborgenheit vermittelte, das ihr bisher unbekannt geblieben war. Damit wich von drei Menschen die Angst, und die anderen, die mit ihnen gefühlt hatten, atmeten ebenfalls auf. Als Irene von Wellentin Kati sagte, dass sie sich nun nie mehr vor jener Frau zu fürchten brauche, lachte das Kind zum ersten Mal wieder.
Für andere war dieser Tag nicht so schön und sorglos. Zwar zeigte sich bei Frau Thorsten eine leichte Besserung, aber die Kinder ließen sich noch immer nicht beruhigen, weil sie noch nicht mit ihrer Mutter sprechen durften.
Denise schließlich konnte Renates Vertrauen erringen. Ihr vertraute das Mädchen an, was sich so Schlimmes ereignet hatte. Sie waren mit ihren Eltern in Afrika gewesen, wo ihr Vater als Mineningenieur tätig war. Schon für die Heimreise gerüstet, hatte man ihn plötzlich als Spion verhaftet und alles Geld beschlagnahmt. Nur die Mittel für die Heimreise hatte man seiner Frau und den Kindern gelassen.
»Vati ist kein Spion«, versicherte Renate bebend. »Er hat nie etwas Unrechtes getan. Es ist schrecklich, dass Mama jetzt krank geworden ist. Sie wollte doch von hier aus alles tun, ihn freizubekommen. Sie können ihn doch nicht einfach festhalten. Wenn wir doch wenigstens Tante Lilly angetroffen hätten, dann wäre das mit Mama nicht passiert.«
Jene Tante Lilly befand sich im Urlaub, wie Denise in Erfahrung bringen ließ. Man konnte sie allerdings auch nicht an ihrem Urlaubsort erreichen.
Aber vielleicht konnte Lutz Brachmann in seiner Eigenschaft als Anwalt etwas für Herrn Thorsten tun. Hubert von Wellentin und auch Alexander von Schoenecker ließen alle ihre Verbindungen spielen, um Licht in das Dunkel zu bringen, aber die zuständigen Stellen ließen nur verlauten, dass die Sache erst geklärt werden müsse.
Mit angespanntem Warten vergingen die Tage, dann bekam Dr. Brachmann endlich die Genehmigung, nach Afrika zu fliegen und mit Herrn Thorsten zu sprechen.
Claudia, die sonst so Gelassene, regte sich diesmal ziemlich auf, und das im siebenten Monat, wie Lena missbilligend feststellte. Sie bangte um ihren Mann und fürchtete, dass man ihm ebenfalls Schwierigkeiten machen könnte.
Denise machte sich Vorwürfe, dass sie, besorgt um das Wohl fremder Kinder, die Freundin in solche Sorgen gestürzt hatte. Aber glücklicherweise währten diese Sorgen nicht lange.
Frau Thorsten ging es besser. Die Kinder konnten sie besuchen, und aus Afrika traf die beruhigende Nachricht ein, dass sich Herrn Thorstens Schuldlosigkeit herausgestellt habe und der wirkliche Schuldige gefunden worden war.
»Das alles haben wir nur Ihnen zu verdanken«, sagte Frau Thorsten bewegt zu Dr. Wolfram, als er ihr die gute Nachricht bringen konnte.
»Wozu doch ein paar schlechte Krabben gut sein können«, meinte er mit aufmunterndem Lächeln. »Ich habe dabei das Wenigste getan. Sie haben nur das Glück gehabt, eine Gemeinschaft zu finden, der das Wort Nächstenliebe zu einer Lebensaufgabe geworden ist. Nicht nur, was die Kinder anbetrifft.«
»Es muss schön sein, in einer solchen Gemeinschaft leben zu können«, meinte sie gedankenvoll.
»Ja, es ist schön, und dass ich dazugehören darf, macht mich sehr glücklich«, erwiderte er.
Bald darauf konnte Frau Thorsten ihren Mann überglücklich in die Arme schließen. Eine glückliche Familie war wieder vereint, und ein leidgeprüfter Mann stattete mit bewegten Worten seinen Dank ab, noch immer nicht begreifend, dass fremde Menschen so hilfsbereit sein konnten.
Auch Claudia konnte wieder lachen. »Und das alles nur, weil ihr ausgerechnet an diesem verrückten Tag eure Möbel kaufen musstet«, neckte sie Edith.
*
Als die Thorstens Sophienlust verließen, blickte Marco ihnen kummervoll nach.
»Sie sind auch von ganz weit gekommen«, meinte er.
»Was ist noch weiter als Afrika, Nick?«
»Der Nordpol«, versicherte Dominik, da sie in der Schule gerade vom Nordpol gesprochen hatten. »Der ist ganz weit weg.«
»Dann sind meine Eltern sicher am Nordpol«, meinte Marco. »Gibt es da eine Post?«
»Nein, da gibt es keine«, antwortete Dominik.
»Dann können sie auch nicht schreiben und nicht telefonieren.«
Nicht einmal Dominik brachte es fertig, ihm diese Illusionen zu zerstören, obgleich er Marco früher schon ein paarmal klarzumachen versucht hatte, dass es von da keine Rückkehr mehr gebe.
Der Teppich, den die Kinder Edith zur Hochzeit schenken wollten, war fertig.
Er war wunderschön geworden, nachdem Frau Rennert alle kleinen Unebenheiten geschickt ausgeglichen hatte.
Nun konnte geheiratet werden!
*
Der Amtmann Wilhelm Gerlach hatte sich noch nicht dazu überwinden können, an der Hochzeit seiner Tochter teilzunehmen, aber es war nicht sein Eigensinn, der ihn daran hinderte, sondern das Schamgefühl, als unbarmherziger Vater mit scheelen Blicken betrachtet zu werden. Doch er war damit einverstanden, dass seine Frau nach Sophienlust fuhr und brachte sie recht kleinlaut zum Bahnhof.
»Wenn man es recht betrachtet, hat Edith doch großes Glück gehabt«, murmelte er.
»Und vor allem Charakter genug, um sich beizeiten von Dieter Wolff zu lösen.«
Den Namen wollte Wilhelm Gerlach am liebsten gar nicht mehr hören, denn die ganze Geschichte hätte sich auch für ihn zu einer bösen Affäre auswachsen können, wie er beinahe zu spät erkannt hatte.
»Sag Edith, dass ich auf ihre Verzeihung hoffe«, brachte er mühsam über die Lippen. Das war schon sehr viel, und Frau Gerlach war voller Zuversicht, dass sich eines Tages alles wieder normalisieren würde. Zugleich war sie glücklich, dass sie diesen schönen, harmonischen Tag miterleben und sich auch an ihrem Enkelkind erfreuen durfte.
Alle hatten dazu beigetragen, dass es ein richtiger Festtag wurde, wenngleich die beiden auf einer ganz bescheidenen Hochzeit bestanden hatten. Aber gar so bescheiden wollte Denise diesen Tag nicht gestaltet sehen, und selbstverständlich trugen auch die Kinder und alle, die an Ediths Schicksal Anteil genommen hatten, dazu bei, dass er zu einem unvergesslichen Erlebnis für das junge Paar wurde.
Auf eine Hochzeitsreise hatten sie verzichtet. Erstens war Dr. Wolfram unabkömmlich, und dann wollten sie sich auch an ihrem gemütlichen Heim erfreuen, so weit der Arzt dafür Zeit hatte.
Dominik war so zufrieden wie schon lange nicht mehr. Er atmete hörbar auf, als Dr. Bert Wolfram und Edith sich das Jawort gegeben hatten, und versicherte später, dass es eigentlich noch aufregender gewesen sei als bei seinen Eltern.
Andrea verstand das nicht ganz. »Wieso meinst du das?«, fragte sie.
»Na, wir haben wenigstens ganz bestimmt gewusst, dass wir eines Tages zusammenkommen, wenn es auch lange genug gedauert hat«, erläuterte er, »aber bei den beiden wusste man doch nie, ob nicht noch was dazwischenkommt.«
Ein Hochzeitsgeschenk war eingetroffen, das Edith bestimmt abgelehnt hätte, wäre es für sie persönlich bestimmt gewesen. Es war ein Scheck von Ferdinand Wolff, aber er war für das Kinderheim Sophienlust bestimmt. Auf diese Weise wollte Direktor Wolff wenigstens etwas von dem gutmachen, was sein Sohn angerichtet hatte.
Mit einem verlegenen Lächeln übergab Edith Denise den Scheck. »Vielleicht kann damit einmal einem Findelkind geholfen werden«, meinte sie, wehmütig an die Zeit zurückdenkend, als sie nicht mehr ein und aus gewusst hatte.
Denise nahm Edith herzlich in die Arme.
»Keinem Kind, das Hilfe braucht, wird hier jemals die Aufnahme verweigert werden«, sagte sie. »Jetzt nicht, auch in Zukunft nicht.«
Claudia aber sagte zu Dr. Wolfram: »Ich kann Sie nur beglückwünschen. Eine bessere Frau konnten Sie sich nicht aussuchen, Bert.«
Er sah sie gedankenvoll an. Anfangs hatte er oft gedacht, ob es gut gewesen war, hierherzugehen, wo sie, der seine erste große Liebe gegolten hatte, ihr Glück gefunden hatte. Nun wusste er, dass es doch richtig gewesen war. Nirgendwo hätte er für seinen Beruf diese befriedigende Erfüllung gefunden wie hier. Und an Ediths Seite dachte er nicht mehr an Claudia. Es war ein schönes Gefühl, dass sie Freunde geworden waren und dass er sich auch mit Lutz gut verstand, der sogar sein Trauzeuge geworden war.
Auf festen kleinen Beinchen kam Petra ihm entgegengelaufen und warf sich in seine ausgebreiteten Arme. »Dotto – Dati«, jauchzte sie. Das Vati gelang ihr noch nicht so recht, aber er drückte sie zärtlich an sich. Jedermann wusste, dass er ihr ein guter Vater sein würde, und Frau Gerlach weinte Tränen des Glückes, als sie ihn mit dem Kind sah.
»Wenn man sich gleich zwei hübsche Mädchen erobert, kann ja gar nichts schiefgehen«, scherzte Lutz Brachmann. »Viel Glück, Bert, und auf immerwährende Freundschaft.«
Hell klangen die Gläser aneinander.
»Nun wird’s lange dauern, bis es wieder eine Hochzeit in Sophienlust gibt«, seufzte Dominik. »Schade ist es schon. Aber gestaunt hat Edith auch über den schönen Teppich.«
Ganz gerührt war sie gewesen, wie viel Mühe sich die Kinder gemacht hatten. Bestimmt bekam er einen besonders schönen Platz in ihrem Heim.
Nur Marco stand wieder traurig am Fenster, als das junge Paar davonfuhr. »Petra hat nun auch Eltern«, sagte er leise.
»Nun bist du unser Nesthäkchen«, meinte Roli liebevoll.
»Was ist ein Nesthäkchen?«, wollte er wissen.
»Der Kleinste in der Familie.«
»Eine Familie ist man erst, wenn man Mutti und Vati hat«, flüsterte er.
»Wir haben doch Frau Rennert«, tröstete sie ihn. »Sie ist doch auch wie eine Mutter.«
»Aber sie hat kein schönes blondes Haar und sie sieht nicht aus wie meine Mutti.« Traurig blickte er zum Himmel empor. Die Wolken hingen so tief, dass der Himmel ganz nahe wirkte. »Der Nordpol ist viel weiter als der Himmel«, murmelte er. »Der Himmel fängt gleich über den Bäumen an, und ich kann ihn jeden Tag sehen, aber den Nordpol kann ich nicht sehen.«
*
Alexander von Schoenecker hatte die Post in Empfang genommen. Es war diesmal ein dicker Stoß, und auch für Dominik war ein Brief von Susi dabei.
»Da wird er sich aber freuen, wenn er aus der Schule kommt«, meinte Denise. »Er wartet schon jeden Tag darauf.«
Alexander drehte einen dicken Umschlag zwischen den Fingern. »Ein Brief von Dr. Quirin an dich, Denise«, sagte er stirnrunzelnd. »Du wirst doch von fremden Männern keine Liebesbriefe bekommen?«
»Ich habe ja kaum drei Worte mit ihm gewechselt«, lächelte sie.
»Manchmal genügen die. Was kann er nur von dir wollen?«
»Das werden wir gleich sehen, wenn wir ihn lesen«, lachte sie leise. »Wir brauchen uns darüber nicht den Kopf zu zerbrechen.«
Den mussten sie sich dann allerdings doch zerbrechen, denn dieser Brief stürzte sie in beträchtliche Verwirrung. Es ging darin um Marco und um Ingrid van Droemen.
»Ich dachte, diesen Plan hätte er längst fallen gelassen«, seufzte Denise.
»Offen gestanden habe ich es für eine verrückte Idee gehalten, aber nach dem, was er uns schreibt, hat er sich mit seinem Schwager alles reiflich überlegt.«
»Und wie wir ihn kennengelernt haben, wird er seinen Plan nun auch durchführen, nachdem er das Einverständnis Herrn van Droemens eingeholt hat.«
»Können wir das zulassen?«, fragte Denise leise. »Marco ist so sehr in seine Traumvorstellungen verstrickt. Was geschieht, wenn nun Dr. Quirin Frau van Droemen herbringt und sie tatsächlich Gefallen an dem Jungen findet, Marco aber nicht an ihr?«
»Wo bleibt deine sonstige Zuversicht, Liebes?«, meinte er aufmunternd.
»Ich habe Marco immer wieder beobachtet und mit ihm gesprochen. Er hat so bestimmte Vorstellungen. Nun ist er felsenfest überzeugt, dass sich seine Eltern am Nordpol befinden, und daran ist Nick nicht schuldlos. Er hat ja auch eine blühende Phantasie.«
»Aber Marco hat dazu noch eine ehrliche Sehnsucht nach einem Elternhaus. Es wäre entsetzlich, wenn einem so sensiblen Kind alle Illusionen zerstört würden.«
»Das sind die Sorgen, die so ein Heim mit vielen Kindern mit sich bringt. Jedes reagiert anders. Er hat nun erlebt, dass Golo von seinem Vater abgeholt wurde und Heiner von seiner Mutter, auch die Zwillinge haben Eltern bekommen.«
»Und er sieht, dass Sascha, Andrea und Nick mit uns leben. Es ist sehr, sehr schwierig, richtig zu entscheiden, aber wir haben ja schon oft vor Entscheidungen gestanden, die nicht einfach waren, und es hat noch immer eine Lösung gegeben.«
Trotz dieses Zuspruches war Denise deprimiert, und sie konnte sich gar nicht so recht erklären, warum. Hatte sie nicht stets den Standpunkt vertreten, dass selbst das schönste Heim ein Elternhaus nicht ersetzen kann? Und war ihr nicht oft genug bewiesen worden, dass es so war?
Doch in Bezug auf Marco fühlte sie eine ganz besondere Verantwortung, weil dieses Kind, jedenfalls hoffte das Dr. Quirin, den Platz eines anderen Kindes einnehmen sollte. Dieses Kind, das tot und unvergessen war, hatte eine Mutter, die so maßlos unter diesem Verlust litt, dass sie dadurch krank geworden war. Wie schrie er doch:
Wenn Sie meine Schwester Ingrid früher gekannt hätten, als sie noch eine glückliche Frau und Mutter war, würden Sie mich verstehen, verehrte Frau Schoenecker. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, und ich kann es nicht mit ansehen, wie auch mein Schwager und die beiden größeren Kinder Daniel und Evelyn darunter leiden. Ihr menschliches Empfinden, das mich so tief beeindruckt hat, wird mir recht geben, dass man nichts unterlassen darf, das Glück dieser Familie zurückzuholen. Ich habe Marco gesehen. Ganz abgesehen davon, dass mein kleiner Neffe Marc hieß und meiner Schwester sogar der Name vertraut wäre, hat er auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Jungen. Und sogar ich fühle, dass in ihm eine besondere Sehnsucht darauf wartet, innig geliebt zu werden. Damit will ich gewiss nicht sagen, dass das Kind in Sophienlust keine Liebe empfängt, aber Sie werden mit mir darin übereinstimmen, dass eine innige Bindung von Mensch zu Mensch wertvoller ist als alles andere.
So bitte ich Sie, nach reiflicher Überlegung, uns zu gestatten, Sophienlust mit meiner Schwester Ingrid zu besuchen, und die weitere Entscheidung dem Schicksal zu überlassen. Ich werde Ihnen, wie auch mein Schwager, ewig zu Dank verpflichtet sein, und wir sind bereit, auch in Bezug auf den Siedlungsbau alle Zugeständnisse zu machen, die Ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. Ja, wir sind bereit, die Siedlung in eine Wohnanlage für kinderreiche Familien umzugestalten und auf jeden eigenen finanziellen Gewinn dabei zu verzichten.
Denise sah ihren Mann lange an. »Wir können nicht nein sagen, Alexander«, flüsterte sie. »Gott wird uns auch diesmal zur Seite stehen.«
»Mein Liebstes«, murmelte er, »wie sehr wünsche ich, dass dein Glaube niemals erschüttert wird.«
*
Lachend und schwatzend kamen die Kinder aus der Schule. Zwischen Dominik und Andrea ging Kati, aber als sie Irene von Wellentin entdeckte, die auf sie wartete, stürmte sie gleich auf sie zu.
»Ich habe eine Eins im Aufsatz, Mutti«, berichtete sie strahlend.
Nick und Andrea kamen langsam näher. Ihnen kam es jetzt immer ein bisschen komisch vor, Omi sagen zu müssen, während Kati Mutti sagen konnte. Andererseits hatten sie aber eine Mutti und konnten nicht noch eine zweite dazuhaben.
»Kommt ihr mit zu uns?«, fragte Nick.
»Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr mit zu uns kommt«, meinte Irene von Wellentin lächelnd. »Mutti und Vati sind in die Stadt gefahren. Sie holen euch nachher ab.«
Ab und zu gingen sie ganz gern mit, denn die Omi tat dann alles, um sie zu verwöhnen.
»Übrigens soll ich dir den Brief geben, Nick«, sagte Irene von Wellentin. »Die Mutti meinte, dass du es kaum noch erwarten kannst, Post von Susi zu bekommen.«
Das stimmte, und strahlend nahm Nick den Brief in Empfang. Er las ihn auch gleich unterwegs, aber weit war er auf der kurzen Fahrt nicht gekommen, nur gerade bis zu dem Satz, der ein Frohlocken in ihm wachrief.
»Nächsten Monat kommen sie nach Deutschland – für immer«, rief er freudig aus. »Mit der ganzen Familie – und dann besuchen sie uns. Das wird aber ein Fest werden.«
Nick musste gleich nachrechnen, wie lange er Susi nicht mehr gesehen hatte. So ganz brachte er es jedoch nicht mehr zusammnen.
»Es ist jedenfalls schon schrecklich lange her«, meinte er. »Der kleine Timmy ist nun schon fast ein Jahr alt.«
Er las Susis Brief vor. »Timmy ist ganz drollig. Er hat rotes Haar und lauter kleine Locken.«
»Mit rotem Haar haben wir noch keinen«, meinte Nick nachdenklich.
»Doch, früher hatte Petra auch rote Haare«, stellte Andrea fest. »Das ändert sich bei kleinen Kindern immer noch. Ich werde auch immer dunkler. Früher hatte ich viel schönere Haare.«
»Sei nicht so eitel«, meinte Nick. »Ich finde dich sehr hübsch so.«
»Auch noch, wenn Susi wieder da ist?«, fragte sie eifersüchtig.
»Na klar. Susi ist ja nicht immer da. Sie kommt dann nur mal zu Besuch. Außerdem bist du meine Schwester.« Er wandte sich an seine Omi. »Was ist Kati jetzt eigentlich zu uns?«
Ein bisschen verzwickt war das schon, aber dann trafen sie einmütig die Entscheidung, dass Kati eben Kati wäre. Dennoch war heute ein besonderer Tag, denn seit heute hieß Kati nun von Wellentin, und Nick meinte daraufhin, dass sie dann auch so was wie seine Schwester wäre, wenn er auch Dominik von Wellentin-Schoenecker heißen würde.
Andrea behagte das zwar nicht so ganz, aber was spielten Namen eigentlich für eine Rolle, wenn man sich liebte und zusammengehörte?
Grund zum Feiern gab es also an diesem Tag schon. Auch Hubert von Wellentin war strahlender Laune, denn nicht nur die Genehmigung der Adoption stimmte ihn freudig, sondern auch die Nachricht, dass Rudolf Schneider und Hanna geheiratet und in ihrem neuen Wohnort bereits Fuß gefasst hatten.
Es sei alles in bester Ordnung, ließ Rudolf Schneider ihn wissen. Seine Stellung übersteige seine Erwartungen, und seine Dankbarkeit für Hubert von Wellentin werde ihn immer verpflichten, auch für seine Frau Wort zu halten.
»Er bringt es fertig und macht noch eine tüchtige Hausfrau aus ihr«, erklärte Hubert von Wellentin seiner Frau. »Ein energischer Mann, der sich nicht unterjochen lässt, wirkt manches Mal Wunder.« Er sah sie lächelnd an. »Und eine Frau, die so viel Nachsicht übt wie du, kann auch Wunder wirken. Irene, ich fühle mich jetzt wie neugeboren.«
»So weit braucht es gar nicht zu gehen«, meinte sie glücklich. »Die Hauptsache ist, wir fühlen uns jung genug, um Kati noch richtige Eltern zu sein.«
*
»Ein Schneeglöckchen«, stellte Dominik andächtig fest, als er die zarte Blüte inmitten des schmelzenden Schnees entdeckte. »Nun wird es wieder Frühling.«
»Auf dem Nordpol auch?«, fragte Marco sinnend. »Gibt es da auch Schneeglöckchen? Du hast gesagt, dass es sehr viele dort gibt, Nick.«
»Da gibt es keinen Schnee, da gibt es nur Eis«, antwortete Dominik, aber als er Marcos traurige Augen sah, fügte er rasch hinzu: »Vielleicht gibt es auch Schnee. Ich weiß das nicht so genau. Ich war ja noch nicht dort.«
»Hoffentlich hat Mutti ganz warme Sachen, damit sie nicht friert«, sagte Marco leise. »Wie heißen doch die Häuser, in denen die Eskimos wohnen?«
»Iglus sind das«, erklärte Sascha. »Sie sind aus Schnee.«
»Am Nordpol wohnen keine …«, hub Dominik an, doch Sascha versetzte ihm einen Rippenstoß und zischte ihm zu: »Lass doch den Kleinen!«
Marco horchte auf. »Ihr denkt auch, dass ich immer Unsinn rede. Toni hat gesagt, ich spinne, aber das ist nicht wahr. Ich weiß ganz genau, dass meine Mutti einmal wiederkommt.«
Seine Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Mühsam unterdrückte er ein Schluchzen.
»Wenn Toni sagt, dass du spinnst, verdresche ich ihn«, erklärte Nick daraufhin und schickte sich schon an, nach dem Missetäter Ausschau zu halten, doch da kam Denise hinzu. Sie brauchten ihr gar nichts zu erklären. Sie sah die Kinder nur an und wusste schon, worum das Gespräch wieder einmal gegangen war.
»Komm, Marco«, sagte sie weich, »es ist Spielstunde. Sie warten schon auf dich.«
»Ich möchte nicht spielen.« Seine Lippen zuckten.
»Weil Toni sagt, dass er spinnt«, erklärte Dominik grimmig. »Sag du ihm doch, dass seine Mutti bestimmt einen dicken Pelz hat und nicht zu frieren braucht an dem blöden Nordpol.«
Zu Nicks Überraschung antwortete Denise: »Wir führen heute einen Film vom Nordpol vor. Den möchtest du doch sicher sehen, Marco?«
Sie hatten sich nach Absprache mit Dr. Quirin etwas Besonderes ausgedacht, um Marcos Wunschträume gerecht zu werden. Und von der Wirkung auf das Kind wollte Denise weitere Entscheidungen abhängig machen. Wie viel Angst sie selbst davor hatte, konnte sie gar nicht sagen.
Dominik sah seine Mutter aufmerksam an. »Vom richtigen Nordpol, Mutti?«, fragte er gedehnt.
»Vom richtigen Nordpol«, erwiderte sie. Dass sie ein paar Aufnahmen eingeschnitten hatte, wollte sie selbst Dominik nicht verraten. Doch ein paar Tage zuvor hatte Dr. Quirin Filmausschnitte gebracht, die seine Schwester Ingrid in verschneiter Bergwelt zeigten. Ob sich die Kinder und vor allem Marco täuschen lassen würden, war das Risiko, das sie dabei eingingen. Morgen jedenfalls wollten Dr. Quinn und das Ehepaar van Droemen nach Sophienlust kommen.
Marcos Wangen begannen zu glühen. Ein Film vom Nordpol! Endlich würde er den Nordpol einmal sehen, und zwar nicht nur auf dem Globus. Welch unendliche Mühe es Dr. Quirin gekostet hatte, diesen Film zu bekommen und für seine eigenen Zwecke herzurichten, wussten die Kinder nicht.
Aber Alexander und Denise wussten es. Sie saßen ganz hinten im Vorführraum, ihre Hände fest ineinanderverschlungen. Alexander spürte das unruhige Klopfen von Denises Herzen, als der Film langsam auf der weißen Leinwand abrollte, der Film von einer Expedition in der Arktis: Vermummte Männer, Schlittenhunde – und eine unendliche weiße Fläche. Die Augen der beiden hingen jedoch an Marco, der wie gebannt auf die Leinwand blickte und schließlich aufschrie:
»Da ist meine Mutti – ich habe es doch gesagt!« Ein krampfhaftes Schluchzen folgte seinen Worten, und die blonde Frau in dem dicken Fuchspelz schien ihm zuzulächeln.
Denise lehnte sich an Alexander. Wild klopfte ihr Herz, aber dennoch war sie wie gelähmt.
Dominik stand plötzlich neben ihr. »Kann so etwas wahr sein, Mutti?«, fragte er atemlos.
Denise zitterte so stark, dass sie nichts sagen konnte.
»Nichts ist unmöglich, Nick«, murmelte Alexander und empfand keinerlei Gewissensbisse bei dieser frommen Lüge.
»Es ist meine Mutti«, erklärte Marco laut in die Stille hinein. »Nun hast du gesehen, dass ich nicht spinne, Toni.«
Die Kinder waren stumm. Unbewegt saßen sie noch einige Minuten, als es wieder hell wurde.
Mit verklärten Augen kam Marco auf Denise zu und schlang seine Arme um ihren Hals.
»Du hast es mir geglaubt, Tante Denise«, sagte er mit zitterndem Stimmchen. »Nun wird Mutti bald kommen, nicht wahr?«
»Ich glaube schon, Marco«, erwiderte Denise und schickte ein stilles Gebet zum Himmel, dass Ingrid van Droemen diese heiße Sehnsucht nicht zerstören möge.
*
»Warum willst du, dass ich dieses Kinderheim besuche, Henning?«, fragte Ingrid van Droemen leise. Sie kauerte auf dem Rücksitz des großen Wagens, und zwischen ihr und ihrem Mann klaffte eine große Lücke. Dr. Quirin, der am Steuer saß, hielt den Atem an, als sie fortfuhr: »Man kann mir Marc nicht wiedergeben, Henning. Du weißt es so gut wie ich. Warum war Gott so unbarmherzig?«
Hundertmal, tausendmal hatte sie diese Frage gestellt, und ihr Mann hatte keine Antwort darauf gewusst. Er wollte nach ihrer Hand greifen, aber sie zog sich noch weiter von ihm zurück.
»Vielleicht gibt er uns Marc wieder«, sagte er leise.
»Nein«, schrie sie auf. »Marc ist tot. Marc ist begraben. Er ist mir genommen worden. Mein kleiner Marc – und ich war nicht bei ihm. Ich werde es mir nie verzeihen.«
»Ingrid«, sagte er flehend, »bitte, sag das doch nicht. Denke doch auch an Daniel und Evi.«
»Sie sind doch schon groß. Alles wissen sie besser – aber auf ihren kleinen Bruder konnten sie nicht aufpassen«, stammelte sie. »Sie waren immer eifersüchtig. Ihnen macht es nichts aus, dass Marc starb.«
Henning van Droemen schloss die Augen. Daniel – Evi, dachte er verzweifelt, ihr seid doch unsere Kinder wie Marc. Warum sollt ihr dafür bezahlen, so bitter bezahlen, dass er uns genommen wurde?
Er hörte ihre Stimmen: »Wir konnten nichts dafür, Vati. Wir haben doch gar nicht gemerkt, dass Marc sich an dem Nagel gerissen hatte. Er hat nichts gesagt. Er war ganz vergnügt, und als er nachts Fieber bekam, hat uns Fräulein Rose doch nicht geweckt.«
Aber was nützte es, wenn nur er den Jammer dieser Kinder begriff und ihre Mutter ihnen eine Schuld zuschob, die sie nicht auf sich nehmen konnten und sollten. Marc war immer ein zartes Kind gewesen. Ein robusteres hätte diese Verletzung vielleicht überstanden, aber sein kleines Herz hatte versagt.
Wie eigenartig war es doch, dass dieser kleine Marco ebenso litt wie seine Frau. Henning van Droemen kannte die Geschichte dieses Jungen nun schon bis ins kleinste Detail, soweit sie überhaupt bekannt war. Er wusste, dass Marcos Eltern bei einer Segelpartie ertrunken waren. Er wusste auch, dass beide Großeltern für den Jungen zahlten, aber sonst nichts mit dem Kind zu tun haben wollten, weil sie größere Enkelkinder von anderen Kindern hatten, die ihnen näherstanden. Und er wusste, dass der Conte Agostino eine Ehe eingegangen war, die den Gesetzen seiner Familie widersprochen hatte. So war Marco, der Sohn eines italienischen Vaters und einer schwedischen Mutter, nur in Heimen aufgewachsen, vom ersten Lebensjahr an.
Der Wagen näherte sich jetzt dem Gut Sophienlust, und Henning van Droemens Herz sank mit jeder Minute tiefer. Bob war so zuversichtlich gewesen. Viel zu zuversichtlich, wie der Mann der zarten blonden Frau fand, die in einen warmen Fuchspelz gehüllt, in der äußersten Ecke des Wagens lehnte.
Ingrid wusste nichts von dem Film. Auch von Marco hatten ihr die Männer nichts gesagt. Trotzdem hatte sie Angst. Angst um ihre Ehe, um den Mann, den sie über alles liebte, aber auch Angst vor der Zukunft, vor sich selbst. Sie kam einfach nicht darüber hinweg, so viel Mühe sie sich auch gab.
Sie erkannte wohl, wie besorgt man um sie war. Was alles hatte Henning schon unternommen, um sie abzulenken. Nun waren Daniel und Evelyn sogar in ein Internat gekommen, auch auf ihren eigenen Wunsch hin, weil auch sie fühlten, dass ihre Mutter durch ihren Anblick deprimiert wurde.
Es gab Momente, in denen Ingrid erkannte, dass sie ungerecht war, doch schon im nächsten sah sie wieder Marc vor sich – und alles andere wurde für sie bedeutungslos.
Sie hatte sich dieses Kind so sehr gewünscht, obgleich die Ärzte abgeraten hatten. Die Schwangerschaft war schwer gewesen, die Geburt kompliziert. Und Marc war ein zartes Baby, das sie ständig brauchte. Er blieb auch ein zartes Kind. Nie trennte sie sich von ihm, bis zu jenem Tag, weil Henning sie so dringend bat, an dem Galaempfang in Brüssel teilzunehmen.
»Ich kann doch nicht immer ohne meine Frau kommen«, hatte er gesagt. »Man könnte ja daraus schließen, dass in unserer Ehe etwas nicht stimmt. Außerdem muss ich dich wohl von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass es mich auch noch gibt.«
Und dann war das geschehen, was schließlich ihr ganzes Glück und auch ihre Ehe gefährdete. Marcs plötzlicher Tod hatte Ingrid noch weiter von Henning entfernt.
*
Denise war an diesem Tag früh nach Sophienlust gekommen. Sie hatte mit Dr. Quirin verabredet, dass er mit seiner Schwester und seinem Schwager vormittags eintreffen sollte, wenn die größeren Kinder in der Schule waren. Mit Zittern und Zagen sah sie dem Zusammentreffen mit Ingrid van Droemen entgegen. Ein einziger Augenblick konnte entscheiden …
Vorsichtshalber hatte sie Dr. Wolfram zu Hilfe gerufen, falls es bei Ingrid van Droemen einen Zusammenbruch geben sollte. Edith und Petra waren mitgekommen. Mit Petra konnte er sich zwar nicht unterhalten, aber die Kleine hörte seinen Reden zu, als verstünde sie ihn.
Die Kinder verbrachten die Zeit bei Habakuk, dem Papagei, der die Unterhaltung übernommen hatte und seinen gesamten Wortschatz, von Krächzen und Kichern begleitet, herunterschnarrte.
»Du verflixter Habakuk«, kreischte er eben, als das Auto vorfuhr.
Wenn Marco ein Motorengeräusch vernahm, war er immer gleich beim Fenster. Auch jetzt kümmerte er sich nicht mehr um Petra und Habakuk.
Edith war wie auf ein Stichwort eingetreten. Allerdings wohl beabsichtigt, denn sie war von Denise informiert worden und beauftragt, Marcos Reaktion genau zu beobachten, während Denise sich vorerst ganz Ingrid van Droemen widmen wollte.
Marco sah zuerst, wie Dr. Quirin aus dem Wagen stieg, und erkannte ihn auch sofort.
»Der nette Herr, der meine Mutti schon mal gesehen hat«, sagte er außer Atem.
Dann entstieg ein hochgewachsener Mann dem Wagen und danach, fürsorglich gestützt, die blonde Dame im Fuchspelz.
Marcos Augen weiteten sich. Seine Lippen bewegten sich, aber er brachte kein Wort hervor. An Edith vorbei lief er zur Tür. Als sie ihn zurückhalten wollte, stieß er mit einer heftigen Bewegung ihre Hand fort. Draußen stand er dann ganz still und starrte mit großen brennenden Augen die Dame an. Ein Schluchzen entrang sich seiner Kehle, das die Erwachsenen erschütterte.
»Marco«, rief Denise impulsiv, und Ingrid van Droemen sah den Jungen an, der auf sie zugetaumelt kam. »Mutti – Mutti – Mutti«, wiederholte er immer wieder. »Ich wusste ja, dass du kommst. Ich wusste es genau.«
Hilflos blickte Ingrid van Droemen zu ihrem Mann empor, der beruhigend seinen Arm um ihre Schultern legte, während sich auch Robert Quirin bereitstellte, sie zu stützen.
»Marco«, rief auch er. Der Junge lächelte schüchtern zu ihm empor. »Du hast meine Mutti gefunden und hergebracht«, sagte er, dann schenkte er Ingrid ein zärtliches Lächeln. »Kennst du mich nicht mehr? Ich bin groß geworden, nicht wahr? Du warst auch lange fort. Aber ich habe dich nicht vergessen. Du siehst genauso aus, wie ich es immer geträumt habe.«
»Er heißt Marco und ist ein Kind, das sich sehr nach Mutterliebe sehnt, Ingrid«, flüsterte Robert Quirin seiner Schwester zu. »Überwinde dich. Sag doch etwas.«
Aber sagen konnte sie nichts. Sie machte ein paar Schritte vorwärts, kniete bei dem kleinen Jungen nieder und streckte ihre Hände aus. Heiße Tränen strömten über ihre Wangen.
»Marc!«, flüsterte sie.
Behutsam legte er seine Arme um ihren Hals.
»Mutti, Muttilein, mein liebes Muttilein«, flüsterte er. »War es sehr kalt am Nordpol?«
Sie begriff den Sinn dieser Frage gar nicht. In ihren Armen hielt sie einen bebenden, vor Glück und Erwartung völlig atemlosen kleinen Jungen und drückte ihn an sich.
Henning van Droemens verkrampfte Züge lösten sich. »Willst du mich nicht auch begrüßen, Marco?«, fragte er leise.
Ein rührendes Lächeln erschien auf Marcos Gesicht. »Du bist mein Vati?«, fragte er schüchtern. »Ich habe dich nicht gleich erkannt. Meistens habe ich ja auch nur von Mutti geträumt.«
Robert Quirin sah, dass seine Schwester am Ende ihrer Kraft war. Behutsam hob er sie empor, während Henning van Droemen den Jungen auf den Arm nahm.
»Mutti ist ein wenig schwach, Marco«, sagte er leise.
Besorgt wandte sich das Kind um und sah, wie Robert Quirin sie ins Haus trug.
»Sie hat ja auch eine sehr weite Reise hinter sich«, flüsterte er. »Der Nordpol ist weiter als der Himmel. War sie krank?«
»Ja, sie war krank«, erwiderte Henning van Droemen dumpf. Aber jetzt wird sie vielleicht gesund werden, dachte er für sich weiter.
»Ich werde jetzt immer auf sie aufpassen«, versicherte Marco ernsthaft. »Gut, dass Dr. Wolfram gerade da ist. Er wird ihr eine Medizin geben. Er macht uns auch immer gesund.«
Dankbar sah Henning van Droemen Denise an. Sie hatte an alles gedacht. Der Blick, den sie miteinander tauschten, sagte mehr als viele Worte. Erleichterung und Zuversicht war in ihm zu lesen.
*
Denise flüchtete sich in die Arme ihres Mannes. Ihre Erschütterung verschaffte sich jetzt in einem Aufschluchzen Luft.
»Es wird alles gut werden«, flüsterte sie. »Für sie und auch für Marco.«
Dr. Quirin gesellte sich zu ihnen. »Sie erholt sich«, sagte er mit belegter Stimme.
»Es war ein Schock, aber der Ring um ihr Herz ist gesprengt. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen für Ihre Mithilfe danken soll, gnädige Frau.«
»Ich glaube, wir hatten doch alle eine höllische Angst«, murmelte Denise.
»Das kann man wohl sagen. Im Augenblick lebt sie sich in den Gedanken hinein, dass ihr Kind ihr wiedergegeben wird. Wenn es ihr bewusst wird, dass es ein anderes Kind ist, wird Marco ihre Liebe schon gewonnen haben. Ich bin ganz sicher, dass dieses Experiment glückt.«
»Und die beiden anderen Kinder? Wie werden sie es aufnehmen?«
»Henning und ich werden mit ihnen sprechen. Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten.«
Würde sich wirklich alles so entwickeln, wie sie es so heiß erhofften und wünschten? Die Zukunft würde es zeigen. Der Anfang war gemacht.
An diesem Abend erzählte Denise Dominik eine lange abenteuerliche Geschichte. Die Geschichte des kleinen Marco, dessen heißester Wunsch in Erfüllung gegangen war.
»Und wie endet die Geschichte nun?«, fragte Dominik gespannt.
»Das werden wir eines Tages erfahren«, erwiderte Denise leise und faltete unwillkürlich die Hände. Hoffentlich gab es ein glückliches Ende für alle, die daran beteiligt waren.
»Ich finde das mächtig aufregend, aber bei Susi ist ja auch alles gut gegangen«, tröstete Dominik sich und die anderen.