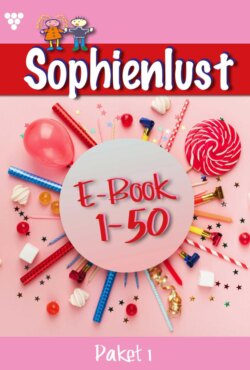Читать книгу Sophienlust Paket 1 – Familienroman - Diverse Autoren - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDenise von Wellentin brachte ihren kleinen Koffer zum Wagen. »Dürfen wir wirklich nicht mitfahren, Mutti?«, fragte Dominik enttäuscht.
»Sei vernünftig, Nick!«, bat sie. »Ich habe Dringendes zu erledigen, dabei kann ich euch nicht brauchen. Ich bleib’ ja nur ein paar Tage weg.«
»Ein paar Tage sind eine lange Zeit. Wir wollten uns doch nie mehr trennen, Mutti!«
»Du willst ja auch, dass Susanne zu uns kommt, und deswegen muss ich verreisen.« Denise konnte Nick nicht erklären, warum diese Reise so wichtig war. Er durfte vorläufig nicht erfahren, dass die kleine Susanne, um die es ging, noch einen Vater besaß. Denise aber brauchte dessen Einwilligung, wenn sie Susanne aus dem Kinderheim »Haus Bernadette« zu sich nach Gut Sophienlust holen wollte.
»Du hast doch bestimmt keine Sehnsucht nach Madame Merlinde«, versuchte Denise ihren Sohn abzulenken.
Nein, die hatte er nicht. Nick erinnerte sich nicht gern an die Zeit, die er selbst im Haus Bernadette verbracht hatte. Hier in Sophienlust war es viel schöner. Hier war er richtig zu Hause, denn er war der Erbe seiner Urgroßmutter, und hier konnte er auch mit seiner geliebten Mutti beisammen sein, die er so sehr vermisst hatte, als sie noch ihrem Beruf nachgehen musste.
»Komm, Nick!«, rief Claudia Rogers, Denises einzige Freundin und Vertraute einsamer Jahre, die mit ihr das Kinderheim »Sophienlust« leiten wollte. »Mario ist doch auch vernünftig.«
»Es ist ja auch keine Mutti, die wegfährt«, erklärte Nick bockig. Aber sofort fügte er verlegen hinzu: »So etwas darf ich nicht sagen, denn Mario soll nicht mehr daran erinnert werden, dass er keine Mutti und keinen Vati mehr hat.«
Denise strich ihm über das dichte dunkle Haar. »Siehst du, wie vernünftig du sein kannst, mein Liebling«, sagte sie zärtlich. »Ihr seid doch bei Claudia in guter Hut. Und Andrea wird euch auch besuchen.«
»Und auf unsere kleine Petra müssen wir ja auch aufpassen«, meinte Dominik nun sehr verständig. »Pass schön auf dich auf, Mutti, damit dir nichts passiert.«
»Ich passe schon auf, mein Liebling«, versprach sie. »Seid recht lieb zu Claudia, und stellt nichts an, damit ich mir keine Sorgen um euch machen muss!«
»Hoffentlich hast du Erfolg, Isi!«, raunte Claudia der Freundin noch zu, dann fuhr Denise davon, und alle winkten ihr einträchtig nach.
Ja, hoffentlich habe ich Erfolg, dachte Denise. Was sich wohl so ein Vater dabei vorgestellt hat, sein Kind einfach in ein Heim zu geben und sich dann nicht mehr darum zu kümmern. Aber sie durfte nicht ungerecht sein, denn sie kannte ihn nicht und ebensowenig die Beweggründe seines Handelns. Für sie ging es vor allem um die kleine Susanne, an die sich Dominik im Haus Bernadette so besonders innig angeschlossen hatte. Denn Denise wusste um das Leid eines Kindes, das niemanden besaß, der sich um es kümmerte. Das wenigstens hatte sie ihrem kleinen Sohn ersparen können.
Sie hatte immer so viel verdient, dass sie für Nick sorgen konnte. Aber erst Sophie von Wellentins Vermächtnis hatte sie aller Sorgen enthoben. Der kleine Dominik war ein reicher Erbe geworden, und sie war entschlossen, dieses Erbe im besten Sinne zu verwalten und möglichst vielen Kindern, die Elternliebe entbehren mussten, ein Heim zu geben.
*
Vor einem modernen Wohnhaus in Innsbruck hielt ein Taxi. Ihm entstieg ein schlanker blonder Mann mit tiefgebräuntem Gesicht. Schnell eilte er auf das Haus zu und stieg in den Lift, der ihn zum vierten Stockwerk hinauftrug.
Eine hübsche Frau mit rotbraunem Haar öffnete ihm dort die Tür.
»Endlich, Günther!«, rief sie. »Ich warte sehnlichst. Du wolltest doch schon vor zwei Tagen kommen.«
Er betrachtete sie abschätzend und erwiderte ihre Umarmung nicht. Musste sie ihn gleich mit einem Vorwurf empfangen, wenn er, müde von dem langen Flug, kam? Anstrengende Wochen lagen hinter ihm. Der Kuss, den sie ihm jetzt gab, konnte seine Enttäuschung nicht auslöschen.
»Nun, wie gefällt dir die Wohnung?«, fragte sie. »Hübsch, nicht wahr? Ich habe nicht gespart, es war alles sehr teuer, und Schulden musste ich leider auch machen. Aber jetzt hast du ja eine phantastische Stellung und wirst es mir nicht übelnehmen. Nun können wir endlich heiraten.«
»Ja, Uschi«, erwiderte er müde. »Jetzt habe ich eine phantastische Stellung, und deswegen musste ich auch zwei Tage länger in Johannesburg bleiben. Vielleicht werde ich für immer dorthin gehen.«
»Wir«, verbesserte sie. »Vergiss mich nicht dabei! Nun, immerhin wäre es dann schade, dass wir die Wohnung hier erst eingerichtet haben.«
»Du hast sie eingerichtet. Mir wäre es damit nicht so eilig gewesen«, erwiderte er unwillig.
»Du konntest doch nicht mehr in diesem scheußlichen Loch hausen«, meinte sie vorwurfsvoll. »Schließlich bist du deiner neuen Stellung auch einiges schuldig. Was soll man von dir denken, wenn du in einem möblierten Zimmer wohnst? Doktor Günther Berkin, Leiter der Exportabteilung eines Weltkonzerns.«
»Hast du das Geld für Susanne pünktlich überwiesen?«, lenkte er unvermittelt ab.
»Natürlich«, erwiderte sie leichthin. »Ich glaube gar, dir ist diese Sache wichtiger als ich.«
Er ließ sich erschöpft in einen Sessel sinken. Der Klimawechsel machte ihm zu schaffen. Zudem hatte er sich sehr verausgabt während dieser Reise, die so ungeheuer wichtig für seine künftige Position war. Gut, er hatte erreicht, was er sich vorgenommen hatte, aber jetzt wollte er ein paar Stunden Ruhe haben.
Ursula Rinke war damit nicht einverstanden. Sie gehörte zu jenen Frauen, die stets zuerst an sich und ihre eigenen Interessen denken. Günther Berkin war auch erst interessant für sie geworden, als er aus einer untergeordneten und schlechtbezahlten Stellung zu dieser Position aufgestiegen war, die er heute besaß. Deshalb hatte sie auch vor, ihn zu heiraten, wenngleich sie manches an ihm auszusetzen hatte. Vor allem war da dieses Kind, Susanne, für das er monatlich mehr Geld aufgewendet hatte, als er lange Zeit für sich selbst ausgeben konnte.
Über dieses Kind musste sie unbedingt bald mit ihm sprechen. Aber sie musste es möglichst diplomatisch beginnen, denn gerade in dieser Beziehung war er überaus empfindlich.
Doch dann fing er selbst davon an.
»Ich habe mir meine Gedanken gemacht, Uschi«, begann er zögernd. »Wenn wir heiraten, könnten wir Susanne eigentlich zu uns nehmen. Es muss doch für ein Kind schrecklich sein, bei fremden Menschen aufzuwachsen.«
Das war nun etwas, was sie am allerwenigsten hören wollte. Für einen Augenblick ließ sie ihre liebenswürdige Maske fallen. Diesmal sah er es, und ihn schauderte.
Er war gerecht genug, sich selbst einzugestehen, dass er sich nicht gerade wie ein guter Vater verhalten hatte, aber was der Anlass dazu war, konnte nur derjenige ermessen, der ihn kannte und die Vorgeschichte.
»Aber sie weiß ja nicht einmal, dass sie einen Vater hat«, sagte sie ärgerlich. »Du hast es mir selbst gesagt, Günther. Diese Idee ist so absurd, dass wir gar nicht darüber zu sprechen brauchen.«
»Wieso ist es absurd, wenn sich ein Vater darauf besinnt, dass er nicht nur eine finanzielle Schuld abzutragen hat, sondern auch eine menschliche?«, fragte er. Alle Müdigkeit war plötzlich von ihm abgefallen.
»Wir wollen doch heiraten«, erwiderte sie gereizt. Seine Worte hatte sie fast in Panik versetzt, und zudem bekam sie es auch aus ganz bestimmten Gründen noch mit der Angst, denn schon seit Monaten hatte sie das für Susanne bestimmte Geld nicht mehr überwiesen, sondern für sich selbst verbraucht. Wenn das jetzt herauskam, musste sie seinen Zorn fürchten. Sie hatte es so geschickt arrangiert, dass er gar nicht darauf hätte kommen können, aber sie hatte sein persönliches Interesse an dem Kind, das ihr völlig überraschend kam, dabei nicht einkalkuliert.
Günther Berkin hatte sich erhoben und ging im Zimmer auf und ab.
»Setz dich doch, du machst mich nervös«, fuhr sie ihn an.
»Ja, du bist nervös«, stellte er fest. »Warum? Du bist doch eine Frau und müsstest eigentlich Verständnis für das Kind haben, wenn du mich liebst.«
»Erwartest du tatsächlich Verständnis für ein fremdes Kind von mir?«, gab sie kalt zurück. »Für ein Kind, das sogar von seiner Mutter im Stich gelassen wurde?«
»Ich glaubte, du wärst anders als sie«, erwiderte er kühl. »Aber wahrscheinlich gerate ich immer an die gleiche Sorte Frauen.«
»Günther«, versuchte sie ihn umzustimmen, »sprich nicht so mit mir. War nicht alles gut zwischen uns? Wir sind doch glücklich und könnten glücklich bleiben, wenn du nicht plötzlich solche Anwandlungen bekämst.«
»Wir sind glücklich?«, wiederholte er fragend. »Du gabst mir eine Zeitlang das Gefühl, einen Menschen zu haben, der mich versteht. Ja, das habe ich wirklich angenommen, aber man bildet sich wohl leicht etwas ein, wenn man so lange einsam gelebt hat.«
»Du warst mehr als zwei Monate fort, Günther, und das scheint dir nicht bekommen zu sein.«
»Ich war mit sehr vielen Menschen zusammen. Mit Familien, die mit ihren Kindern glücklich leben, und ich habe darüber nachzudenken begonnen, dass Susanne dies alles entbehren muss.«
»Du wirst sentimental«, spottete sie. »Fünf Jahre ist das Kind alt geworden, ohne dass du dich darum gekümmert hast. Du hast sie nicht besucht, hast nur Geld geschickt. Gut, so viel Geld, wie du eigentlich gar nicht entbehren konntest, aber niemand kann dir nachsagen, dass du etwas versäumt hast.«
»Doch, ich habe sehr viel versäumt. Ich habe ihr meine Liebe vorenthalten. Das ist wichtiger als Geld.«
»Für sie war es besser so«, sagte Ursula beschwörend.
Er seufzte: »Du verstehst mich nicht. Wir reden aneinander vorbei. Ich versuche dir klarzumachen, dass ich mittlerweile zu einer anderen Erkenntnis gekommen bin.«
»Ich weiß, was du mir klarmachen willst, aber ich bin nicht damit einverstanden«, erwiderte sie kühl. »Ich höre aus deinen Worten nur heraus, dass ich einem Kind Liebe und Verständnis entgegenbringen soll, das von seiner Mutter verlassen wurde. Das ist zu viel verlangt. Was soll in unserer Ehe ein Kind, das wir beide nicht kennen, das dich vielleicht sogar an seine Mutter erinnern wird. Ich will nicht mit deiner Vergangenheit leben.«
Er lachte bitter. »Müsste ich nicht auch mit deiner Vergangenheit leben, Ursula? Du hast zwar kein Kind, aber es gab doch eine ganze Anzahl Männer in deinem Leben.«
Erst wurde sie blass, dann schoß ihr das Blut ins Gesicht. »Weißt du nichts Besseres, um dich zu rechtfertigen?«, brauste sie auf. »Es ist sehr billig, auf solche Weise von seinen eigenen Fehlern abzulenken.«
»Das eben will ich nicht. Ich habe sogar lange über meine Fehler nachgedacht. Im übrigen war ich mehr als zwei Monate fort, und ich habe dich nicht vermisst«, setzte er hinzu.
Ursula ermahnte sich zur Ruhe. Wenn sie sich jetzt nicht zusammennahm, konnte es zum Bruch zwischen ihnen kommen, und das wollte sie auf keinen Fall.
So blieb ihr nur eines: Sie musste sich mit ihm versöhnen, und wenn sie Zugeständnisse machen musste.
»Verzeih mir, Günther«, bat sie, »du hast mich mit deinem Vorschlag aus der Fassung gebracht, und ich war sehr unbeherrscht. Wir werden in aller Ruhe darüber sprechen, aber nicht heute. Du musst dich ausruhen, Liebster. Außerdem sind wir beide gereizt. Du, weil du müde bist, und ich, weil ich plötzlich fürchte, dich verlieren zu können. Das darfst du mir nicht antun, Günther. Ich liebe dich doch, und ich bin bereit, alles zu tun, was du erwartest. Ich kann und will ohne dich nicht leben.«
»Und vor allem auf das alles hier willst du nicht verzichten«, ergänzte er bitter. »Ich brauche frische Luft!« Er nahm seine Jacke und ging zur Tür.
»Günther«, schrie sie auf. »Liebster, bitte geh nicht! Bleib bei mir, ich will doch mit dir reden.«
»Aber ich nicht mit dir. Nicht jetzt«, erwiderte er kalt.
*
Günther Berkin wanderte unstet durch die Straßen von Innsbruck. Er wusste nicht, was ihn trieb, noch, wohin es ihn trieb. Er wusste nicht einmal zu sagen, was ihn in eine so gereizte Stimmung versetzt hatte, von Ursulas Begrüßung abgesehen. War es die Erinnerung an jene andere Frau?
Allerdings hatte er mit dieser Frau nicht mehr als zwei kurze Begegnungen gehabt. Doch diese hatten ihn stark beeindruckt.
Ines Jakobus war eine ganz andere Frau als Ursula Rinke. Ines war die Sekretärin seines höchsten Chefs, eine Frau, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand, im Beruf immens tüchtig, gewissenhaft und zuverlässig war. Eine Frau, auf den ersten Blick nicht reizvoll, die dafür aber umso mehr Persönlichkeit besaß. Er hatte sich von dieser starken Persönlichkeit angezogen gefühlt, vor allem als er merkte, dass hinter der kühlen, nüchternen Fassade ein warmes, mütterliches Herz schlug.
Sie liebte Kinder, und er, Dr. Günther Berkin, war wie aus einem Dämmerzustand erwacht und hatte über sein eigenes Kind und sein Leben nachzudenken begonnen.
Plötzlich, er wusste selbst nicht, wie er dahingekommen war, stand er vor dem alten Haus, in dem er früher gewohnt hatte. Er hatte sein Zimmer gekündigt, bevor er nach Johannesburg abgereist war.
»Bis du zurück bist, werde ich uns eine hübsche Wohnung eingerichtet haben«, hatte Ursula ihm erklärt, und er hatte ihr alles Geld, das er hatte, dafür zurückgelassen. Davon sollte auch der monatliche Unterhaltsbeitrag für Susanne gezahlt werden.
Frau Hamann, seine frühere Vermieterin, sah ihn staunend an, als er an ihrer Tür läutete.
»Der Herr Doktor!«, rief sie erfreut. »Wie nett, dass er mich nicht vergessen hat. Gut schaut er aus, der Herr.«
Sie war eine einfache Frau, aber in seiner schlimmen Zeit war sie für ihn wie eine Zuflucht gewesen. In dieser bescheidenen Behausung, das wurde ihm plötzlich bewusst, hatte er sich wohler gefühlt als in der komfortablen Wohnung, die Ursula eingerichtet hatte.
»Als das Fräulein Rinke kam und sagte, ich sollte alle Post an die Absender zurückgehen lassen, dachte ich schon, der Herr Doktor würde gar nicht mehr zurückkommen«, erzählte Frau Hamann.
Günther Berkin stutzte. Wie kam Ursula dazu, solche Anordnungen zu treffen?
»Und ist denn Post gekommen?«, erkundigte er sich.
»Nicht viel«, meinte sie. »Das übliche. Zwei Briefe aus der Schweiz und ein paar andere. Hätte ich sie vielleicht doch aufheben sollen?«
Warum hatte Ursula sie nicht zu sich schicken lassen?, überlegte er. Das muss doch einen Grund haben. Zwei Briefe aus der Schweiz, das konnte nur Madame Merlinde gewesen sein. Was hatte sie ihm mitzuteilen?
Schweigend blickte er vor sich hin, und die alte Frau betrachtete ihn besorgt.
Da klingelte es. »Ich will mich verabschieden«, sagte Günther Berkin hastig. »Bei Gelegenheit werde ich wieder mal vorbeischauen, Frau Hamann, und falls noch Post für mich kommen sollte, heben Sie sie bitte auf.«
In der Tür traf er mit einer jungen, schönen Frau zusammen, deren Anblick ihn sofort beeindruckte. Verblüfft blieb er stehen, als er sie fragen hörte: »Hier wohnte ein Herr Doktor Berkin. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann? Mein Name ist Denise von Wellentin.«
»Ich bin Günther Berkin«, sagte er rasch. »Zufällig bin ich hier nach einer längeren Auslandsreise vorbeigekommen.«
Denise betrachtete ihn forschend. Er machte eigentlich keinen schlechten Eindruck auf sie. Sie hatte ihn sich ganz anders vorgestellt.
»Könnte ich Sie bitte kurz sprechen, Herr Doktor Berkin?«, fragte sie ruhig.
»Gern, gnädige Frau«, erwiderte er und überlegte, was sie wohl von ihm wollte. Er hatte ihren Namen nie zuvor gehört.
»Wissen Sie einen Platz, wo wir uns ganz ungestört unterhalten können?«, fragte Denise. »Es handelt sich um Ihre Tochter Susanne.«
»Um Susanne?«, wiederholte er überrascht. »Schickt Madame Merlinde Sie?«
»Nein, ich komme aus eigenem Entschluss. Bitte, Herr Doktor Berkin, hier ist mein Wagen. Fahren wir aus dem Ort hinaus. Mich bedrückt diese Föhnstimmung.«
Seine Gedanken überstürzten sich. Mechanisch gab er ihr Anweisung, in welche Richtung sie fahren sollte. Dabei überlegte er. Den ganzen Tag und schon Tage vorher hatte er sich mit Susanne beschäftigt. Was war geschehen?
Diese Frau war jung, schön und sah sehr gepflegt aus. Der Wagen verriet, dass sie nicht gerade arm sein konnte. Woher wusste sie von seinem Kind? Woher wusste sie vor allem, dass er Susannes Vater war?
Sie hatten einen ländlichen Gasthof erreicht. Sie waren an diesem frühen Nachmittag die einzigen Gäste, und das war ihnen beiden willkommen.
»Ich bin hungrig«, erklärte Denise. »Ich bin seit Stunden unterwegs.«
Auch er verspürte plötzlich Hunger. »Ich bin erst heute aus Johannesburg zurückgekommen«, erwiderte er.
»Sie waren längere Zeit verreist? Das erklärt wohl, weshalb Ihre Zahlungen an Madame Merlinde ausblieben«, meinte sie verständnisvoll.
»Was sagen Sie da?«, fragte er verdutzt. »Die Zahlungen sind doch geleistet worden!«
»Dann bin ich wohl falsch informiert worden«, erwiderte sie ruhig. »Aber das wird sich alles aufklären lassen. Ich werde versuchen, Ihnen begreiflich zu machen, was mich hierherführt. Dazu muss ich allerdings einige Jahre zurückgreifen.«
Eine freundliche Bedienung brachte ihnen einen Imbiss und einen Krug Landwein. Günther Berkins Finger zitterten, als er das Glas hob.
»Ich habe einen Sohn«, begann Denise mit leiser Stimme zu erzählen. »Er war drei Jahre im Haus Bernadette mit Ihrer Tochter Susanne zusammen.«
»Woher wissen Sie, dass Susanne meine Tochter ist?«, fragte Berkin.
»Ich weiß es von Madame Merlinde. Ich kann mir denken, dass sie nicht dazu berechtigt war, es mir zu sagen, aber die Umstände, die ich Ihnen jetzt klarlegen werde, rechtfertigen es, denke ich.«
Aus welchem Grund gab sie ihren Sohn in das Heim, fragte sich Günther Berkin. Gehörte sie zu den Karrierefrauen, die sich nicht um ihre Kinder kümmern? Aber warum interessiert sie sich dann auf einmal auch noch für ein fremdes Kind?
Denise überlegte. Bestand eigentlich für sie Veranlassung, diesem fremden Mann ihre Verhältnisse aufzudecken? Sie wollte doch vor allem von ihm erfahren, warum er sein Kind derart vernachlässigte.
»Würden Sie mir sagen, warum Sie Susanne in das Heim gegeben haben, Herr Doktor Berkin? Würden Sie es tun, wenn ich Ihnen erkläre, dass ich bereit bin, Susanne zu mir zu nehmen?«
»Sie wollen Susanne zu sich nehmen?«, fragte er erstaunt. »Aber wie kommen Sie dazu?«
»Ich werde es Ihnen erzählen, wenn ich auch von Ihnen Offenheit erwarten darf. Ich gebe Ihnen die Versicherung, dass niemand etwas von unserem Gespräch erfahren wird. Mir geht es allein um das Kind, dessen Vater Sie ja nun sind.«
»Es ist nicht so, wie Sie annehmen«, meinte er. »Ich weiß allerdings, dass man es so sehen könnte. Ich dachte nur lange, dass es für Susanne besser wäre, wenn sie nichts von meiner Existenz erfahren würde.«
»Und jetzt denken Sie anders darüber?«
»Ich habe mir gerade in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht. Es war damals so.« Er brach ab, und sie ließ ihm Zeit, sich zu sammeln.
»Ich heiratete, als ich noch Student war«, begann er stockend zu erzählen. »Wir studierten beide. Hella wollte Lehrerin werden. Wir heirateten, als Susanne unterwegs war.« Er brach ab. »Gnädige Frau, ich bitte Sie, mich zu verstehen. Ich habe noch mit niemandem so offen darüber gesprochen, und ich kann mir auch nicht recht erklären, warum ich es heute tue.«
»Vielleicht, weil es für Susanne gut ist«, half sie ihm weiter. »Dominik, das ist mein Sohn, hängt sehr an Ihrer Tochter. Er wünscht sich sehnlichst, dass sie zu uns kommt. Und ich bin von Herzen gern bereit, sie bei uns aufzunehmen. Vielleicht hilft Ihnen das weiter, wenn es Ihnen schwerfällt, eine Vergangenheit, die Sie sicher vergessen wollten, aufzudecken. Ich kann das gut verstehen, denn auch ich wollte einmal einen dicken Strich unter die Vergangenheit ziehen.« Sein Blick ruhte sekundenlang auf ihr, dann löste sich seine starre Miene.
»Es ist gut, sich auszusprechen, wenn man verstanden wird«, gab er zu. »Hella war sehr hübsch, und gerade als sie erfuhr, dass sie ein Kind bekommen würde, bekam sie ein Angebot, als Fotomodell zu arbeiten. Sie konnte dabei viel Geld verdienen. Sie wollte das Kind nicht, und sie wollte auch mich nicht mehr. Ich besaß ja nichts, konnte ihr nichts bieten. Sie lief von Arzt zu Arzt, aber niemand half ihr. Es war eine schreckliche Zeit. Sie gab mir die Schuld daran, ihr Leben zerstört zu haben, und ich fühlte mich auch schuldig. Das Kind kam zur Welt, und sie wollte es zur Adoption freigeben. Aber damals lebte meine Mutter noch, und sie nahm das Kind zu sich.«
Seine Stimme sank zum Flüstern herab. Man spürte, wie schwer es ihm fiel, weiterzusprechen.
»Hella verließ mich sofort, und wir wurden bald darauf geschieden. Meine Mutter starb, als Susanne ein Jahr alt war, und ihre Spargroschen konnte ich dafür verwenden, Susanne zu Madame Merlinde zu geben. Ich hatte mein Studium beendet, aber allzu viel verdiente ich nicht, und …« Er unterbrach sich erneut.
»Ich kenne Madame Merlindes Bedingungen«, griff Denise ein. »Auch mir fiel es einmal sehr schwer, das Geld für Dominik aufzubringen. Sie sehen, Herr Doktor Berkin, Sie können volles Vertrauen zu mir haben. Aber warum sollte Susanne nicht erfahren, dass sie einen Vater hat?«
Er zuckte die Schultern. »Ich hätte sie ja doch nicht zu mir nehmen können. Ich musste arbeiten. Und dann, na ja, fürchtete ich, ich würde nicht das rechte Verständnis für sie haben. So dachte ich, es sei besser, wenn sie gar nicht erst erführe, dass sie noch einen Vater hat.«
»Und eine Mutter?«
»Hella lebt schon lange in den Vereinigten Staaten. Sie hat einen reichen Mann geheiratet, der ihr alles bieten kann. Das Kind hat sie aus ihrem Gedächtnis gestrichen.«
Denise nickte. Es gab also nicht nur Großeltern, die von einem Enkel nichts wissen wollten, es gab sogar Mütter, die vergaßen, dass sie ein Kind hatten. So gesehen, konnte sie diesem Mann ihr Verständnis kaum versagen.
»Ich sagte Ihnen bereits, dass ich mir gerade in den letzten Wochen sehr viele Gedanken um Susanne machte«, fuhr er fort. »Ich habe jetzt eine sehr gut dotierte Stellung gefunden, und eigentlich wollte ich auch wieder heiraten. Ich dachte, dass ich dann Susanne zu mir nehmen könnte. Aber ich bin wohl wieder an die falsche Frau geraten, wie ich heute feststellen musste. Und nun kommen Sie.«
»Nun werde ich erzählen«, sagte sie. »Sie waren offen, ich bin es auch. Ich war früher Tänzerin und verliebte mich in Dietmar von Wellentin. Seine Eltern waren gegen diese Ehe. Ein von Wellentin und eine Tänzerin, das ließ sich nicht mit ihren Ansichten vereinbaren. Auch ich erwartete ein Kind, und Dietmar heiratete mich. Aber er kam kurz nach unserer Hochzeit ums Leben.
Ich musste arbeiten, um mein Kind ernähren zu können. Ich hatte keine Mutter, die mir beistand, nur eine gute Freundin. An die Wellentins brauchte ich mich nicht zu wenden, und ich wollte es auch nicht. Dominik lebte unter meinem Mädchennamen Montand im Haus Bernadette. Dann hatte ich Pech und zog mir eine Verletzung zu, wodurch ich meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Ich sah schon das Elend vor mir, als meines Mannes Großmutter, die von der Existenz meines Sohnes erfahren hatte, starb.
Sie hinterließ ihm ein immenses Vermögen und ein herrliches Gut, das in ein Kinderheim verwandelt werden soll. Wir sind schon eifrig dabei, und Dominik kann es kaum erwarten, dass seine kleine Freundin Susanne auch zu uns kommt. Ich habe mit Madame Merlinde deshalb bereits korrespondiert, und sie teilte mir mit, dass Sie Ihre Einwilligung dazu geben müssten. Sie selbst hat wohl nichts einzuwenden, zumal seit langem Ihre monatlichen Überweisungen ausblieben.«
»Dafür gibt es nur eine Erklärung«, sagte er zornig. »Ursula hat das Geld nicht abgeschickt.«
Ursula war wohl die Frau, die er hatte heiraten wollen. Armer Kerl, dachte Denise nun mitleidig.
»Die Angelegenheit müssen Sie selbst in Ordnung bringen, Herr Doktor Berkin«, empfahl Denise sachlich. »Ich bin nur gekommen, um Sie zu bitten, Susanne in unsere Obhut zu geben. Ich glaube, dass es das Beste für Ihr Kind wäre, bis Sie wieder Ordnung in Ihr Privatleben gebracht haben. Und ich glaube auch, gestatten Sie mir bitte diese Bemerkung, dass es augenblicklich besser für das Kind ist, wenn alles so bleibt, wie es war. Man muss sie sacht mit dem Gedanken vertraut machen, dass sie einen Vater hat. Sie sollten sich erst einmal unbefangen kennenlernen, bevor das Kind die Wahrheit erfährt. Diese Möglichkeit wäre auf Gut Sophienlust gegeben. Sie dürfen selbstverständlich versichert sein, dass ich alles tun werde, um Ihnen Ihr Kind näherzubringen, wenn Ihnen ernsthaft daran liegt. Aber bedenken Sie bitte, welche Konflikte es für ein Kind heraufbeschwören kann, wenn Sie nicht mit ganzem Herzen und aus innerster Überzeugung eine Beziehung zu ihm aufbauen.«
Seine Miene verriet tiefste Bewegung, als er leise sagte: »Ich bin sehr froh, dass ich Sie kennenlernen durfte, gnädige Frau, und dass Sie gerade heute kamen. Sie verpflichten mich zu tiefer Dankbarkeit. Ich weiß, dass Susanne kein besseres Zuhause finden kann als bei Ihnen. Wenigstens jetzt noch nicht.«
»Dann willigen Sie ein, dass ich sie abhole?«, fragte Denise erleichtert. Zögernd setzte sie hinzu: »Wir werden selbstverständlich in Verbindung bleiben.«
»Und Sie werden selbstverständlich regelmäßig die monatlichen Überweisungen bekommen. Ich werde das niemals mehr einem anderen Menschen überlassen.«
»Davon sollte eigentlich gar nicht die Rede sein«, bemerkte Denise mit einem flüchtigen Lächeln. »Aber ich will es Ihnen überlassen.«
»Ich habe vor, für einige Zeit, vielleicht auch für immer, nach Johannesburg zu gehen«, sprach Günther Berkin weiter. »Würden Sie mir die Möglichkeit geben, Susanne vorher wenigstens einmal zu sehen?«
»Sie sind jederzeit auf Gut Sophienlust herzlich willkommen, Herr Doktor Berkin«, versicherte Denise. »Ich denke, wir werden gemeinsam den richtigen Weg finden, um für Susanne alles bestens zu regeln.«
*
Sie hatten sich mit einem festen Händedruck getrennt, und Günther Berkin hatte versprochen, vor seiner Übersiedlung nach Johannesburg noch nach Sophienlust zu kommen.
Es wird sich alles finden, dachte Denise beschwingt, während sie weiterfuhr. Nicht eine Spur von Müdigkeit überkam sie, obgleich sie doch schon den ganzen Tag unterwegs war. Sie erreichte Haus Bernadette beim Einbruch der Dämmerung.
Die Kinder, die noch im Garten waren, wurden eben zusammengerufen. Denise entdeckte Susanne, die sofort stehenblieb. Sie hatte Dominiks Mutter gleich erkannt.
»Sie sind Nicks Mami«, stellte sie strahlend fest. »Darf ich Nick nun besuchen? Habt ihr jetzt euer schönes Haus?«
»Ein wunderschönes Haus, Susanne«, bestätigte Denise. »Und du darfst ihn nicht nur besuchen, du darfst bei uns bleiben.«
»Sag das noch einmal«, verlangte die Kleine atemlos. »Ist das wahr?«
»Sonst würde ich es nicht sagen«, entgegnete Denise weich. »Ich werde mit Madame Merlinde sprechen.«
»Susanne«, rief die Schwester ungeduldig. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du zu gehorchen hast.«
»Ich brauche Ihnen aber nicht mehr zu gehorchen«, erwiderte Susanne strahlend. »Nicks Mami holt mich ab. Sie werden mich liebhaben und nicht nur schimpfen. Ich gehorche nämlich gern, wenn man nicht schimpft. Das verspreche ich dir … Wie soll ich dich nennen?«
»Vielleicht Tante Isi?«
Susanne lächelte selig. »Nun habe ich eine Tante. Ich habe eine liebe Tante und kann zu Nick. Danke, lieber Gott da oben im Himmel!«
Denises Augen wurden feucht. Was würde wohl Günther Berkin sagen, wenn er das hören könnte.
»Darf ich gleich mitkommen?«, fragte Susanne, die nicht von ihrer Seite wich.
Denise konnte sie nicht enttäuschen. »Ja«, sagte sie zärtlich. »Wir werden im Hotel schlafen. Aber vorher musst du dich noch ein ganz klein wenig gedulden.«
Das wollte Susanne gern.
Madame Merlinde hatte gerade Besuch. Ihre schrille Stimme war sogar durch die geschlossene Tür deutlich vernehmbar.
»Ich sagte Ihnen doch, Frau Trenk, dass ich keine Ausnahme machen kann. Sie haben offenbar keine Ahnung, was der Unterhalt eines solchen Heimes kostet. Wenden Sie sich doch an die Fürsorge. Man wird Ihren Sohn schon unterbringen, bis Sie wieder genesen sind.«
Denise schauderte, als sie diese gefühllosen Worte vernahm.
Bald darauf kam sie heraus: eine blasse, schmale Frau, die verhärmt und niedergeschlagen aussah.
»Ich hatte so viel Hoffnung, dass ich Robby hier unterbringen könnte«, sagte sie schon im Gehen.
»Ich bedauere«, erwiderte Madame Merlinde kalt. »Ach, Frau von Wellentin! Verzeihung, dass Sie warten mussten, verehrte gnädige Frau.«
»Einen Augenblick noch«, unterbrach sie Denise kühl und wandte sich an Frau Trenk. »Wenn Sie bitte auf mich warten wollen?«, meinte sie mit einem freundlichen Lächeln. »Vielleicht kann ich Ihnen helfen.«
Ein verwunderter Blick traf sie, und ein Hoffnungsschimmer trat in die Augen der Frau.
Madame Merlinde hob indigniert die Augenbrauen, wagte aber nicht, eine Bemerkung zu machen.
»Ich habe mit Herrn Doktor Berkin gesprochen«, kam Denise gleich zur Sache. »Hier ist seine schriftliche Einwilligung, dass ich Susanne mitnehmen kann.«
»Und das Geld, das er mir noch schuldet?«, erkundigte sich Madame Merlinde geschäftsmäßig.
»Hier ist auch das Geld«, erklärte Denise kühl. »Es beruht auf einem Versehen, dass es nicht zur rechten Zeit kam. Herr Doktor Berkin war lange im Ausland.«
Es gab nur noch einen kurzen Disput mit Madame Merlinde, dann konnte sich Denise erleichtert verabschieden.
Draußen wartete Frau Trenk, neben ihr Susanne. Denise wollte allerdings nicht, dass das Kind mithörte, was sie mit dieser Frau zu besprechen hatte. Deshalb fasste sie rasch einen Entschluss.
»Wir suchen uns zuerst ein Hotel«, schlug sie vor. »Dann wird Susanne mit uns essen, und später können wir beide uns unterhalten. Ist es Ihnen recht so, Frau Trenk?«
»Robby ist allein«, erwiderte die Frau zögernd. »Wenn ich Sie bitten dürfte, mit in meine Wohnung zu kommen? Sie ist zwar bescheiden, aber für eine Nacht kann ich Sie gern aufnehmen. Ich bin Ihnen so dankbar, und ich kenne noch nicht einmal Ihren Namen.«
»Denise von Wellentin«, stellte sich die andere vor. »Gut, wir kommen gern mit zu Ihnen«, fügte sie hinzu.
Susanne war alles recht. Die Hauptsache war für sie, dass sie sich nicht mehr von ihrer lieben Tante Isi zu trennen brauchte und Nick bald wiedersehen konnte.
Die Wohnung von Frau Trenk befand sich in einem Haus am Ortsende. Es war eine bescheidene, aber sehr ordentliche Behausung, wie Denise feststellen konnte.
Der kleine Robby war ein blasser, stiller Junge, etwa sieben Jahre alt. Er sah die fremde Dame ängstlich an, aber die lebhafte Susanne lenkte ihn rasch ab.
»Robby darf nichts hören«, raunte Frau Trenk Denise zu.
»Wie wäre es dann, wenn ich Sie zum Essen einlade und wir später miteinander sprechen wenn die Kinder schlafen?«, fragte Denise freundlich.
»Sie sind zu gütig, Frau von Wellentin«, entgegnete Frau Trenk. »Dabei weiß ich nicht einmal, ob Sie mir überhaupt helfen können.«
»Ich kann es«, versicherte Denise. Sie ahnte jetzt schon, dass sie nicht nur Susanne mit nach Sophienlust nehmen würde.
Später sprach sie dann mit Frau Trenk über deren Sorgen.
»Ich bin krank, gnädige Frau«, begann sie zögernd.
»Erzählen Sie mir, was Sie bedrückt, liebe Frau Trenk. Sie sind heute nicht die erste, die mir ihr Herz ausschüttet.«
»Sie kommen mir vor wie ein Engel«, meinte die Frau aufatmend. »Ich bin schon lange krank. Mein Mann hat sich von mir getrennt und wieder geheiratet.« Sie kämpfte mit den Tränen, und Denise gab ihr Zeit, sich wieder zu fangen.
»Ich fürchte, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, wenngleich die Ärzte meinen, dass die Operation erfolgreich verlaufen kann«, fuhr Frau Trenk fort.
»Haben Sie Mut«, sprach ihr Denise Trost zu. »Sie müssen für Ihr Kind leben, Frau Trenk.«
»Darum geht es ja. Robby ist ein so lieber Junge. Ich hätte mein letztes Geld gegeben, wenn Madame Merlinde ihn aufgenommen hätte. Ich kann ihn doch nicht in ein Waisenhaus geben, dann hätte er doch gar keine Hoffnung, dass ich noch einmal zu ihm zurückkehre. Aber Madame Merlinde hat abgelehnt.«
»Sie brauchen sich um Robby keine Sorgen zu machen, Frau Trenk. Ich habe ein Kinderheim. Dort wird Ihr Junge gut aufgehoben sein, bis Sie wieder gesund sind. Und dort können Sie sich selbst auch erholen, wenn Sie die Operation hinter sich haben.« Herzlich und überzeugend kamen ihr die Worte über die Lippen, aber die erhoffte Wirkung blieb aus.
»Wenn ich wieder gesund werde«, flüsterte sie verzweifelt, »aber wenn ich sterbe? Dann ist Robby allein.«
»Daran denken Sie jetzt nicht«, sagte Denise eindringlich. »Er wird nie mehr allein sein, wenn Sie ihn mir anvertrauen.«
»Aber wird es auch Ihnen nicht zu wenig sein, was ich zahlen kann?«, fragte Frau Trenk niedergeschlagen.
»Sie brauchen gar nicht zu zahlen«, erwiderte Denise energisch.
»Das gibt es doch nicht, das kann es doch nicht geben. So viel Güte ist doch unmöglich.«
»Reden wir nicht von Güte, sondern nur davon, dass Sie Mut und Kraft schöpfen, um eines Tages Ihrem Jungen wieder eine fröhliche Mutter zu sein. Robby wird bei uns nichts vermissen. Er wird unter fröhlichen Kindern leben, und deshalb dürfen auch Sie nicht den Mut verlieren, liebe Frau Trenk.«
*
Staunend vernahm Robby am anderen Morgen, dass er zu einem langen Ferienaufenthalt verreisen durfte. Zwar fiel ihm der Abschied von seiner Mutter schwer, aber welches Kind freute sich nicht trotzdem, wenn ihm Dinge versprochen wurden, die ihm wie ein Märchen erscheinen mussten.
*
Günther Berkin hatte es nicht geschafft, noch am gleichen Tag zu Ursula zu gehen.
So hatte er die Nacht in einem kleinen Hotel verbracht und sich alles, was er mit Denise von Wellentin besprochen hatte, noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
Das war eine Frau, wie man sie wohl so schnell nicht wiederfand. Konnte er nicht auch einmal so einer Frau begegnen, die Güte und menschliche Wärme besaß? Aber war nicht Ines Jakobus eine ähnliche Frau? Nur so schön war sie nicht wie Denise von Wellentin, und diese Schönheit konnte wohl keinen Mann unbeeindruckt lassen.
Schön und gleichzeitig gut, das war fast zu viel. Jetzt erst wurde ihm so recht bewusst, wie leer und berechnend Ursula war. Gott sei Dank fiel es ihm noch zur rechten Zeit auf. Auch das hatte er Denise zu verdanken, neben allem, was sie für seine kleine Tochter zu tun bereit war.
Nach dieser Nacht fühlte Günther Berkin sich fähig, Ursula so zu begegnen, wie es notwendig war, um reinen Tisch zu machen.
Sie empfing ihn mit einem Lächeln, das allerdings sofort erstarb, da er zurückwich, als sie ihn küssen wollte.
»Lassen wir das, Ursula«, sagte er eisig. »Ich bin nur gekommen, um einiges endgültig klarzustellen.«
Es kam zu einem hässlichen Wortwechsel, aber Günther Berkin fühlte sich wie befreit.
»Die Wohnung kannst du behalten«, sagte er am Schluss. »Ich brauche sie ja nicht. Für die Schulden, die du gemacht hast, wirst du allerdings selbst aufkommen müssen. Ich werde noch einmal ganz von vorn anfangen. Aber diesmal werde ich dabei nur an Susanne denken.«
Viel Geld besaß er nun nicht mehr. Er würde bei seiner Firma um Vorschuss bitten müssen, und deshalb schämte er sich. Was sollte man von ihm denken? Er hatte während der letzten Monate gut verdient, aber alles Geld hatte er Ursula gegeben.
Doch vielleicht war das die Lehre, die er bekommen hatte, wert. Eine Kämpfernatur war er bisher nie gewesen, aber seit er mit Denise von Wellentin gesprochen hatte, fühlte er sich wie befreit, und dafür wollte er nun auch einiges wagen.
Seine Stellung in Johannesburg konnte er nach einem vierzehntägigen Urlaub antreten, und er hatte nicht nur die restliche Gehaltszahlung, sondern auch einen sehr anständigen Vorschuss für die Übersiedlung bekommen.
Ob er es wagen konnte, jetzt schon nach Sophienlust zu fahren? Sicher würde Frau von Wellentin ihm auch diesmal Verständnis entgegenbringen, zumal es sicher ein Jahr dauern würde, bevor er wieder nach Deutschland kommen konnte.
*
Susanne und Robby waren nun schon vier Tage in Sophienlust, und immer gab es ständig neue Überraschungen für sie.
Dominik hatte seine kleine Freundin jubelnd begrüßt, und sie war zunächst nicht von seiner Seite gewichen. Dies war auch wohl der Grund, weshalb Robby und Mario sich ganz eng aneinander anschlossen. Sie hatten das gleiche stille Naturell, und Robby, der drei Jahre älter war, besaß die nötige Geduld für Mario, der mit sicherem Instinkt gefühlt hatte, dass Robby auch seinen Kummer mit sich herumtrug, genau wie er.
Sie hatten ein gemeinsames Zimmer bezogen, während Susanne im Zimmer neben Dominik schlief.
Es ließ sich alles recht gut an. »Man kann sich wenigstens langsam an die wachsende Kinderzahl gewöhnen«, meinte Claudia scherzend. Sie fand nun auch ab und zu wieder Zeit, sich mit Lutz Brachmann zu treffen.
Der junge Rechtsanwalt, dessen Vater die Vermögensverwaltung für Denise von Wellentin und ihren Sohn übertragen war, hatte sich sofort in Claudia verliebt, als diese nach Gut Sophienlust kam. Und wenn sie auch noch nicht so rasch heiraten würden, gesprochen wurde doch schon häufig davon, und wenn es nach Lutz gegangen wäre, hätte man nicht mehr lange gewartet.
Aber Claudia hatte ihre Grundsätze.
Zuerst musste auf Sophienlust alles geregelt sein. Denise konnte es allein nicht schaffen, obgleich die alten wie auch die neuen Angestellten mit Feuereifer dabei waren.
Aber Claudia, die gelernte Krankenschwester, hatte mehr Erfahrung als Denise. Jetzt waren erst fünf Kinder im Haus, die kleine Petra, die von ihrer Mutter ausgesetzt worden war, eingeschlossen. Aber bei den fünf Kindern sollte es nicht bleiben.
Petras Mutter hatte sich noch nicht gemeldet, obgleich sie es auf einem Zettel, den sie bei dem Baby zurückgelassen hatte, ankündigte, dass sie ihr Kind eines Tages wieder zu sich nehmen wollte.
Niemand konnte allerdings ahnen, dass Edith Gerlach, Petras Mutter, ganz in ihrer Nähe lebte, und zwar im Haus Hubert von Wellentins, als Gesellschafterin seiner Frau.
Hubert und Irene von Wellentin, Dominiks Großeltern, hatten seinerzeit die Heirat zwischen ihrem Sohn und Denise verhindern wollen, und noch immer waren sie nicht bereit, die Rechte ihres Enkels anzuerkennen. Sophie von Wellentins Testament war ein Schock für sie gewesen, aber nicht nur das. Es hatte sie auch viele Sympathien gekostet. Nun, nachdem alle Leute über die Geschichte Bescheid wussten, zeigte man ihnen, wie man über sie dachte.
Denise hatte in dieser kurzen Zeit so viel Gutes getan, dass man darüber nicht hinwegsehen konnte, und immer öfter hörte man, dass besonders Hubert von Wellentin ein herzloser, gefühlskalter Geschäftsmann sei, der nur auf seine eigenen Interessen bedacht sei und sich mit aller Rücksichtslosigkeit behaupten wollte.
Seine Gattin litt unter diesen Reden. Edith Gerlach wusste das besser als jeder andere. Sie war sechs Wochen als ihre Reisebegleiterin mit ihr unterwegs gewesen. Für sie war diese Stellung eine Rettung aus höchster Not, denn was hätte sie mit ihrem unehelichen Kind anfangen sollen?
In dieser verzweifelten Lage hatte sie damals ihr Kind vor die Tür des fremden Gutshauses gelegt und gehofft, dass es dort liebevoll aufgenommen werden würde. Damals war sie fremd gewesen und hatte noch nicht gewusst, dass Denise von Wellentin hier ein Kinderheim aufbaute. Sie hatte auch nicht die geringste Ahnung, wie feindselig Denises Schwiegereltern der jungen Frau gegenüberstanden.
Manches hatte Edith auf der Reise erfahren. Irene von Wellentin brauchte einen Menschen, mit dem sie sprechen konnte, und Edith, das stille, bescheidene und selbst am Leben fast verzweifelte Mädchen, war ihr dafür gerade zur rechten Zeit gekommen.
»Sie war eine Tänzerin«, hatte Irene von Wellentin erzählt, »und Dietmar war unser einziger Sohn. Wir hatte ein reizendes Mädchen für ihn auserwählt, das in unsere Kreise gepasst hätte. Es war ein schwerer Schlag für uns, dass er sich gegen uns stellte, aber damals hatte meine Schwiegermutter auch Verständnis für unsere Entscheidung.
Und dann hat sie dieses Testament hinterlassen. Wir fielen aus allen Wolken. Wir wussten ja gar nicht, dass Dietmar diese Person geheiratet hatte, und schon gar nicht, dass er einen Sohn hatte.«
So nach und nach hatte Edith dann auch noch manches andere erfahren, und langsam kam sie zu der Erkenntnis, dass Irene von Wellentin ihre damalige Haltung schon lange bereute. Aber ihr Mann war der Motor, die treibende Kraft. Sie hatte nicht die Kraft und auch nicht den Mut, sich gegen ihn aufzulehnen.
So war sie glücklich, als Edith zustimmte, auch nach der Reise weiterhin bei ihr zu bleiben. Für Edith Gerlach bot sich damals die Gelegenheit, in der Nähe von Sophienlust zu leben und vielleicht doch von Zeit zu Zeit etwas über das Schicksal ihres Kindes zu erfahren.
Dass man Petra dortbehalten hatte, wusste sie, und gar zu gern wäre sie einmal hinübergefahren. Aber wenn die Wellentins davon erfahren hätten, hätte sie ihre gute Stellung bestimmt verloren. Das konnte sie nicht riskieren. Sie bekam ein großzügiges Taschengeld und konnte, bei ihren eigenen bescheidenen Ansprüchen, fast alles sparen.
Hubert von Wellentin wurmte es maßlos, dass Denise sich innerhalb kurzer Zeit schon so viel Ansehen erworben hatte. Auf ihre Initiative hin plante man im Dorf den Neubau der Schule. In wenigen Tagen sollte der Grundstein gelegt werden, und zwar nicht von ihm, sondern von Denise.
Es war ein schwerer Schlag für ihn gewesen. Oft genug war man vorher an ihn herangetreten, diesen Schulbau, der schon so lange nötig war, zu fördern, aber er hatte kein Interesse dafür gezeigt. Denise dagegen hatte nicht gezögert.
An diesem Tag dachte Denise allerdings nicht an die Grundsteinlegung, denn einmal hatte Alexander von Schoenecker seinen Besuch angekündigt, und zum anderen hatte Dr. Berkin angerufen, dass er sie vor seiner Reise nach Johannesburg noch einmal aufsuchen wollte.
Alexander von Schoenecker, der Herr auf Gut Schoeneich, früh verwitwet und Vater zweier Kinder, war für Denise ein Problem geworden.
Sie hatte zu dem stillen, verschlossenen Mann schnell einen sehr guten Kontakt gefunden, ja, man konnte sagen, dass sie schon bald gute Freunde geworden waren.
Die achtjährige Andrea war während der Pfingstferien täglich bei ihnen gewesen. Manchmal war auch Sascha, sein zehnjähriger Sohn, gekommen, ein störrischer kleiner Bursche, der sehr unter dem Einfluss seiner Großmutter stand, bei der er nun auch wohnen sollte, während er das Gymnasium in der Stadt besuchte.
Andrea, die sich zur Zeit noch in einem Internat befand, wünschte sich aber nichts sehnlicher, als wieder nach Schoeneich zu ihrem Vater zurückzukehren, damit sie recht oft in Sophienlust bei den anderen Kindern sein könnte, mit denen sie sich so gut verstand.
Darüber wollte Alexander von Schoenecker heute mit Denise sprechen. Aber für ihn war es gewiss nicht der einzige Grund, sie aufzusuchen.
Denise sah seinen Besucher stets mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie fürchtete für sich selbst, dass er ihr eines Tages zu viel bedeuten könnte. Der Gedanke, dass es bei ihm auch so sein könnte, kam ihr gar nicht. Fest stand für sie, dass sie zu oft an ihn dachte.
Da fuhr auch schon sein Wagen vor.
Dominik sprang gleich darauf zu. Sie waren schon gute Freunde geworden. Allerdings wurde ihm da auch jeder Wunsch erfüllt.
Vier Ponys waren mittlerweile von Gut Schoeneich nach Sophienlust übergewechselt, und heute hatte Alexander auch wieder eine Überraschung für ihn parat.
Sie war so überwältigend, dass Dominik ganz vergaß, Susanne vorzustellen. Die blieb verblüfft stehen, als Herr von Schoenecker ein großes Vogelbauer aus seinem Wagen holte.
Darinnen saß ein prächtiger Papagei, noch viel prächtiger als die alte Lora auf Gut Schoeneich, die Nick wegen ihres großen Sprachschatzes so sehr bewundert hatte.
»Es ist keine Lora, es ist ein Habakuk«, erklärte Alexander von Schoenecker lächelnd, während er sich nach Denise umsah.
»Ich bin der schöne Habakuk«, kreischte der Papagei denn auch sogleich und schlug mit den Flügeln.
»Guten Tag, guten Tag! Nick ist ein braver Junge.«
Nick war sprachlos. Er brauchte lange, um sich von dieser Überraschung zu erholen, und während dieser Zeit begrüßte Alexander auch die anderen Kinder, die sich mittlerweile um ihn geschart hatten. Langsam kam auch Denise näher, die ganz plötzlich ein heftiges Herzklopfen verspürte.
»Das ist also die Susanne«, sagte Alexander von Schoenecker herzlich. »Fein, dass du nun auch da bist!«
»Woher weiß der Habakuk, dass ich Nick heiße?«, fragte der Junge.
»Ich habe ihm erzählt, dass er zu einem braven Nick kommt.«
»Braver Nick, Habakuk lieb. Schöner Habakuk. Hahahaha!«
Die Kinder lachten mit, und Nick fiel Alexander von Schoenecker begeistert um den Hals.
»Du bist der liebste, beste Onkel, den es gibt«, strahlte er. »Du hast mir schon soviel geschenkt. Jetzt muss ich dir aber wirklich auch mal was schenken.«
»Das hast du bereits«, sagte Alexander leise. »Ich kann mich wieder freuen.«
Nick schmiegte seinen Kopf an die Schulter des Mannes. »Andrea ist doch auch sehr lieb«, meinte er. »Kommt sie nun bald?«
»Darüber will ich eben mit deiner Mutti sprechen. Ihr seid ja jetzt mit Habakuk beschäftigt.«
»Sie verwöhnen ihn zu sehr«, sagte Denise drinnen im Haus befangen.
»Iwo«, wehrte er ab. »Wie geht es, Denise? Die Familie ist ja schon sehr im Wachsen begriffen.«
Sie erzählte ihm rasch Robbys Geschichte. Dass Susanne einen Vater hatte, behielt sie für sich.
Immer wieder musste sie ihn ansehen. Wie sehr hatte er sich in diesen wenigen Wochen verändert. Sein früher so düsteres, schwermütiges Gesicht wirkte um Jahre jünger. Wenn er lächelte, hielt sie jedesmal den Atem an.
Er war so ganz anders als Dietmar gewesen war. Alexander war ein richtiger Mann.
»Andrea hat mir schon wieder einen Brief geschrieben«, begann er zögernd. »Sie kann die Sommerferien schon nicht mehr erwarten. Wenn wir den Schulbau schnell vorantreiben könnten, würde ich sie danach gern hierbehalten. Ich meine nur, dass Sie sie dann oft hier haben werden, Denise.«
»Meinetwegen könnte sie auch ganz hier wohnen«, erwiderte sie herzlich. »Dann hätte sie es nicht so weit zur Schule, und Sie können sie ja sehen, sooft Sie Zeit haben, Alexander.«
»Es wäre ein Grund mehr für mich, noch öfter nach Sophienlust zu kommen«, antwortete er, und Denise senkte den Kopf. »Wenn ich Ihnen nicht zur Last falle«, setzte er hinzu.
»Wie können Sie nur so etwas sagen«, wehrte sie ab. »Wir freuen uns alle. Sie sehen doch, wie sehr Nick an Ihnen hängt.«
Sie dachte an seinen Sohn Sascha, der seinem Vater so ablehnend gegenüberstand. Er schien ihre Gedanken zu erraten.
»Von Sascha habe ich noch nichts gehört, seit er bei meiner Schwiegermutter ist«, berichtete er niedergeschlagen. »Er wird mir ganz entwachsen, Denise.«
Sie sah ihn mitfühlend an. »Es ist alles sehr schwierig. Wie kann ich Ihnen nur helfen? Aber vielleicht ändert er sich, wenn Andrea hier ist.«
»Sie kennen meine Schwiegermutter nicht«, meinte er bitter.
»Geduld«, sagte sie herzlich. »Es wird sich alles von selbst entwirren. Vielleicht wird sogar eines Tages noch Herr von Wellentin zur Vernunft kommen.«
Er schüttelte den Kopf. »Ausgeschlossen!«
Sie lächelte. »Warten wir’s ab. Das Leben kann schön sein, Alexander, ich wollte es früher auch nicht mehr glauben. Ist es nicht ein wundervolles Gefühl, nicht allein zu sein. Menschen zu haben, mit denen man sich versteht, die man gern hat, und die man nicht mehr missen möchte.«
»Auch für mich ist das Leben wieder lebenswert geworden, Denise«, sagte er und zog ihre Hand an seine Lippen. Ganz flüchtig spürte sie seinen Mund darauf, und eine seltsame Sehnsucht erfasste sie.
Aber da erschien Magda mit der Nachricht, dass ein Herr Dr. Günther angekommen sei.
Denise hatte mit ihm verabredet, sich unter diesem Namen auf Sophienlust einzuführen, denn Susanne wusste ja, dass sie den Namen Berkin trug. Sie sollte nicht stutzig werden.
»Wer ist das?«, fragte Alexander hastig. »Ein Freund von Ihnen?«
»Auch ein Mann, der Schweres erlebt hat. Ich werde später einmal mit Ihnen über ihn sprechen, Alexander. Bleiben Sie noch zum Essen?«
Er lehnte ab. Sie konnte sich sein verändertes Benehmen nicht erklären. Dass Günther Berkin der Grund sein könnte, zog sie gar nicht in Betracht.
Aber Alexander verspürte eine noch stärkere glühende Eifersucht, als er den gutaussehenden, noch jungen Mann sah, der Denise mit einem bewundernden Blick betrachtete.
»Onkel Alexander, willst du nicht nach den Ponys schauen?«, rief ihm Dominik enttäuscht nach.
»Ein andermal, Nick«, erwiderte er tonlos. »Auf Wiedersehen, Denise!«
Sie sah ihm bestürzt nach.
»Nanu«, ließ sich Claudia vernehmen. »Was hat er denn? Er hat mir nicht einmal guten Tag gesagt.«
Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit Dr. Berkin zu. Sie war die einzige, die wusste, wen sie vor sich hatte. Claudia war überrascht. Auch sie hatte sich Berkin ganz anders vorgestellt.
»Die Kinder sind sehr beschäftigt«, erklärte sie. »Herr von Schoenecker hat ihnen einen Papagei mitgebracht. Ich weiß Bescheid, aber sonst niemand. Kommen Sie mit! Besuch bringt immer Abwechslung.«
Denise überließ es Claudia gern, ihn zu den Kindern zu führen.
Habakuk schrie, lachte und kreischte. Die Kinder bestaunten ihn und konnten sich nicht von ihm trennen. Sie merkten es gar nicht, als Claudia und Dr. Berkin eintraten.
Günther hatte Muße, seine Tochter Susanne zu betrachten. Es war ein ganz eigentümliches Gefühl, das ihn nun bewegte. Er hatte sie als kleines Kind zum letztenmal gesehen.
Das ist meine Tochter, dachte er erschüttert. Ich kannte sie nicht, und sie kennt mich nicht. Dass sie so hübsch sein könnte, hatte er sich auch nicht vorgestellt. Aber dennoch war sie ihrer Mutter nicht so ähnlich, wie er es befürchtet hatte.
Plötzlich wandte sie sich um und sah ihn an. »Da ist ein Mann«, rief sie. »Was will er, Tante Claudia?«
»Herr Doktor Günther will euch besuchen«, erklärte Claudia.
»Will er auch ein Kind herbringen?«, fragte sie sofort interessiert.
»Wollt ihr nicht erst einmal guten Tag sagen?«, schlug Claudia vor. Sie taten es. Susanne machte einen artigen Knicks, die beiden Jungen eine höfliche Verbeugung.
Jetzt vermisste Susanne Dominik. »Nick ist gar nicht da. Ich muss gleich mal gucken, wo er steckt.«
Und schon lief sie davon. Der fremde Herr interessierte sie bei weitem nicht so sehr wie Nick.
Claudia führte Dr. Berkin in den Salon. Nun gesellte sich auch Denise zu ihnen.
»Sie ist ein sehr lebhaftes Kind«, sagte Dr. Berkin leise. »Und sie ist so reizend.«
»Wir haben viel Freude an ihr«, erwiderte Denise herzlich. »Sie und Nick sind unzertrennlich. Aber wir werden schon eine Gelegenheit finden, dass Sie auch einmal mit ihr allein sein können. Wie lange wollen Sie bleiben?«
»Einige Tage. Es kommt ganz darauf an«, erwiderte er ausweichend.
»Wir haben schon ein Gästezimmer für Sie hergerichtet«, versuchte ihm Denise seine Scheu zu nehmen.
»Aber ich möchte Ihnen doch keine Umstände machen«, erwiderte er verlegen. »Und auch keine Unannehmlichkeiten.«
»Davon kann gar keine Rede sein. Wir haben genug Platz.«
*
Was erwarte ich eigentlich?, dachte derweil Alexander von Schoenecker. Soll Denise keinen anderen Mann anschauen als mich, darf sie keinen anderen kennen? Was kann ich ihr schon bieten außer zwei Kindern, von denen zumindest eines ihr immer nur mit Feindseligkeit begegnen würde.
Für Sascha war seine verstorbene Mutter nicht zu ersetzen. Seine Großmutter hatte alles getan, um eine Heilige aus ihr zu machen, und die Kinder hatten sie, mit einem Glorienschein umgeben, in ihrer Erinnerung behalten.
Alexander von Schoenecker wusste heute nur zu gut, wie unwahr dieses Bild war. Er hatte Sybille geliebt, hatte sie förmlich angebetet, bis ihm eines Tages bewusst geworden war, dass er nicht der einzige Mann in ihrem Leben war.
Er hatte gemeint, die Welt müsste einstürzen, aber sie hatte ihm diesen Gefallen nicht getan. Leben und lieben, das war Sybilles Devise gewesen. Die Kinder hatte sie gern ihrer Mutter überlassen, einer Mutter, die in ihr nur das sah, was sie sehen wollte, und die alles das abstritt, wovon sie nichts wissen wollte.
Aber darüber konnte er selbst mit Denise nicht sprechen. Er hatte sich nur fest vorgenommen, die nötigen Lehren aus dieser Enttäuschung zu ziehen.
Er wollte Sybille nicht vergessen, und er wollte vor allem nicht vergessen, was sie ihm angetan hatte.
Sybilles Bild sollte eine ewige Mahnung für ihn sein, sich nie mehr ganz an eine Frau zu verlieren.
Und nun, vier Jahre nach Sybilles Tod, war es trotzdem geschehen.
Zuerst war es Denises Ähnlichkeit mit Sybille gewesen, die ihn faszinierte. Er war sofort bereit gewesen, den alten Wellentins recht zu geben, die meinten, dass ihr Sohn seine Gefühle an die falsche Frau verschenkt hatte. Aber schon nach kurzer Zeit hatte er feststellen können, dass Denise im Wesen ganz anders war als seine verstorbene Frau. Sie war aufrichtig bis ins Innerste ihrer Seele. Nur was ihn selbst anbetraf, war er nicht sicher, was Denise wirklich fühlte. Sosehr er auch hoffte, dass es mehr als Freundschaft sein würde, war er doch stets voller Zweifel.
Und nun war da noch ein anderer Mann aufgetaucht. Einer der jünger war als er, der gut aussah und der sie mit Blicken betrachtete, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigließen.
War es nicht albern von ihm gewesen, so rasch aufzubrechen, anstatt sich diesen Mann genauer anzuschauen und zu ergründen, wie Denise zu ihm stand? Wie ein dummer Junge benahm er sich, nicht wie ein Mann, der feste Grundsätze hatte.
Aber Denise hatte ihn völlig durcheinandergebracht. Tag und Nacht verfolgte sie ihn. Ihre Nähe weckte ein glühendes Verlangen in ihm, und gerade heute war er wieder versucht gewesen, sie in seine Arme zu reißen und zu küssen.
Es zog ihn nicht nach Schoeneich. Er wollte nicht allein sein. Auf halbem Weg kehrte er wieder um, aber er fuhr nicht nach Sophienlust zurück, sondern fasste den Entschluss, seine Kusine Barbara zu besuchen, die früher einmal von den Wellentins dazu ausersehen gewesen war, ihren Sohn zu heiraten.
Jetzt war sie mit Dr. Baumgarten verheiratet, dem Landarzt, den jeder weit und breit kannte, liebte und verehrte. Sie war glückliche Mutter von zwei Kindern und eine prächtige Ehefrau.
Barbara hatte genau gewusst, für wen sie sich entscheiden sollte, damals vor fast sechs Jahren. Sie hatte sich bereits entschieden gehabt. Für Dr. Werner Baumgarten. Niemand hätte sie von diesem Entschluss abbringen können.
»Xander, wie nett, dass du uns besuchen kommst«, rief sie, als er durch das Gartentor trat. Sie hatten sich ein hübsches Haus gebaut, und Barbaras Hobby war es, den Garten in ein wahres Paradies zu verwandeln. Ihre beiden Söhne Frieder und Axel kamen aus dem Sandkasten, um Alexander strahlend ihre schmutzigen Hände entgegenzustrecken.
»Ich komme ja augenblicklich zu gar nichts mehr«, stöhnte sie. »So gern wollte ich schon mal bei dir in Schoeneich vorbeischauen, aber Werner ist derartig eingespannt, dass manches an mir hängenbleibt. Man bekommt ja keine richtige Hilfe. Die Mädchen wollen alle nicht mehr aufs Land, und zu einem verheirateten Arzt schon gar nicht.«
Aber trotz ihrer Klagen sah es nicht so aus, als haderte sie mit ihrem Schicksal.
Sie war ziemlich groß und wirkte mit ihrem kurzgeschnittenen rötlichen Haar eher wie ein junges Mädchen als wie die Mutter von zwei Kindern.
»Nun komm schon herein!«, forderte sie ihren Cousin auf. »Ich wasche mir nur die Hände, dann machen wir es uns auf der Terrasse gemütlich. Werner ist über Land. Es wird Zeit, dass sich hier noch ein Arzt niederlässt.«
Sie war rasch zurück, brachte ein Tablett mit Kuchen und Kaffee und er konnte sich nur immer wieder wundern, wie selbstverständlich dieses einstmals so verwöhnte Mädchen ihren Haushalt bewältigte.
»Nun erzähl! Wie geht es dir, wie geht es den Kindern?«, fragte sie. »Warst du mal wieder in Sophienlust?«
»Ich komme eben von dort«, gab er wortkarg zurück.
Sie musterte ihn mit einem nachdenklichen Blick. »Und wie geht es Denise?«, fragte sie dann. »Schade, dass ich so wenig Zeit habe. Ich würde sie gern öfter treffen.«
Sie hatten sich nur einmal kurz kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden.
»Sie hat mittlerweile noch ein paar Kinder dazubekommen, und jetzt geht es schon ganz schön rund.«
»Man muss sie bewundern. Ich glaube, der alte Wellentin platzt eines Tages noch vor Wut, dass sie alles so aus dem Handgelenk schüttelt. Ich finde sie großartig. Und du auch, nicht wahr, Xander?«, fügte sie leise hinzu.
»Ich bewundere sie.«
Ein unergründliches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Ich werde kaum mit zweien fertig, wie will es Denise da mit zwanzig schaffen. Wie ist es nun mit Andrea? Holst du sie heim, Xander?«
»Ich möchte schon.«
»Was ist eigentlich mit dir los? Sprich dich doch aus! Mit mir kannst du doch offen reden. Machst du dir Sorgen wegen Sascha?«
»Natürlich auch.«
»Du hättest es nicht zulassen sollen, dass er zu deiner Schwiegermutter kommt. Ich kenne sie doch.« Barbara nahm kein Blatt vor den Mund. Sie hatte die Baronin Klees noch nie leiden können, und sie hatte sich auch mit Sybille nie sonderlich gut verstanden.
»Eigentlich möchte ich es ihr schon mal sagen, was ihre Tochter alles so nebenbei getrieben hat, damit sie zur Vernunft kommt. Entschuldige bitte, Xander, ich wollte dich nicht kränken, aber manchmal läuft mir die Galle über, wenn ich darüber nachdenke.«
»Denk lieber nicht darüber nach. Sybille ist tot. Sie kann sich nicht mehr verteidigen«, sagte er müde.
Sie blickte ihn ernst an. »Du bist ein feiner Kerl, aber wir wissen doch genau, was gewesen ist. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Was meinst du denn, was heute wäre, wenn sie noch leben würde. Du wärst zermürbt, restlos zermürbt. Und was würden deine Kinder dann sagen? Sie würden ihre Mutter bestimmt nicht mehr derart verherrlichen, weil sie jetzt schon Verstand haben. Sie würden vielleicht auch schon empfinden, dass du leidest.«
»Ich leide nicht mehr!«, wehrte er barsch ab.
»Aber wie du gelitten hättest! Xander, nichts habe ich in meinem Leben bisher so sehr bedauert, als dir mein Schweigen in dieser Sache versprochen zu haben.« Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort: »Du hast die Pflicht, Xander, Sascha davor zu bewahren, dass sein junges Leben derart vergiftet wird. Noch ist er jung genug, um geformt zu werden. Du sagtest doch, dass er während der letzten Tage in Sophienlust sehr verträglich war.«
»Er fühlte wohl, wie fröhlich und aufgeschlossen die anderen Kinder waren. Aber er sah auch, wie Nick an seiner Mutter hängt, und wie gut sie sich verstehen. Das vermisst er.«
»Mit seiner Mutter hätte er sich doch gar nicht so verstehen können. Er hat vergessen, dass sie die Kinder immer vernachlässigt hat. Er hat nur in sich aufgenommen, was seine Großmutter ihm da an Unsinn erzählte. Wie fröhlich sie war, wie gern sie lachte. Nun ja, das tat sie ja auch, sofern sie genügend Anbeter um sich versammelt hatte«, schloss sie bitter.
»Es ist ja alles richtig, was du sagst, Babs, aber ich wollte es doch nicht anders. Ich war glücklich, als sie meine Frau wurde.«
Sie betrachtete ihn mitfühlend. Ja, er war glücklich gewesen, aber viel zu jung, um zu begreifen, dass Sybille von Klees ihn nur nahm, weil er der reichste unter ihren Verehrern war. Und als sie dann ein paar Jahre später die Erbschaft machte, bereute sie längst, ihn geheiratet zu haben.
Doch jetzt wollte sie ihn ablenken. Sie hatte fast zu viel gesagt.
»Übrigens bekommen wir wieder Zuwachs«, erzählte sie munter. »Jetzt wirft sich für mich nur die Frage auf, wohin mit den beiden Rangen, wenn es soweit ist. Mama fühlt sich ihnen nicht mehr gewachsen.«
»Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah«, lachte er. »Sophienlust ist wahrlich nah genug und meinst du, dass für Frieder und Axel dort nicht auch Platz wäre?«
»Das Gute liegt wirklich oft zu nahe«, lachte sie. »Aber wir laden Denise ganz schön viel auf, meinst du nicht? Sie wäre so sehr geschaffen, eine eigene große Familie zu haben und einen Mann, der sie zu schätzen weiß, und mehr als das. Kein Mensch kann ohne Liebe leben.«
Das Blut stieg ihm ins Gesicht. Die brennende Sehnsucht und die glühende Eifersucht, die ihn erfüllten, beherrschten ihn wieder völlig.
Babs drückte seine Hand.
»Ich bin ja schon froh, dass du wieder aus deinem Bau herauskriechst, Xander«, sagte sie herzlich. »Ich habe mir wirklich große Sorgen um dich gemacht. Und im übrigen: Kommt Zeit, kommt Rat.«
*
Denise brachte die Kinder heute allein zu Bett. Lutz Brachmann hatte Claudia abgeholt. Endlich wollten sie wieder mal einen Abend für sich allein haben.
Nick machte einen recht betrübten Eindruck. »Ich habe mich bei Onkel Alexander noch gar nicht richtig für Habakuk bedankt, Mutti. Kann ich ihn nicht wenigstens noch mal anrufen«, bettelte er.
Denise erlaubte es ihm. Allerdings dachte sie dabei auch an sich, denn dann konnte sie Alexanders Stimme auch noch einmal hören.
Sie klang allerdings sehr niedergeschlagen, als er sich meldete.
»Schade, dass Sie uns heute so schnell verlassen haben«, sagte sie. »Die Kinder haben so viel Spaß mit dem Papagei.«
»Ich war noch bei Barbara. Sie wird in den nächsten Tagen selbst bei Ihnen vorbeischauen, Denise. Sie hat auch ein Anliegen. Jeder lädt offenbar sein Sorgenpäckchen bei Ihnen ab. Wird es Ihnen nicht zu viel?«
»Ist es nicht das Schönste, wenn man andern helfen kann?«, fragte sie leise. »Aber jetzt drängelt Nick. Er will unbedingt mit Ihnen sprechen, sonst kann er nicht schlafen. Kommen Sie bald wieder, Alexander!«
»Wie wäre es, wenn Sie nach Schoeneich kämen?«
»Ich werde es im Auge behalten«, versprach sie.
Aber da war Nick schon da und redete auf Alexander ein. Richtig lieb klang sein Stimmchen. Denise hörte gerührt zu. Wenn der Junge einen solchen Vater hätte! Aber wohin verstiegen sich ihre Gedanken.
»Wie lange bleibt der Herr Doktor Günther?«, wurde sie bald darauf von Susanne interviewt. »Wieso darf er auch hier wohnen? Er ist doch kein Kind mehr.«
»Aber er möchte Gutes für die Kinder in Sophienlust tun«, erklärte ihr Denise sanft.
Susanne dachte nach. »Das ist sehr nett von ihm. Dann muss er ein guter Mensch sein. Warum hat er denn keine Kinder. Oder hat er welche?«
Zum Glück enthob Nicks Eintritt sie der Antwort. »Was habt ihr denn wieder so lange zu reden«, meinte er vorwurfsvoll. »Ich bin auch noch da.«
»Aber du kannst ruhig wissen, was wir reden. Wir haben keine Heimlichkeiten«, versicherte sie. »Ich wollte wissen, wie lange der Doktor Günther dableibt.«
»Das möchte ich auch wissen. Will er etwa eines von unseren Kindern haben?«, fragte der Junge aggressiv. »Manchmal kamen zu Madame Merlinde auch Leute, die ein Kind haben wollten, und zwei hat sie auch weggegeben.«
Susanne sah Denise entgeistert an. »Mich gibst du doch nicht weg, Tante Isi?«, fragte sie angstvoll. »Da kann er noch so nett und gut sein. Ich möchte lieber bei euch bleiben.«
Das hatte Denise für Dr. Berkin bereits befürchtet. Es würde ein weiter Weg bis zum Herzen seines Kindes sein.
Nun schliefen sie alle, auch die kleine Petra, die heute ausnahmsweise recht unruhig gewesen war.
Bevor sie zu Bett ging, machte Denise nun ihren abendlichen Rundgang durch den Park. Dort traf sie mit Dr. Berkin zusammen.
»Susanne ist hier sehr glücklich«, bemerkte er. »Sie vermisst nichts.«
»Versetzen Sie sich in ihre kindliche Seele. Wie könnte sie etwas vermissen, was sie nie gehabt hat?« Schonend schilderte sie ihm das Gespräch. Er wurde noch bedrückter.
»Wenn ich nun wieder gehe, ohne dass Susanne erfährt, dass ich ihr Vater bin, wird mir der Weg zu ihr vielleicht für alle Zeiten versperrt bleiben. Aber wenn ich es ihr sage, was meinen Sie, könnte sie sich möglicherweise daran gewöhnen, dass es jemanden gibt, der sie ganz besonders liebt?«
»Tun Sie das denn schon?«, fragte Denise überrascht.
»Es ist fast unbegreiflich, aber es ist so. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Wie konnte ich so viele Jahre darauf verzichten?«
»Ich will es nicht ergründen«, erwiderte Denise. »Sie müssen jetzt ganz Ihrem Gefühl folgen. Vielleicht weist es Ihnen den richtigen Weg. Sie dürfen versichert sein, dass ich jederzeit alles dazu beitrage, Ihnen zu helfen.« Sie lächelte herzlich. »Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie eine Frau finden, die Sie wirklich versteht, und die Susanne eine liebevolle Mutter sein möchte. Dann wird auch für Sie alles gut werden.«
*
Dr. Berkin grübelte danach lange. Wie sollte er es nur beginnen, mit Susanne in ein Gespräch zu kommen.
Am nächsten Tag, die Kinder spielten auf der großen Wiese Blindekuh. Plötzlich drang ein schriller Schrei an sein Ohr, und da er ganz in der Nähe war, konnte Berkin auch als erster zur Stelle sein.
Susanne weinte kläglich und hielt sich ihr Bein. »Eine Wespe hat sie gestochen«, stellte Nick sachkundig fest. »Ausgerechnet Susi. Bei ihr tut’s doch viel weher als bei mir.«
Günther Berkin hob das Kind hoch. »Wir werden es uns gleich genau anschauen«, sagte er tröstend. »Ich habe ein gutes Mittel gegen solche Stiche.«
Das Glück, sein Kind wenigstens im Arm halten zu dürfen, überwältigte ihn fast. Und als sie nun auch noch ihr Köpfchen vertrauensvoll an seine Schulter legte, erfüllte ihn ein nie gekanntes Glück.
»Es tut so weh«, flüsterte sie. »Ich will ja gar nicht weinen, aber ich muss einfach.«
»Weine nur, wenn es dich erleichtert«, empfahl er.
Denise hielt Nick zurück, der seiner kleinen Freundin natürlich Beistand leisten wollte.
»Doktor Berkin wird sie schon beruhigen«, sagte sie. »Spielt ihr nur weiter!«
Er sah sie plötzlich wachsam an. »Du hast eben Doktor Berkin gesagt, Mami«, meinte er. »Und so heißt Susi auch.«
»Nick, mein Junge«, seufzte sie, »bitte stell jetzt keine Fragen. Vielleicht kann ich dir heute Abend eine Geschichte erzählen, aber jetzt noch nicht.«
»Ich will bloß eins wissen, Mutti«, verlangte er. »Will er uns Susi wegnehmen? Dann kann ich ihn nicht leiden.«
»Nein, Susi bleibt bei uns, wenigstens noch einige Zeit«, gab sie zurück. »Aber jetzt sei ein lieber Junge und frag mich nichts mehr.«
Mit einer Pinzette hatte Dr. Berkin den Stachel herausgezogen. Ganz dick geschwollen war das Beinchen. Er betupfte es mit einer braunen Tinktur.
»Nun tut es schon gar nicht mehr so weh«, staunte Susanne. »Wie machst du das, Doktor?«
»Man muss nur das richtige Mittel für alles haben«, erwiderte er mit unsicherer Stimme. »Aber manchmal kann man es nicht gleich finden.«
Susanne warf ihm einen forschenden Blick zu. »Das klingt komisch«, meinte sie. »Warum bist du traurig, Doktor. Jetzt ist mein Bein doch schon viel besser.«
»Du musst aber noch ein bisschen liegenbleiben. Soll ich dir Gesellschaft leisten?«
»Wenn du willst? Nick würde aber auch kommen.«
»Aber ich möchte gern bei dir bleiben«, erklärte er entschlossen.
Sie nickte. »Dann willst du mich vielleicht doch mitnehmen?«, fragte sie beklommen.
»Wie kommst du darauf?«
»Nick hat es gesagt, weil manchmal Leute von Madame Merlinde auch Kinder weggeholt haben. Manche Leute wollen nämlich Kinder und bekommen keine. Das hat mir Claudia erklärt.«
»Und manche Leute haben Kinder und können sie aus einem bestimmten Grund nicht bei sich haben«, gab er zurück.
»Aus was für einem Grund?«, fragte sie interessiert.
»Weil sie arbeiten müssen und Geld verdienen.«
»Wie Nicks Mutti früher«, bestätigte sie. »Sie konnte auch nur zu Besuch kommen.«
»Darf ich dir eine Geschichte erzählen, Susanne?«, begann er stockend. »Sie handelt von einem kleinen Mädchen, das auch Susanne heißt.«
»Dann möchte ich sie gern hören.«
Zögernd kamen die Worte über seine Lippen, dann aber fließender, als er merkte, dass sie gespannt lauschte. Dass ihre Mutter noch lebte, verschwieg er allerdings.
»Und der Papi von der Susanne hatte niemals Sehnsucht nach seinem kleinen Mädchen?«, fragte sie ungläubig, als er schwieg.
»Doch, er hatte oft Sehnsucht, aber er dachte, dass es besser für sie wäre, wenn sie unter netten Leuten und anderen Kindern aufwachsen würde als mit ihm allein. Darum hat er sie lieber auch gar nicht besucht. Was würdest du sagen, Susanne, wenn du einen solchen Vater hättest?«
Sie überlegte eine Weile. »Ich würde ihn mal fragen, warum ich dann nicht auch eine Mami habe«, erwiderte sie schließlich.
Gott steh mir bei, dachte er und antwortete beklommen: »Wenn nun diese Mami kein Kind haben wollte?«
»So wie Petras Mutter? Das kann ich gar nicht verstehen. Petra ist so süß.«
»Du bist auch sehr süß«, meinte er, »und ich habe dich sehr lieb, mein Kind.«
Er konnte es nicht mehr zurückhalten. Susanne starrte ihn an.
»Bist du mein Papi?«, fragte sie ganz langsam.
Er nickte.
»Mein richtiger Papi?«
»Dein richtiger Papi«, bekräftigte er.
»Und meine Mami wollte mich nicht haben? Dann will ich sie auch nicht sehen. Ich habe ja Tante Isi.« Ihr kleines Gesicht wurde ganz ernst. »Du willst mich doch mitnehmen?«, fragte sie dann schluchzend. »Fort von Nick und Tante Isi und den Kindern?«
»Nicht gleich«, wehrte er ab. »Aber ich wäre sehr glücklich, wenn du später einmal zu mir kommen würdest.«
»Wann später?«
»Wenn ich für dich ein schönes Haus gebaut habe, wo du auch alles haben wirst.«
Er war zunächst schon einmal beglückt, dass sein Kind ihn nicht von sich stieß. Ihre Haltung dünkte ihn wie ein Wunder.
»Musst du noch lange arbeiten, bis du ein schönes Haus bauen kannst für mich?«, fragte sie eifrig.
»Ziemlich lange, aber ich werde sehr viel arbeiten, damit ich es bald schaffe«, versprach er.
»Und so lange darf ich hierbleiben?«
Er legte seine Arme um sie und zog sie an sich. »Kannst du mir verzeihen, Susi, dass ich so lange nicht gekommen bin?«
»Vielleicht war es ganz gut so«, meinte sie. »Sonst hätte ich Nick nicht kennengelernt, und bei Madame Merlinde hätte ich nicht so gern darauf gewartet, bis du ein Haus für uns baust.«
»Für uns« hatte sie ganz selbstverständlich gesagt.
»Vielleicht können wir dann auch ein paar Kinder zu uns nehmen, Papi«, überlegte sie weiter. »Es gibt ja noch eine ganze Menge, die gar niemanden haben, nicht einmal einen, der für sie bezahlt.«
Trotz seiner wehmütigen Stimmung musste er lächeln.
»Wohin fährst du, Papi?«, fragte sie interessiert. »Wo musst du arbeiten?«
Er erzählte es ihr ausführlich. »Das ist aber sehr weit weg«, meinte sie bekümmert. »Und ich kann noch nicht schreiben. Aber das wird sicher Tante Isi für mich tun.« Sie betrachtete ihn eingehend. »Jetzt muss ich dich mal ganz genau anschauen. Nun weiß ich doch, wie mein Papi aussieht. Es ist schön«, seufzte sie. »Ich kann jetzt richtig an dich denken und brauche nicht immer den lieben Gott zu bitten, dass er mir mal zeigt, wie mein Papi aussieht.«
»Mein liebes Kind«, flüsterte er erschüttert. »Meine kleine Susi! Du machst mich sehr glücklich. Was meinst du, fahren wir morgen in die Stadt? Dann werde ich dir etwas kaufen, damit du eine Erinnerung an mich hast. Und wir werden uns auch fotografieren lassen, damit du auch ein Bild hast.«
»Das ist schön, aber ich vergesse dich auch so nicht«, erwiderte sie ernsthaft.
Nick erfuhr diese abenteuerliche Geschichte aus Susannes Mund und nicht von seiner Mutter. Susannes rege Phantasie schmückte sie dazu noch so aus, dass ihr Papi dem Zuhörer wie ein Märchenprinz erscheinen musste.
»Ich finde es anständig, dass du hierbleiben darfst«, meinte Nick. »Mami hat sich vorhin verschwatzt«, erklärte er. »Ich habe mir gleich gedacht, dass er dein Vater ist.«
»Er ist genauso nett wie Onkel Alexander, findest du nicht?«, fragte Susanne begeistert.
Nick zögerte. »Für dich vielleicht«, meinte er dann nachdenklich. »Für mich ist Onkel Alexander noch netter.«
*
Es war reiner Zufall, dass sie Alexander von Schoenecker in der Stadt trafen, wo Dr. Berkin mit seiner kleinen Tochter Einkäufe machte.
Susanne hatte eine schöne goldene Kette mit einem Medaillon bekommen, worauf sie mächtig stolz war. Darin konnte sie Papis Bild aufbewahren, und sie durfte die Kette immer tragen.
Natürlich sollten auch die anderen Kinder bedacht werden. Susanne suchte eifrig Geschenke aus. Sie wusste genau, woran Nick, Mario und Robby Freude haben würden.
Unvermittelt entdeckte sie Alexander von Schoenecker. Ihm musste sie die wunderbaren Neuigkeiten natürlich sofort berichten.
»Das ist mein Papi, Onkel Alexander«, stellte sie ihn temperamentvoll vor. »Mein richtiger Papi! Ich bleibe nur noch in Sophienlust, bis er ein schönes Haus für uns gebaut hat.«
Die beiden Männer musterten sich. »Wir hatten neulich keine Gelegenheit, uns einander vorzustellen«, sagte Günther Berkin verlegen. »Ich hatte an diesem Tag auch noch keine Ahnung, dass alles eine so glückliche Wendung für mich nehmen würde.«
Der Ausdruck »glückliche Wendung« erfüllte Alexander mit Eifersucht.
»Papi muss jetzt nach Johannesburg fahren und arbeiten. Er muss viel Geld verdienen«, erzählte Susanne eifrig. »Schau mal, was er mir geschenkt hat. Jetzt habe ich auch einen, der mich lieber hat als alle anderen Kinder. Onkel Alexander hat auch keine Frau«, erklärte sie dann ihrem Vater. »Aber er hat zwei Kinder.«
Es entlockte beiden ein Lächeln. Und Alexander war sichtlich erleichtert, als Dr. Berkin ihm erklärte, dass er schon morgen abreisen müsse.
»Er hat uns die Ponys geschenkt«, erzählte Susanne ihrem Vater auf der Rückfahrt. »Nick hat ihn ein bisschen lieber als dich. Ist das schlimm?«
Sie war beruhigt, als er ihr versicherte, dass es für ihn am wichtigsten sei, wie lieb sie ihn hätte.
»Das ist doch klar«, sagte sie stolz. »Du bist ja mein Papi!« Und sie schmiegte sich an ihn.
Gerade hatte er sie erst gefunden, und nun hieß es schon wieder Abschied nehmen. Es fiel ihm unsagbar schwer, und wenn er die Tränen, die über ihre Wangen rollten, als sie dem Wagen nachblickte, gesehen hätte, wäre es wohl noch viel schlimmer gewesen.
*
Alexander von Schoenecker war kurz entschlossen zu seiner Schwiegermutter gefahren. Barbara hatte recht. Er musste endlich mit ihr sprechen.
Die Baronin Klees empfing ihn kühl und abweisend. »Ich halte es für besser, wenn du nicht hierherkommst«, erklärte sie sofort. »Sascha ist bei mir so ausgeglichen. Wenn er dich trifft, wird er nur in Konflikte gestürzt.«
»Es ist immerhin mein Sohn. Würdest du das bitte nicht vergessen«, erwiderte er zornig.
»Für mich ist er jedoch in erster Linie der Sohn meiner armen Tochter. Andrea hast du mir ja entfremden können, aber bei Sascha wird es dir nicht gelingen.«
Das befürchtete er allerdings auch. Sie vergötterte den Jungen und verwöhnte ihn maßlos. Welches Kind war dafür nicht empfänglich!
»Deine Idee, Andrea in diese Dorfschule zu schicken, ist geradezu grotesk«, fuhr sie aufgebracht fort. »Das ist wohl auch dem Einfluss dieser Tänzerin zuzuschreiben. Die Wellentins hatten völlig recht, als sie diese Person ablehnten.«
»Ich verbiete dir, so über Frau von Wellentin zu sprechen!«, rief er.
»Nun, auf dich scheint sie ja auch schon großen Eindruck gemacht zu haben. Ich finde es schamlos, dass du auch Sybilles Kinder da hineinziehst, denn ich kann mir schon denken, worauf es hinauslaufen wird.«
»Worauf?«, fragte er scharf.
»Nun, darauf, dass du mit ihr ein Verhältnis beginnen wirst«, sagte sie verächtlich. »Sascha hat mir erzählt, wie oft ihr in Sophienlust wart. Und es ist dir sogar gelungen, ihn dafür zu begeistern. Ich bin einfach erschüttert, wie rasch du die Erinnerung an ihre wundervolle Mutter in den Kindern auslöschen willst.«
»Für dich hatte Sybille wohl keine Fehler«, war alles, was er antwortete.
Ihre Augen blickten ihn eisig an. »Ich habe mir schon gedacht, dass du mir nun so kommen würdest«, brauste sie auf. »Nein, Sybille hatte keine Fehler! Sie war untadelig. Ich hätte mir lediglich einen anderen Schwiegersohn gewünscht und ihr einen anderen Mann.«
»In der Art Hubert von Wellentins oder Joachim von Tressens? Vielleicht auch Baron Gerland?«
Sie wurde fahl und wich zurück. »Was nimmst du dir heraus?«, schrie sie ihn an. »Das ist infam!«
»Ich habe geschwiegen und immer wieder geschwiegen«, gab er hart zurück. »Aber jetzt geht es um meine Kinder. Ich könnte dir einen ganzen Stoß Briefe geben. Es wäre eine aufschlussreiche Lektüre, aber das möchte ich dir doch ersparen. Wenn es jedoch soweit kommt, dass du mich vor Sascha zum Narren machst, werde ich keine Rücksichten mehr nehmen. Und jetzt möchte ich meinen Sohn sehen, und zwar allein!«
»Er ist noch in der Schule«, erwiderte sie tonlos.
»Jetzt noch? Es ist bereits fünf Uhr.«
»Ich hielt es für richtiger, wenn er auch seine Aufgaben dort unter Aufsicht macht.«
»Also ist es kaum anders als im Internat. Er kommt nur zum Schlafen hierher. Ich werde ihn abholen.«
Sie gab nach. »Du hast mir doch nur gedroht, Alexander?«, fragte sie leise. »Du hast doch nicht tatsächlich die Absicht, diese Dinge …«
»Ich habe jetzt keine Zeit mehr«, erwiderte er kalt. »Ich denke, dass ich diesmal deutlich genug war, und ich kann es nur bedauern, dass ich nicht schon früher den Mut dazu hatte. Barbara hatte recht. Man kann dir nur so kommen.«
»Ach, Barbara steckt also dahinter«, zischte sie. »Sie hat einen Hass auf die Wellentins, und sie mochte Sybille nie.«
»Barbara hat eine sehr vernünftige Einstellung zum Leben. Außerdem hasst sie die Wellentins nicht, sie verachtet sie nur. Vor Denise von Wellentin hat sie größten Respekt.« Damit ging er.
Sascha traf er auf halbem Weg. Der Junge sah müde und blass aus. Seine Augen leuchteten auf, als er seinen Vater gewahrte.
»Papa«, rief er, »du besuchst mich? Ich hatte keine Zeit, dir zu schreiben. Ich bin abends immer so müde. Im Internat war es nicht so anstrengend.«
»Bist du krank, Sascha?«, fragte Alexander erschrocken, als er die heiße trockene Hand des Jungen umschloss.
»Nein, krank bin ich nicht. Mir ist nur manchmal so schlecht. Aber Großmama sagt, dass ich verweichlicht wäre. Das käme davon, weil ich in den Ferien so verwöhnt worden sei.«
»Wieso verwöhnt? Sie verwöhnt dich doch noch viel mehr.«
»Sie kauft mir alles, was ich haben will«, erwiderte er. »Ja, das stimmt. Aber ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Nicht mal Andrea.«
Er stöhnte auf und hielt sich die Seite. Erschrocken legte Alexander einen Arm um ihn. »Wir fahren sofort zum Arzt«, sagte er.
»Nein, dann regt sich Großmama nur auf. Sie will doch in den Sommerferien mit mir an die Riviera fahren.«
»Und das möchtest du auch gern?«
»Eigentlich nicht. Aber sie ist böse, wenn ich sage, dass ich lieber heimfahren will. Ich darf sie doch nicht betrüben. Sie hat jetzt nur noch mich, sagt sie immer. Und du hättest Andrea sowieso mehr lieb als mich.«
»Das ist doch nicht wahr, Sascha. Nein, du musst zum Arzt. Ich will wissen, was mit dir los ist.«
Er bekam eine schreckliche Diagnose. Sascha hatte eine Blinddarmentzündung und musste sofort in die Klinik.
»Wo ist Sascha? Wohin hast du ihn gebracht?«, fragte die Baronin Klees erregt, als Alexander viel später allein zurückkam.
»Er ist in der Klinik und wird gerade am Blinddarm operiert«, erwiderte er erschöpft. »Er hatte schon lange Schmerzen, aber du wolltest das wohl nicht wahrhaben. Wenn Sascha etwas zustößt …« Er brach ab. »Aber dann muss ich zuallererst mir Vorwürfe machen, weil ich mich nicht früher um ihn gekümmert habe«, schloss er niedergeschlagen. »Es wird sich in Zukunft manches ändern«, fügte er hart hinzu.
Ihren darauf folgenden hysterischen Ausbruch beachtete er nicht. Er fuhr in die Klinik zurück, und viele Stunden musste er um das Leben seines Sohnes bangen.
*
Ein frohes Leuchten ging über Denises Gesicht, als Barbara Baumgarten zu ihr kam. Aber es erlosch, sobald sie in das erregte, tieftraurige Gesicht der jungen Frau blickte.
»Ich dachte, ich könnte unter froheren Umständen meinen angekündigten Besuch abstatten, Denise«, sagte sie leise, »es ist etwas Schreckliches passiert.«
»Mit Alexander?« Denises Gesicht verlor alle Farbe.
»Mit Sascha. Er musste am Blinddarm operiert werden und schwebt in Lebensgefahr. Eine wahrhaft fürsorgliche Großmutter hat er, das kann man wohl sagen. Wäre Alexander nicht gekommen, wäre der Junge jetzt vielleicht schon tot.«
»Mein Gott«, sagte Denise erschüttert, »das ist ja entsetzlich!«
»Das kann man wohl sagen. Können wir hier ungestört sprechen, Denise?«
Denise nickte und führte ihren Gast in ihr Zimmer.
»Denise, ich muss mit Ihnen sprechen«, begann Barbara. »Vielleicht ist es ein Vertrauensbruch, aber Alexander braucht es ja nicht zu erfahren. Er steht mir sehr nahe. Wir haben uns immer gut verstanden, und ihm habe ich es auch zu verdanken, dass ich den Mann, den ich liebe, heiraten konnte. Jetzt sorge ich mich um ihn. Er ist sehr verzweifelt.«
»Ich sorge mich auch um ihn und um Sascha«, bestätigte Denise. »Aber wie kann ich ihm helfen?«
»Sie sind überhaupt der einzige Mensch, der ihm helfen kann, Denise. Sie haben ihm den Glauben an die Frauen zurückgegeben.«
Denise sah sie bestürzt an. »Wie soll ich das verstehen? Er liebte seine Frau doch sehr.«
»Ja, er liebte sie, als er einundzwanzig und ein grüner Junge war«, erklärte Barbara resolut. »Sagen Sie nur nicht, dass Ihnen nicht schon manches zu Ohren gekommen wäre.«
»Ich wollte diesem Klatsch keinen Glauben schenken.«
»Fest steht, dass sie ihn nach Strich und Faden betrogen hat. Sogar mit Ihrem ehrenwerten Herrn Schwiegervater. Ich muss mir das alles einmal vom Herzen reden. Mein Mann sagt zwar, ich solle die Vergangenheit ruhen lassen, aber das führt zu nichts. Was Sie auch hören, Denise, so schlimm wie die ganze Wahrheit kann es gar nicht sein. Sybille war schlau, und ihre Mutter stand hinter ihr. Sie konnte bezaubernd sein, und was auch immer war, man hätte ihr alles verziehen. Schuld an allem war Alexander in den Augen derer, die ihr wahres Gesicht nicht kannten. Ich kannte es. Und wie ich es kannte!«
»Ich möchte alles wissen, um ihm helfen zu können«, bat Denise.
Barbara nickte. »Ja. Sie können ihm helfen. Ich habe Sie gern gehabt vom ersten Augenblick an, obgleich der Name Wellentin bei mir sonst alles andere auslöst. Sophie hat alles in Ordnung bringen wollen. Aber sie stand auch schon mit einem Fuß im Grabe, als ihr die Erleuchtung kam.
Dietmar –, ich hoffe, Sie damit nicht allzusehr zu treffen, war ein hübscher, netter Junge, aber ein richtiger Wellentin. Entbehrungen hätte er auch für Sie nicht auf sich genommen. Jedenfalls war es anständig, dass er Sie geheiratet hat, und deswegen verzeihe ich ihm auch manches. Es klingt alles sehr hart, was ich Ihnen zu sagen habe, Denise. Verbieten Sie mir weiterzusprechen, wenn es Sie zu sehr trifft!«
»Sprechen Sie nur, Barbara«, flüsterte Denise. »Ich kann es ertragen. Vieles habe ich mir ja selbst schon klargemacht.«
»Hubert von Wellentin hatte eines Tages eine phantastische Idee. Er wollte mich mit seinem Sohn verheiraten, damit der enge Verkehr zwischen unseren Familien problemlos würde. Alexander und ich waren wie Geschwister aufgewachsen. Hubert von Wellentin unterhielt mit Sybille ein andauerndes Verhältnis. Seine Frau ist ein armes Schäfchen. Sie hielt ihn natürlich immer für einen Ehrenmann. Ich kam ganz zufällig dahinter, was die beiden trieben. Damals war ich neunzehn und sehr neugierig, müssen Sie wissen, und ich liebte meinen Mann bereits. Um keinen Preis der Welt wollte ich Dietmar heiraten. Als ich merkte, worum es Hubert von Wellentin eigentlich ging, habe ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Leider ließ ich mich auch dazu hinreißen, Alexander die Wahrheit zu sagen. Nein, nicht leider, jetzt sage ich Gott sei Dank.«
»Aber Hubert von Wellentin war doch soviel älter als Sybille«, wandte Denise ein.
»Zwölf Jahre, was bedeutet das schon. Sie war vier Jahre älter als Alexander. Natürlich wurde darüber nicht gesprochen. Jedenfalls wäre sie jetzt achtunddreißig. Er hat früh geheiratet, der Herr von Wellentin, und er hatte seine Frau reichlich über. Ich muss mich wieder entschuldigen, aber …«
»Ich verstehe Sie schon richtig, Barbara«, unterbrach sie Denise. »Ich weiß, dass es Ihnen um Alexander geht. Ich mag ihn sehr, doch das vermuten Sie wahrscheinlich schon länger, wie ich Sie einschätze.«
»Und er mag Sie sehr, wenn wir es so ausdrücken wollen. Ich kann nicht weg, Denise. Ich habe die beiden kleinen Kinder und erwarte ein drittes. Eigentlich hatte ich zu Ihnen kommen wollen, um Sie zu fragen, ob Sie die beiden bei sich aufnehmen können, wenn es soweit ist, und nun komme ich mit solchen Sorgen.«
»Sie sind augenblicklich wichtiger«, meinte Denise beruhigend. »Natürlich können Sie mir Ihre Kleinen jederzeit bringen, das ist doch selbstverständlich. Nur … ich kann doch nicht einfach zu ihm fahren?«
»Können Sie es wirklich nicht?«
»Was soll er von mir denken?«
»Dass er sich wenigstens in einer Frau nicht getäuscht hat.«
»Ich werde fahren«, erklärte Denise nach kurzem Zögern.
Barbara umarmte sie. »Ich danke Ihnen! Ich wusste doch, dass Sie auch mich nicht enttäuschen würden.«
*
Claudia kam ihrer Freundin im Hausflur entgegen. »Endlich mal eine gute Nachricht von Frau Trenk«, sagte sie. »Was wird Robby sich freuen! Sie hat die Operation gut überstanden. Nun glaubt auch sie an ihre Genesung. Drei Wochen muss sie noch in der Klinik bleiben, und dann wird sie ihren Robby abholen. Sie hat natürlich große Sehnsucht nach dem Jungen.«
Sie blickte Denise verblüfft an, weil die gar nichts sagte. »Du freust dich ja gar nicht«, meinte sie vorwurfsvoll.
»Eine gute Nachricht, dafür habe ich eine um so schlechtere. Sascha musste am Blinddarm operiert werden und schwebt in Lebensgefahr.«
»Mein Gott«, stöhnte Claudia. »Es ist doch wie verhext. Deswegen ist Frau Baumgarten also gekommen.«
Denise erzählte, was sie erfahren hatte. »Ich werde zu Alexander fahren«, schloss sie.
Mehr brauchte sie Claudia eigentlich gar nicht zu sagen, denn die Freundin ahnte schon lange, dass Alexander von Schoenecker Denise viel mehr bedeutete, als sie zugeben wollte. Deshalb fuhr Denise jetzt auch rasch fort.
»Was sagtest du von Frau Trenk? In drei Wochen kann sie aus dem Krankenhaus entlassen werden? Wie schön für Robby! Wir werden sie herholen und aufpäppeln.«
»Du entwickelst dich zur Samariterin, Denise. Vergiss dich selbst nicht darüber«, warnte Claudia.
»Eigentlich denke ich viel zu viel an mich selbst«, entgegnete die andere. »Nick wird nicht verstehen, dass ich schon wieder wegfahre.«
Nick zeigte sich einsichtiger, als sie angenommen hatte. Es erschreckte ihn sehr, dass Sascha schwer krank sein sollte. Gerade Sascha, der doch immer so mit seiner Kraft geprotzt hatte.
»Onkel Alexander wird sehr traurig sein«, meinte er. »Er soll doch Sascha mitbringen, wenn er wieder gesund ist. Wir werden dann schon auf ihn aufpassen. Aber vielleicht ist Sascha auch deswegen krank geworden, weil er jetzt nicht mal mehr Andrea hat.«
Nach einer Weile fiel ihm noch etwas ein: »Ich gebe dir was für Sascha mit, damit er weiß, dass wir ihn gern haben, auch wenn er manchmal nicht so nett war«, meinte er großmütig und schleppte einen kleinen Elefanten an. Es war besonders rührend, denn von seinen Spielsachen trennte er sich gar nicht gern.
Nun war Denise wieder einmal unterwegs, und auf dieser Fahrt war sie viel niedergeschlagener als damals, als sie nach Innsbruck fuhr.
Es darf dem Menschen nicht zu wohl werden, dachte sie bitter. Das Schicksal sorgt schon dafür, dass man immer hübsch mit den Füßen auf der Erde bleibt.
Der Baronin Klees zu begegnen, war keine schöne Aussicht. Zu unangenehme Erfahrungen hatte sie mit diesen überheblichen hochmütigen Adligen gemacht. Sie erinnerte sich, was Barbara ihr von Hubert von Wellentin und Sybille erzählt hatte. Was mochte Alexander danach durchgemacht haben, wie musste ihm zumute gewesen sein. Es war begreiflich, dass er menschenscheu und verschlossen geworden war, und umso dankbarer musste sie sein, dass er ihr sein Vertrauen geschenkt hatte.
Sie sah einen Wegweiser. »Nach Geißenberg«, stand da, und plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie hatte sich bei Madame Merlinde doch nach jener Roli, Carola Dahm, erkundigt, von der die Kinder erzählt hatten, dass sie in ein Waisenhaus gekommen wäre. Madame Merlinde hatte sie zwar lange auf eine Antwort warten lassen, aber dann hatte sie ihr doch kurz mitgeteilt, dass Roli im Waisenhaus Geißenberg untergebracht worden sei.
Doch jetzt musste sie zuerst zu Alexander. Er war ihr wichtiger, als ein fremdes Kind, von dem sie gar nichts wusste.
Nach längerer Fahrt hatte sie das Krankenhaus erreicht. Es war ein moderner Bau, und er wirkte in seinem sachlichen, sterilen Aussehen auf sie so ernüchternd, dass Denise zunächst gar nichts mehr empfinden konnte, als den Gedanken: Hinter einem dieser Fenster ringt Sascha um sein Leben, und sein Vater sitzt an seinem Bett und wird sich mit Selbstvorwürfen überhäufen.
*
Bevor Denise sich nach Saschas Zimmer erkundigen konnte, fiel ihr eine andere Besucherin auf.
»Nein, ich bedaure, Frau Baronin, aber ich kann Ihnen keinen Besuch bei Ihrem Enkel gestatten«, sagte jemand zu der Dame.
»Wenn mein Schwiegersohn zu ihm darf, habe ich wohl das gleiche Recht. Ich werde mich über Sie beim Chefarzt beschweren, Herr Doktor«, entgegnete die Dame scharf.
»Bitte, das steht Ihnen frei«, kam die gleichmütige Erwiderung. »Ich befolge nur die Anordnung des Herrn Chefarztes.«
Denise ahnte bereits, wer das war, und da kam auch schon die Baronin Klees. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit ihrer Tochter Sybille.
Sehr gepflegt und sehr unnahbar ging die Baronin an ihr vorbei, ohne ihr auch nur einen flüchtigen Blick zuzuwerfen, und darüber war Denise doppelt froh.
Der junge Arzt unterhielt sich jetzt mit einer Schwester. Denise räusperte sich, und er drehte sich um.
»Darf ich um eine Auskunft bitten?«, fragte sie höflich. »Mein Name ist Denise von Wellentin. Ich möchte mich nach Sascha von Schoeneckers Befinden erkundigen.«
Sie hatte nicht bemerkt, dass es in seinen Augen aufleuchtete, als er ihren Namen hörte: »Frau von Wellentin? Claudias Freundin?«, fragte er erstaunt.
»Sie kennen Claudia?«, fragte sie verblüfft.
»Doktor Wolfram«, stellte er sich vor. »Ich war bis vor kurzem in der gleichen Klinik, an der auch Claudia tätig war. Welch ein Zusammentreffen.«
»Die Welt ist ein Dorf«, dachte Denise belustigt, »aber mir wird das sicher jetzt sehr nützlich sein.« Claudia hatte ihr von Dr. Wolfram erzählt.
»Mir ist bekannt, dass Gut Schoeneich dem Gut Sophienlust benachbart ist«, erklärte er schnell. »Ich habe einige Male Gelegenheit gehabt, ein paar private Worte mit Herrn von Schoenecker zu wechseln. Aber vielleicht geben Sie mir später auch Gelegenheit, mich ein wenig mit Ihnen zu unterhalten, gnädige Frau. Jetzt werde ich Sie erst einmal zu Sascha führen. Eben musste ich seine Großmutter wegschicken, aber für Sie gilt das Besuchsverbot ja nicht.«
»Warum gilt es für die Baronin Klees?«, fragte sie befremdet.
»Auf Wunsch von Saschas Vater. Nun, ich kann ihn verstehen. Der Junge ist gerade noch mit dem Leben davongekommen. Wenn Herr von Schoenecker nicht gewesen wäre …«
»Ich weiß«, unterbrach Denise ihn. »Ich erfuhr es von Frau Baumgarten, Herrn von Schoeneckers Cousine, und deswegen bin ich ja auch gekommen.«
*
Alexander von Schoenecker war nicht von Saschas Bett gewichen, seit der Junge aus dem Operationssaal zurück war. Er sah selbst mittlerweile erbärmlich aus. Denise erschrak, als sie ihn sah.
Er hob den Kopf, als die Tür aufging. Ungläubiges Staunen war in seinem Blick, als sie eintrat.
»Denise«, flüsterte er. »Das kann es doch gar nicht geben.«
Sascha warf unruhig den Kopf hin und her. Dr. Wolfram zog sich diskret zurück, als Alexander von Schoenecker sich erhob und Denise entgegenging.
Beide Hände streckte sie ihm entgegen und als er sie ergriff und sie selbst näher an sich zog, ließ sie unwillkürlich ihren Kopf an seine Schulter sinken.
»Barbara benachrichtigte mich«, sagte sie leise. »Ich musste einfach kommen. Ich konnte Sie doch mit all Ihrem Kummer nicht allein lassen.«
Sie spürte sein Kinn an ihrer Schläfe, ein raues, unrasiertes Kinn, und dennoch war diese Berührung weich und behutsamn.
»Denise!« Seine Stimme war heiser vor Zärtlichkeit und Sehnsucht. Seine Lippen streiften ihre Schläfe. Sie spürte beglückt, wie nötig er sie brauchte, aber sie wusste auch, wie nötig sie ihn brauchte.
Ein Stöhnen riss beide aus ihrer Versunkenheit. »Papa«, wisperte eine Stimme, und noch einmal: »Papa!«
Rasch löste sich Denise aus den Armen des Mannes und wich zur Tür zurück. Alexander beugte sich über seinen Sohn. »Ich bin da, Sascha«, sagte er weich.
Die heißen Finger griffen nach seiner Hand und hielten sie fest. »Bleib bei mir, Papa! Ich will nicht zu Großmama, ich will nicht!«
»Es ist ja alles gut, Sascha«, beruhigte ihn Alexander. »Ich bleibe bei dir und nehme dich mit, wenn du gesund bist. Werde bald gesund, mein Junge!«
Es war, als verklärte ein Lächeln das Gesicht des Jungen. Dann sank Sascha wieder in die Bewusstlosigkeit zurück, die allen Kummer aus seinem kleinen Herzen auslöschte.
Denise verfolgte erschüttert die Szene. Heißes Mitgefühl mit dem Kind und Sehnsucht nach dem Mann erfüllten sie.
Minuten verharrte sie so. Dann kam Alexander zu ihr und stützte seine Hände seitlich von ihren Schultern an die Wand.
Seine müden Augen suchten ihren Blick. »Kannst du bleiben, Denise?«, fragte er flüsternd. »Wenigstens einen Tag?«
Das Du versetzte sie in eine atemlose Spannung. Sie hob eine Hand und strich leicht über sein Gesicht. »Ja, Alexander«, erwiderte sie.
»Ich wohne im Hotel ›Drei Kronen‹«, murmelte er. »Man wird dir sicher ein Zimmer geben.«
»Du musst schlafen«, hörte sie sich sagen. »Ich werde bei Sascha bleiben und später kommen.«
»Wie soll ich dir danken?«, flüsterte er.
Ihre Hände umschlossen warm sein Gesicht. »Nicht danken, Alexander. Vertrau mir«, bat sie. »Und jetzt legst du dich erst mal hin. Bitte!«
Lange konnte er sich ohnehin nicht mehr auf den Füßen halten.
Aber nachdem Alexander das Zimmer verlassen hatte, überlegte sie erst, wie Sascha es aufnehmen würde, wenn sie bei ihm war und nicht sein Vater.
Unwillkürlich faltete sie die Hände. »Gott im Himmel«, flehte sie, »hilf mir! Ich werde es dir danken, indem ich vielen anderen Kindern Liebe geben werde, wenn ich das Herz dieses Jungen erobern kann.«
Und dann saß sie lange, den Kopf auf die gefalteten Hände gestützt, unbeweglich da und beobachtete das totenblasse Gesicht des Jungen.
Wie lange sie so saß, hätte sie später nicht mehr zu sagen gewusst. Es war Abend geworden. Die Nachtschwester kam, auch Dr. Wolfram hatte hereingeschaut und war ein paar Minuten im Krankenzimmer geblieben.
Aber sie war unfähig, auch nur ein Wort mit ihm zu sprechen. Er selbst war zu taktvoll, um ihr Fragen zu stellen.
Dann war sie wieder allein mit dem Kranken. Plötzlich bewegten sich seine Lider, und er sah sie an. Sein Blick schien aus einer anderen Welt zu kommen, aber seine Stimme klang klar und deutlich, als er sagte: »In Sophienlust war es schön. Ich möchte gern wieder dorthin. Wie geht es Nick und den Ponys? Ich mag Hunde doch ganz gern. Papa, darf ich wieder nach Sophienlust? Mir ist so, als wäre Tante Isi eben dagewesen.«
Sie legte ihre Lippen auf seine Stirn. »Ich bin da, Sascha. Nick hat mir etwas für dich mitgegeben. Du sollst bald gesund werden, wünscht er dir.« Sie legte den kleinen Plüschelefanten zwischen seine Hände. »Damit du nicht allein bist«, setzte sie mit erstickter Stimme hinzu. »Werde bald gesund, mein Kleiner!«
Seine Finger schlossen sich um das Tier. »Wo ist Papa?«, fragte er.
»Er schläft jetzt, Sascha. Er hat sehr lange bei dir gewacht.«
»Ich schlafe jetzt auch«, murmelte er. »Und du auch. Kommst du morgen wieder, wenn ich munter bin?«
Sie konnte es nicht verhindern, dass Tränen über ihre Wangen liefen. »Schlaf dich gesund, Sascha«, wünschte sie gerührt.
Er nickte, schon wieder halb abwesend. »Es ist schön in Sophienlust«, wiederholte er noch einmal. »Andrea kommt auch!« Und dann verkündeten tiefe, regelmäßige Atemzüge, dass er eingeschlafen war.
»Sie müssen jetzt gehen, es ist zehn Uhr, gnädige Frau«, sagte die Nachtschwester, die leise eingetreten war.
»Der Arzt soll noch einmal nach ihm sehen«, bat Denise.
Dr. Wolfram kam und beruhigte sie. »Das Fieber ist gesunken. Es geht ihm bedeutend besser, gnädige Frau.« Er begleitete sie zur Tür. »Seien Sie unbesorgt.
Der Nachtportier blickte bei ihrem Eintritt auf. »Frau von Wellentin?«, fragte er, bevor sie noch etwas sagen konnte. »Herr von Schoenecker hat ein Zimmer für Sie reservieren lassen. Er bat darum, verständigt zu werden, wenn Sie kommen.«
»Welches Zimmer hat er?«, fragte sie. »Ich denke, man sollte ihn besser nicht wecken.«
Aber sein Zimmer lag gleich neben dem ihren. Die Verbindungstür war zwar abgeschlossen, aber der Schlüssel steckte auf ihrer Seite. Zögernd griff sie danach, aber dann hielt sie inne. Sie ging ins Bad, ließ kaltes Wasser über ihr Gesicht laufen und bürstete sich geistesabwesend die Haare.
Minutenlang verharrte sie regungslos vor dem Spiegel, dann aber öffnete sie doch die Tür.
Mit ausgebreiteten Armen lag er auf dem Bett. So wie er hineingefallen war, musste er eingeschlafen sein. Ganz behutsam beugte sie sich zu ihm hinab und streifte mit ihren Lippen seine Wangen.
Dann ging sie lautlos in ihr Zimmer zurück und ließ die Tür einen Spaltbreit offen. Sie konnte seine Atemzüge vernehmen. Hin und wieder kam ein leises Stöhnen über seine Lippen.
Alexander« dachte sie, geliebter Alexander, dann schlief auch sie
ein.
*
Als Alexander erwachte, erfüllte sanfte Dämmerung das Zimmer. Erschrocken blickte er auf die Uhr. Ist Denise noch immer nicht zurück, war sein erster Gedanke.
Leise stand er auf und ging durch das Zimmer. Sofort sah er, dass die Verbindungstür einen Spalt offenstand.
Sein Herz begann heftig zu klopfen. Sie war also noch bei ihm gewesen, und er hatte nichts davon gemerkt. Wie müde und erschöpft musste er gewesen sein, wenn er nicht einmal ihre Nähe gespürt hatte.
Er sah die Umrisse ihres Kopfes auf dem weißen Kissen. Das schwarze Haar umfloß weich ihr Gesicht, dessen schöne Züge völlig entspannt waren.
Er wagte nicht, sich zu rühren, um sie nicht aufzuwecken, aber sie erwachte von selbst.
»Alexander!«
Mit ein paar Schritten war er bei ihr und kniete neben ihrem Bett nieder. Seine Hand legte sich an ihre Wange. Er spürte ihre zarte Haut, und eine ungestüme Sehnsucht ergriff Besitz von ihm.
»Denise, liebe, liebste Denise«, flüsterte er zärtlich.
»Es geht Sascha besser«, erklärte sie. »Er schlief ganz ruhig, als ich ihn verließ. Er wird gesund werden, Alexander. Doktor Wolfram hat es mir versprochen.«
»Wer ist Doktor Wolfram? Du sprichst seinen Namen aus, als würdest du ihn kennen?«
»Er war früher an der gleichen Klinik wie Claudia«, erläuterte sie rasch.
»Ich beneide alle Männer, die dich früher kannten als ich«, gestand er.
»Ich kannte ihn doch gar nicht«, widersprach sie lächelnd. »Es gibt keinen Mann, der in all den Jahren eine Rolle in meinem Leben gespielt hätte, Alexander. Nur dich!«
Sie hatte es eigentlich gar nicht sagen wollen.
Aufstöhnend presste er seine Lippen auf ihren Mund. »Ich liebe dich, Denise«, flüsterte er. »Es ist Wahnsinn, denn was kann ich dir schon bieten? Ich bürde dir doch nur neue Lasten auf.«
»Sprich nicht so, Alexander«, wehrte sie weich ab. »Es tut so gut zu wissen, dass du da bist.«
Seine harten Lippen wurden weich, behutsam und zärtlich. Wir dürfen nicht an uns denken, ging es ihr durch den Kopf, wir dürfen es nie.
Aber seine Nähe betäubte all diese Gedanken. Die Sehnsucht, die sie einander in die Arme trieb, war stärker als jede Vernunft.
Was immer auch geschehen würde, und wie sich ihr künftiges Leben gestaltete, diese Liebe würde bleiben, unverändert, unerschütterlich.
*
»Ich will sofort zu meinem Enkel«, verlangte die Baronin Klees gereizt. »Die Schwester sagte mir, dass er gestern Besuch von Frau von Wellentin hatte. Ich finde es unglaublich, dass man eine Fremde eher zu ihm lässt als mich.«
Diese schwatzhaften Schwestern, dachte Dr. Wolfram verärgert. Können sie denn nicht den Mund halten. Er befand sich nun in einer prekären Lage. Herr von Schoenecker war noch nicht gekommen, was ihn wunderte, und unter diesen Aspekten konnte er die Baronin nicht wieder abweisen. Außerdem ging es Sascha ja jetzt auch besser.
»Unser kleiner Patient darf aber keinesfalls aufgeregt werden, Frau Baronin«, warnte er eindringlich. »Muntern Sie ihn auf, wenn Sie zu ihm gehen. Ich fürchte, Sie sind selbst sehr erregt.«
»Natürlich erregt es mich, wenn man einer fremden Person gestattet, was man mir verbietet«, empörte sie sich aufs neue. »Ich liebe meinen Enkel über alles. Sie werden doch wohl nicht annehmen, dass mein Besuch ihm schaden könnte.«
»Es geht ihm heute besser«, wich er aus. »Frau von Wellentins Besuch hat beruhigend auf ihn gewirkt.«
Sie maß ihn mit einem eiskalten Blick. »Sie scheint es ja meisterhaft zu verstehen, alle Männer für sich einzunehmen. In meinem Alter ist man leider nicht mehr so begehrenswert und kokett.«
»Sie ist nicht kokett«, widersprach er ruhig. »Sie ist vielmehr eine wunderbare Frau, die so viel Gutes tut, dass es sehr ungerecht ist, wenn man sie auf so eine Weise angreift.«
Sie rauschte wortlos an ihm vorbei zum Lift, ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen.
Sascha war munter, als sie eintrat. Er war enttäuscht, als er sie erkannte, denn er hatte seinen Vater erwartet und Denise.
»Mein lieber, guter Sascha«, rief sie pathetisch. »Endlich lässt man mich zu dir. Stell dir vor, sie haben deine Großmama daran hindern wollen, dich zu besuchen.«
»Ich war ja gar nicht da«, erwiderte er leise. »Ich hätte gar nicht mit dir sprechen können.«
»Aber mit deinem Vater hast du auch sprechen können und auch mit Frau von Wellentin«, meinte sie.
»Erst gestern Abend. Es ist doch sehr lieb, dass sie extra meinetwegen hierhergekommen ist.«
»Wohl weniger deinetwegen als wegen deines Vaters«, bemerkte sie anzüglich.
»Sie war aber sehr lange bei mir. Papa war sehr müde. Er musste schlafen, deswegen blieb sie hier«, widersprach er.
»Aber du willst das doch sicher gar nicht.«
»Doch, ich habe mich sehr gefreut«, versicherte er trotzig.
»Du bist böse mit mir«, begann sie zu jammern. »Ich wusste doch nicht, dass du so arge Schmerzen hast. Du hättest es mir sagen müssen.«
»Ich habe es dir ja gesagt. Du hast gemeint, ich würde zu viel Eis essen«, stieß er hervor. »Ich mag auch nicht mehr in diese Schule gehen. Lieber will ich wieder in ein Internat, da kann man wenigstens manchmal spielen.«
»Sie hetzen dich gegen deine Großmama auf. Ich habe es gleich befürchtet«, meinte sie böse.
»Niemand hetzt mich auf«, widersprach er erregt. »Niemand sagt etwas gegen dich. Dabei tust du das immer, wenn es um Papa geht. Er hat mich nämlich lieb. Es stimmt gar nicht, dass er mich nicht mag.«
»Nein, das stimmt wirklich nicht«, erklang Alexanders Stimme von der Tür her. »Guten Morgen, Sascha. Fein, dass es dir bessergeht!«
»Kommt Tante Isi nicht?«, fragte Sascha enttäuscht.
Alexander mochte ihm nicht sagen, dass sie rasch umgekehrt war, als Dr. Wolfram ihnen gesagt hatte, dass die Baronin da sei.
»Sie wird dich später besuchen, bevor sie zurückfährt.«
»Sie soll aber noch nicht fahren«, verlangte Sascha. »Ich habe noch viel mit ihr zu besprechen. Auch wenn Großmama etwas dagegen hat.«
Die Baronin Klees konnte nur mit Mühe Haltung bewahren. »Nun bin ich wohl überflüssig«, stieß sie zornig hervor. Dann fiel ihr Blick auf den kleinen Elefanten, den Sascha in den Händen hatte.
»Seit wann spielst du mit so kindischen Tieren?«, fragte sie scharf.
»Nick hat ihn mir geschickt. Ich finde es lieb.« Saschas Unterlippe schob sich trotzig vor. »Ich soll mich nicht aufregen, hat der Arzt gesagt, aber nun rege ich mich auf«, setzte er schlau hinzu.
Die Baronin warf Alexander einen hasserfüllten Blick zu. »Du verstehst es meisterhaft, den Jungen auf deine Seite zu bringen.«
»Bitte hier keine Auseinandersetzungen«, unterbrach Alexander scharf. »Wir werden noch genug Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.«
»Darum möchte ich auch dringendst gebeten haben.«
Damit ging sie, und Sascha atmete erleichtert auf. »Ich verstehe sie jetzt gar nicht mehr, Papa«, sagte er leise. »Warum ist sie so?«
»Wir wollen jetzt lieber von dir sprechen, mein Junge«, lenkte Alexander ab. »Sie hat sich sehr aufgeregt wegen deiner Krankheit, und sie macht sich sicher Vorwürfe.«
»Die kann sie sich auch ruhig machen«, stellte der Junge fest. »Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wie lange bin ich jetzt schon hier?«
»Vier Tage.«
»Vier Tage«, staunte Sascha, »und ich habe es gar nicht gemerkt.«
»Hast du starke Schmerzen?«
»Jetzt nicht mehr. Es zieht bloß noch, und Hunger habe ich. Der gräßliche Tee kommt mir schon hoch. Ich will was Richtiges essen.«
»Du wirst schon etwas bekommen. Erst Suppen, damit du dich wieder ans Essen gewöhnst.«
»Ich mag aber keine Suppen. Ich möchte so guten Kuchen, wie wir ihn in Sophienlust bekommen haben.«
»Wir müssen erst mal noch tun, was der Arzt sagt«, redete Alexander ihm gut zu. »Du bist doch ein vernünftiger Junge, Sascha.«
»Es ist gar nicht so einfach, vernünftig zu sein, Papa«, seufzte er. »So groß bin ich doch noch gar nicht.«
Zärtlich strich ihm Alexander über das Haar. »Ja, es ist manchmal sehr schwer, vernünftig zu sein«, räumte er ein. »Auch für Erwachsene.«
Sascha sah ihn gedankenvoll an. »Jetzt sind bald Ferien. Ich darf doch nach Hause?«
»Freilich darfst du nach Hause.«
»Auch wenn Großmama dagegen ist?«
»Es kommt nur auf dich an.«
»Sie kann die Uhr und das Fahrrad behalten«, meinte er. »Ich will es gar nicht haben. Ich möchte viel lieber mit Andrea zusammensein, und mit dir«, fügte er nach einer kleinen Pause hinzu.
Tiefe Dankbarkeit erfüllte Alexander. So schlimm alles auch gewesen war, es hatte sie einander viel schneller nähergebracht, als dies unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. Er fürchtete sich jetzt auch nicht mehr vor der Auseinandersetzung mit seiner Schwiegermutter.
*
Denise hatte die Klinik eilig wieder verlassen. Gut, dass Dr. Wolfram so wachsam gewesen war und sie sofort von dem Besuch der Baronin unterrichtet hatte. Was hätte es sonst an Aufregungen für Sascha geben können, wenn sie in seinem Krankenzimmer zusammengetroffen wären.
Sie suchte ein kleines Café auf, dann kam ihr der Gedanke, daheim anzurufen, und sie ging zum nächsten Postamt.
Als sie aus der Telefonzelle trat, blickte sie in die eisigen Augen der Baronin Klees.
»Frau von Wellentin?«, sagte sie herablassend. »Sie bestehen wohl auf dieser Anrede?«
»Sie können auch gerne eine andere wählen«, erwiderte sie gleichmütig. »Baronin Klees, wenn ich mich nicht täusche.«
»Es kommt mir wie gerufen, dass ich Sie treffe«, fuhr die Baronin fort. »Ich finde, Sie mischen sich etwas zu sehr in meine Privatangelegenheiten ein.«
»In die Ihren ganz gewiss nicht«, versicherte Denise gelassen. »Was wünschen Sie?«
»Dass Sie meinen Enkel und auch meinen Schwiegersohn in Ruhe lassen. Ist es nicht genug, dass Sie Gut Sophienlust bekommen haben? Muss es auch noch Schoeneich sein?«
Kalter Zorn erfüllte Denise, aber sie zeigte es nicht. »Sie verkennen die Tatsachen, Frau Baronin«, erwiderte sie freundlich. »Ich habe Kinder gern und schätze Herrn von Schoenecker als einen aufrichtigen Freund. Ihre Vorwürfe sind unbegründet, und ich brauche sie mir nicht bieten zu lassen. Das möchte ich nachdrücklich betonen.«
»Und ich möchte Ihnen mit allem Nachdruck sagen, dass ich nichts unversucht lassen werde, meine Enkelkinder Ihrem Einfluss zu entziehen. Der Gedanke ist für mich unerträglich, dass eine Tänzerin sich in die Erziehung dieser Kinder einmischt.«
»Jetzt ist es aber genug«, erklärte Denise aufgebracht. »Ich mische mich in nichts ein, aber Ihnen würde es vielleicht guttun, einmal nachzudenken, ob Sie das Recht haben, sich in einer Art und Weise, die kaum noch erträglich ist, zwischen Vater und Kinder zu stellen. Kinder sind nämlich sehr empfindsame Wesen, in deren Seelen man großen Schaden anrichten kann. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe keine Zeit.«
*
»Wann fangen die Sommerferien an, Claudia?«, erkundigte sich Dominik, nachdem er mit seiner Mutti telefoniert hatte.
»In drei Wochen.«
»Fein«, meinte er zufrieden. »Dann kommen Andrea und Sascha. Robbys Mutter kommt nun auch bald. Das Haus wird immer voller.«
Sein Blick schweifte über den Park. »Du, Claudia, da ist wieder die Frau, die vorgestern schon da war. Sie guckt immer herüber, als möchte sie sich Sophienlust genau anschauen.«
Auch Claudia erkannte die junge Frau wieder. Ja, sie war vorgestern zur selben Zeit schon in der Nähe gewesen, und es war ihr aufgefallen, wie sehnsüchtig sie herüberschaute.
»Vielleicht interessiert sie sich auch für die Ponys«, vermutete Nick. »Ich frage sie einfach mal.«
Die fremde junge Frau wollte schon weglaufen, als sie Dominik auf sich zukommen sah, aber er rief ihr zu:
»Wenn Sie hereinkommen wollen, dann kommen Sie doch«, meinte er wohlerzogen. »Ich bin Dominik von Wellentin. Hier darf jeder reinkommen. Wir schicken niemanden weg.«
Die junge Frau sah ihn mit einem Blick an, der Nick sehr nachdenklich stimmte. »Warum sind Sie traurig?«, fragte er. »Suchen Sie Arbeit? Wir können immer jemanden brauchen. Meine Mutti ist gerade verreist, aber Claudia ist da.«
»Woher weißt du, dass ich traurig bin?«, fragte sie befangen.
»Weil Sie so schauen. Man sieht es an den Augen. Robby guckt auch immer so, wenn er an seine Mutter denkt.«
Dominik betrachtete sie wieder forschend und beschloss aufs ganze zu gehen. »Wollen Sie vielleicht ein Kind herbringen? Das können Sie ruhig. Es kostet gar nichts, wenn Sie vielleicht Angst haben, dass es zu teuer ist.«
Edith Gerlach, denn sie war es, wurde ganz eigenartig zumute, als der kleine Junge so freundlich auf sie einsprach.
»Nein, ich will kein Kind hierherbringen, aber ich habe Kinder sehr gern«, erwiderte sie zögernd.
Claudia war inzwischen näher getreten. »Nick«, griff sie mahnend ein, »du darfst nicht aufdringlich sein. Die junge Dame wollte sicher gar nichts von uns oder doch?«, fragte sie dann die Fremde.
»Ja, ich interessiere mich für das Kinderheim«, kam die verlegene Antwort.
»Jetzt weiß ich, wo ich Sie schon einmal gesehen habe«, stellte Claudia zurückhaltend fest. »Mit Frau von Wellentin.«
Nick riss die Augen auf. »Mit der Frau von Wellentin, die meine Großmutter sein soll?«, fragte er neugierig.
»Bitte, geh zu den anderen, sie warten schon auf dich«, bat Claudia eindringlich.
»Entschuldigung«, sagte er höflich und entfernte sich sofort.
»Er kümmert sich um alles«, entschuldigte Claudia lächelnd seinen Eifer. »Ich hoffe, seine Fragen haben Sie nicht in Verlegenheit gebracht.«
»Er ist ein reizender Junge«, erwiderte Edith Gerlach leise. »Ich verstehe nicht, dass man ein solches Kind ablehnen kann.«
»Das steht auf einem anderen Blatt«, meinte Claudia. »Sie sind sehr mutig, Frau …?«
»Gerlach«, entgegnete Edith.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Gerlach«, sagte Claudia herzlich. »Allerdings möchte ich annehmen, dass die Wellentins nicht davon erbaut sein werden, wenn Sie hierherkommen. Oder sind Sie nicht mehr bei ihnen beschäftigt?«
»Doch. Frau von Wellentin ist jetzt nur manchmal nicht da, und da habe ich frei.«
Und dann kommt sie ausgerechnet hierher, dachte Claudia.
Leises Weinen klang an ihr Ohr. »Ich muss mich um unser Baby kümmern, entschuldigen Sie bitte«, sagte sie rasch. »Oder möchten Sie sich unser kleines Findelkind einmal anschauen?«
»Wenn ich darf«, erwiderte Edith Gerlach zögernd.
»Es ist ein süßes kleines Mädchen«, erzählte Claudia ungezwungen. »Wir fanden es vor ein paar Wochen vor unserer Tür. Petra heißt sie. Wir möchten uns jetzt nicht mehr von ihr trennen.«
Sie behielt Edith Gerlach dabei scharf im Auge und bemerkte, dass sie erblasste. »Eine Mutter, die ihr Kind aussetzt, muss in Ihren Augen wohl ein Scheusal sein«, sagte sie gequält.
»Nein, es kann auch ein armes, bedauernswertes Geschöpf sein. Ein Scheusal hätte das Kind umgebracht. So etwas geschieht ja leider viel zu oft.«
Sie eilte zu dem Kinderwagen, der auf der Terrasse stand. »Na, Senta, du bist ja auch schon wieder da«, sagte sie zu der Spanielhündin. »Hast du nicht genug mit deinen eigenen Jungen zu tun? Musst du auch noch auf unsere kleine Petra aufpassen? Nicht wahr, ein hübsches Baby?«, wandte sie sich wieder an die Fremde. »Es wird auch sehr geliebt von allen. Vielleicht wäre es gut, wenn die Mutter das wüsste.«
Edith konnte nichts sagen. Krampfhaft schluckte sie die aufsteigenden Tränen hinunter. Am liebsten hätte sie alles eingestanden, aber hier hatte es Petra viel besser, als wenn sie das Kind jetzt zu sich genommen hätte. Die paar hundert Euro, die sie gespart hatte, reichten höchstens für ein paar Wochen.
Claudia fühlte genau, was in ihr vorging. Sie brauchte kaum noch eine Bestätigung für ihren Verdacht. Es passte auch alles zeitlich richtig zusammen. Das Kind vor der Tür und Edith Gerlachs Anstellung bei Frau von Wellentin. Aber von sich aus konnte und wollte sie nichts sagen. Das war ein junger, verzweifelter Mensch. Sie spürte es. Aber diese Frau hatte ihr Kind nicht aus unedlen Motiven ausgesetzt, sondern in höchster Not. Aber wie konnte man ihr helfen? Wie konnte man ihr eine Brücke bauen?
»Fühlen Sie sich denn wohl in Ihrer Stellung?«, fragte sie vorsichtig, während sie Petra das Fläschchen gab.
»Ich muss zufrieden sein«, gab Edith zurück. »Ich habe nichts gelernt. Da kann ich keine andere Tätigkeit annehmen!«
»Nun, wenn Sie Freude an Kindern haben und einmal wechseln wollen, melden Sie sich bei uns«, sagte Claudia kurz entschlossen. Sie wusste zwar nicht, wie Denise sich dazu stellen würde, aber sie wollte es schon verantworten.
»Sie sind sehr freundlich«, flüsterte Edith. »Dabei kennen Sie mich doch gar nicht.«
»Oh, man bekommt schon eine gewisse Menschenkenntnis in meinem Beruf«, erwiderte Claudia diplomatisch. »Wollen Sie Petra einmal halten? Ich hole schnell frische Windeln.«
Sie legte ihr das kleine Wesen in den Arm. An der Tür drehte sie sich noch einmal um, und da sah sie, wie Edith ihre Lippen in unendlicher Zärtlichkeit auf das Köpfchen des Kindes legte.
Nun kamen auch die anderen Kinder herbei. Allen voran Nick. Er baute sich neben Edith auf und fragte forsch: »Hat Claudia Ihnen erlaubt, dass Sie das Baby in den Arm nehmen?«
»Ja, sie hat es mir erlaubt«, erwiderte Edith beklommen.
»Na, dann ist es ja gut. Man muss nämlich sehr vorsichtig sein. Man muss das schon verstehen, damit man ihm nicht weh tut. Wir dürfen Petra nur anschauen.«
Er war beleidigt, weil diese Fremde mehr Rechte bekam. »Sie ist ja schon erwachsen«, mischte sich Susanne ein. »Schau, Petra schreit gar nicht. Sie fremdelt sonst nämlich leicht«, klärte sie Edith auf.
Gott im Himmel, du hast es gut gemeint mit meinem Kind, dachte Edith. Sie war glücklich und dankbar in dieser Stunde. Sie hatte ihr Kind sehen dürfen. Ein gesundes, pausbäckiges Baby, das alles bekam, was es brauchte.
Aber nun musste sie sich verabschieden, wollte sie zur rechten Zeit wieder bei Frau von Wellentin sei.
»Wenn Sie Zeit haben, können Sie gern wieder vorbeischauen«, meinte Claudia freundlich.
Edith nickte. »Vielen, vielen Dank! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
»Wir sind froh, wenn alle unsere Kinder gut gedeihen«, erwiderte Claudia. »Auf baldiges Wiedersehen, Frau Gerlach!«
Sie ahnte nicht, wie bald Edith Gerlach schon wieder nach Gut Schoeneich kommen sollte.
*
Irene von Wellentin zuckte erschrocken zusammen, als sie die barsche Stimme ihres Mannes hörte.
So früh war er schon lange nicht mehr heimgekommen. Und sofort erfuhr sie auch den Grund.
»Ich habe diese Person schon das zweite Mal in Sophienlust gesehen«, begann er unbeherrscht. »Was hast du dazu zu sagen?«
»Welche Person?«, fragte Irene von Wellentin erst einmal bestürzt.
»Deine eigenartige Gesellschafterin. Bestimmt hat diese Tänzerin sie als Spitzel hier eingeschleust, und sie erstattet ihr fleißig Bericht, was bei uns vor sich geht.«
»Was geht denn bei uns vor sich?«, fragte Irene spöttisch. »Ich glaube, du versteigst dich langsam in Wahnvorstellungen, was Denise von Wellentin anbetrifft, Hubert.«
»Nenn sie nicht mit unserem Namen«, schrie er wütend. »Ich will diese Person sprechen! Sofort!«
»Ich habe ihr heute frei gegeben.«
»So, damit sie nach Sophienlust fahren kann. Ich habe mich nicht getäuscht. Und jetzt meine ich fast, du steckst mit ihr unter einer Decke.«
»Du weißt nicht, was du redest. Es mag ja sein, dass sie dort spazierengegangen ist, aber sie hat nichts mit diesen Leuten zu tun. Du gönnst es mir nur nicht, dass ich einen Menschen habe, dem ich vertrauen kann.«
»Vertrauen, vertrauen, dass ich nicht lache. Sie hintergeht dich.«
»Nicht so, wie du mich hintergangen hast«, konterte sie zornig.
»Was willst du damit sagen? Was nimmst du dir für einen Ton heraus?« Sein Gesicht war dunkelrot angelaufen.
»Was habe ich denn schon gesagt? Die Wahrheit, nichts weiter. Meinst du, ich bin blind und taub? Ich weiß manches, was du gern, sehr gern vor mir verbergen wolltest, Hubert. Ich habe mich nur nie gewehrt, aber jetzt wehre ich mich gegen deine ungerechten Beschuldigungen.«
»Du bist aufgehetzt worden. Jetzt weiß ich genau, warum diese Person hier ist. Mit der ganz bestimmten Absicht, dich einzuwickeln. Und du fällst darauf herein. Erst will man dich einschüchtern, um dann auch mich herumzukriegen.«
»Du weißt wirklich nicht mehr, was du redest«, wiederholte sie in einer ihr selbst unbegreiflichen Ruhe. »Du musst ja ein sehr schlechtes Gewissen haben.«
Er hieb mit der Faust auf den Tisch, weil er nicht gleich eine Erwiderung wusste.
Da kam Edith Gerlach zurück, und als sie den Hausherrn gewahrte, blieb sie erschrocken stehen.
»Was treiben Sie sich auf Sophienlust herum?«, herrschte er sie an. »Ich will eine Erklärung!«
Edith presste die Lippen aufeinander. »Muss ich darüber Rechenschaft ablegen, wo ich meine Freizeit verbringe?«, fragte sie kühl. »Kann ich nicht spazierengehen, wo ich will?«
»Da siehst du, wie aufsässig sie ist, Irene«, sagte er. »Ich habe es dir ja gesagt. Diese Frau hat dafür gesorgt, dass Sie in unser Haus gekommen sind. Gehen Sie auf der Stelle! Ich will Sie nicht mehr hier sehen. Keine Minute!«
»Hubert«, griff Irene von Wellentin warnend ein. »Ich habe Frau Gerlach engagiert.«
»Und ich habe sie soeben entlassen. Wer ist hier der Herr im Haus?«
Edith war bereits auf dem Weg zu ihrem Zimmer. Als sie dort angelangt war, fiel unten krachend die Haustür ins Schloss.
Wenig später erschien Irene von Wellentin bei ihr. »Es hat wohl keinen Sinn, dass ich Sie bitte, zu bleiben?«, fragte sie niedergeschlagen.
»Nein, es ist besser, wenn ich gehe«, erwiderte Edith tapfer.
»Es tut mir leid, dass mein Mann Sie mit so ungerechten Vorwürfen überhäufte. Er ist leider manchmal so.«
Edith schwieg. Sie kann einem leid tun, trotz ihres Reichtums, dachte sie. Geld allein macht eben doch nicht glücklich. Ob sie mich in Sophienlust jetzt aufnehmen? Ob ich bei meiner kleinen Petra bleiben kann? Oh, ich wollte ja gern arbeiten, wenn ich es dürfte.
»Ich kenne die junge Frau von Wellentin gar nicht«, sagte sie stockend. »Es stimmt nicht, was Herr von Wellentin vorhin sagte.«
Irene ließ sich auf einem Stuhl nieder. »Sie waren mir eine große Stütze, Edith«, meinte sie traurig. »Es schmerzt mich, wenn Sie mich verlassen. Ja, ich gebe es zu, Sie waren der einzige Mensch, zu dem ich noch Vertrauen hatte, und Sie haben es nie enttäuscht.«
»Doch in einem habe ich Sie getäuscht«, gestand Edith kurz entschlossen. »Ich habe ein Kind.«
»Aber warum haben Sie mir das nicht anvertraut? Habe ich Ihnen nicht deutlich genug gezeigt, dass ich Sie gern habe?«, fragte Irene von Wellentin erschüttert. »Wo ist das Kind, Edith?«
Das junge Mädchen rang mit sich. Sollte sie die ganze Wahrheit eingestehen?
»Ich war in einer entsetzlichen Notlage«, erzählte sie dann. »Ich hatte kein Geld mehr. Da bot sich mir die Möglichkeit, die Stellung bei Ihnen anzunehmen. Aber ich wusste nicht, wohin mit dem Kind. Da legte ich es vor die Tür von Gut Sophienlust.«
»Das Findelkind dort war Ihr Kind?«, fragte Frau Irene bestürzt.
»Es ist mein Kind, und ich konnte mich heute davon überzeugen, dass es nicht zu gütigeren Menschen kommen konnte. Heute habe ich meine kleine Petra gesehen. Nun können Sie mich anzeigen. Herr von Wellentin wird es sicher mit Freuden tun. Sie wollte ich nicht belügen. Ich habe Ihnen sehr viel zu verdanken, aber Frau Denise von Wellentin danke ich noch mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass man sie derart beschimpft und herabsetzt. Sie hat niemandem etwas Böses getan. Nur Gutes!«
»Edith, ich werde meinem Mann nichts sagen«, erklärte Irene von Wellentin fest. »Oh, es ist so bitter, wenn man seine Fehler einsieht und nicht mehr gutmachen kann. Aber ich werde erst Frieden finden, wenn ich mich von ihm trenne.
Ich habe meinen einzigen Sohn verloren. Jetzt hätte ich ein Findelkind gewinnen können. Aber ich habe mich auch dagegen versperrt, weil er es wollte. Weil ich ein ganzes Leben lang nur das tat, was er wollte. Und ich schwieg, ich schwieg immer, wo ich hätte reden sollen. Wenn ich an Ihnen etwas gutmachen könnte. Ich gebe Ihnen Geld, damit Sie Ihr Kind zu sich nehmen können. Ich werde mich um Sie kümmern. Wollen Sie sich das nicht überlegen?«
Edith schüttelte den Kopf. »Ich werde ein zweites Mal an der Tür von Sophienlust anklopfen, und diesmal werde ich die ganze Wahrheit sagen. Vielleicht gibt man mir die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Für mein Kind und für andere Kinder. Ich möchte nur endlich nicht mehr schweigen und lügen müssen, selbst wenn man mich dafür einsperrt.«
»Das wird man nicht tun. Ich werde mich jederzeit für Sie verwenden.«
»Sie?«, fragte Edith staunend. »Sie sollen meinetwegen keine Schwierigkeiten haben.«
»Ich bin allem ausgewichen, bisher«, erwiderte Irene von Wellentin bitter. »Ich habe niemals eine Entscheidung allein getroffen und habe damit auch meine wenigen Freunde verloren. Ich lebe, nein, ich lebe ja gar nicht. Ich vegetiere dahin. Aber wozu sage ich das alles? Es ist doch meine Schuld.«
»Welcher Mensch ist schon ohne Schuld?«, erwiderte Edith leise.
*
Denise hatte es nicht über sich gebracht, Alexander von der Begegnung mit der Baronin Klees zu erzählen.
Nun saßen sie gemeinsam an Saschas Bett, und sie musste erzählen. Von den Kindern, den Ponys und sogar von Senta und ihren Jungen.
»Ich freue mich schon, wenn ich alle wiedersehe«, sagte er, und sie konnten sich nur wundern, wie sanft dieser störrische Junge jetzt war.
»Schade, dass du nicht hierbleiben kannst, Tante Isi«, meinte er bekümmert, »aber du hast ja so viele Kinder.«
»Du wirst bald heimkommen, Sascha«, tröstete sie ihn.
»Ja, ganz schnell. Andrea wird mich beneiden, wenn ich noch vor ihr zu Hause sein kann.«
»Sie wird vor allem froh sein, wenn du wieder gesund bist«, meinte sie liebevoll. »Ich habe dir noch ein paar Bücher mitgebracht, damit dir die Zeit nicht nicht zu lang wird.«
Seine Augen leuchteten auf. »Oh, das sind tolle Bücher. Solche habe ich gern. Woher weißt du das?«
»Ich dachte es mir«, erwiderte sie lächelnd. »Du bist doch ein richtiger Junge, der Abenteuergeschichten mag.«
»Wenn Nick erst lesen kann, gebe ich sie ihm«, versicherte er.
Nun hieß es Abschied nehmen, und Denise versuchte es allen leichtzumachen. Sie wollte nicht, dass Alexander sie noch zum Hotel begleitete. Es wäre ihm und auch ihr zu schwer geworden.
Vor dem Jungen konnte sie sich zusammennehmen, aber als sie die geliebten Augen auf sich ruhen fühlte, war es beinahe um ihre Fassung geschehen.
In seinem Blick las sie alles, was sie ersehnte und zugleich fürchtete.
Auf dem Gang traf sie Dr. Wolfram. Sie hatten noch immer nicht miteinander sprechen können.
Jetzt fasste er sich ein Herz. »Ist Claudia denn glücklich?«, fragte er verlegen.
»O ja. Nur werde ich sie leider nicht mehr lange behalten können«, erwiderte sie.
»Sie verdient es, dass sie sehr glücklich wird. Und Ihnen wünsche ich auch von Herzen alles Glück, gnädige Frau.«
»Wenn Ihr Weg Sie einmal nach Sophienlust führt, Sie sind uns stets willkommen, Herr Doktor!« Mit diesen herzlichen Worten verabschiedete sie sich.
Da sie nun schon auf dem Weg war, wollte sie doch noch in Geißenberg nach der kleinen Carola Dahm schauen.
Ihre eigentliche Aufgabe, anderen Kindern ein Heim zu geben, wollte sie über ihren persönlichen Angelegenheiten nicht aus dem Auge verlieren. Das Waisenhaus sah grau und düster aus. Konnten in einem solchen Bau Kinder überhaupt froh werden, fragte sie sich schaudernd.
Man empfing sie mit größter Zurückhaltung, als sie sich nach Carola Dahm erkundigte.
Denise gab sich Mühe, ihr Anliegen so vorsichtig wie möglich zu formulieren, da sie den Widerstand fühlte, den man ihr entgegensetzte. Carola Dahm? Ein verstocktes, unzugängliches Mädchen, mit dem man nichts als Schwierigkeiten hätte. Sie wäre ein Außenseiter unter den sonst so zugänglichen Kindern.
Waren diese anderen Kinder zugänglicher, oder hatten sie sich bereits in ihr Schicksal ergeben, da ihnen doch nichts weiter übrig blieb? Man gestattete Denise schließlich einen Blick auf den Spielplatz. Selbst gespielt wurde hier nach einem strengen Reglement. Carola, ein schmales, farbloses Mädchen, stand abseits. Sie folgte auch dem mit militärischer Strenge erteilten Befehl, sich an diesem Ballspiel zu beteiligen, nicht.
»Da sehen Sie es, Frau von Wellentin«, sagte eine vorwurfsvolle Stimme neben Denise. »Wir sind wirklich froh, dass sie nächsten Monat vierzehn wird.«
»Wieso, was hat das zu bedeuten?«, fragte Denise mechanisch.
»Dass sie in eine Lehre kommt. Nur wird es sehr schwierig sein, sie unterzubringen. Dieses Mädchen hat Ambitionen, die man sich in ihrer Lage nicht leisten kann.«
»Welche?«
»Sie malt.«
Das klang so, als wäre es ein Vergehen. Denise spürte eine seltsame Beklemmung. »Kann ich bitte mit ihr sprechen?«, fragte sie höflich.
»Wenn Sie sich der Mühe unterziehen wollen. Aber es wird dabei nichts herauskommen. Sie blamiert uns ständig.«
»Ich habe schon einige Erfahrung mit Kindern gesammelt«, meinte Denise. »Mit Kindern ja«, dachte sie dabei für sich, aber das war ein junges Mädchen und wahrscheinlich über ihre Jahre hinaus gereift.
Wie konnte das Gesicht einer Vierzehnjährigen nur so verschlossen, so in sich gekehrt sein?
»Roli«, sprach sie sie leise an.
Ein fragender Ausdruck trat in die ernsten Augen.
»Ich soll dich von Dominik grüßen. Ich bin seine Mutter. Und auch von Susanne.«
»Nick und Susi?« Die Stimme zitterte. »Sie kommen von Haus Bernadette?«
»Nein, ich habe selbst ein Kinderheim gegründet. Möchtest du nicht auch zu uns kommen?«
»Ich bin schon zu alt«, wehrte sie fast heftig ab. »Ich werde vierzehn und muss jetzt arbeiten.«
»Du müsstest es nicht, Roli. Bei uns ist Platz genug. Nick und Susi würden sich freuen.«
»Damals war ich noch kleiner«, murmelte sie. »Es wäre schön, wenn ich noch jünger wäre«, fügte sie dann leise hinzu. »Aber es ist lieb, dass mich Nick und Susi nicht vergessen haben.«
»Roli, ich möchte wirklich gern, dass du zu uns kommst«, wiederholte Denise eindringlich.
»Ich würde Ihnen nur zur Last fallen. In meinem Alter wird es Zeit, für mich selbst zu sorgen. Ich habe doch niemanden mehr.«
»Du hättest uns. Soll ich dir von Sophienlust erzählen?«
Carola schüttelte den Kopf. »Die bestimmen doch, was aus mir wird«, erklärte sie trotzig und sah zu den Schwestern hinüber.
»Sie sagten mir, dass du gern malst.«
»Dafür bekomme ich ja auch genügend Schelte.«
»Bei uns könntest du malen! Du könntest dich auf einen Beruf vorbereiten, ohne Zwang.«
Carola presste die Lippen aufeinander. »Sie verstehen das?«, fragte sie dann verwundert.
»Ich war früher Tänzerin«, erwiderte Denise. »Ich weiß, wie es ist, wenn man sich einen bestimmten Beruf erträumt oder etwas Ausgefallenes ganz besonders gern tun möchte.«
»Sie waren aber sicher nicht in einem Waisenhaus!«
»Sophienlust ist kein Waisenhaus.«
Carola drehte sich um und lehnte ihre Stirn an die raue Mauer. Denise sah, wie ihre Schultern zuckten, und trat auf sie zu. Behutsam legte sie ihren Arm um das Mädchen.
»Roli, ich habe selbst viel Trauriges erlebt. Meinst du nicht, dass wir uns verstehen würden?«
»O doch«, sagte sie stockend.
»Das ist immerhin ein Anfang. Ich werde dich kaum gleich mitnehmen können, aber ich werde dich holen.«
»Das sagen Sie jetzt nur so. Ich kann etwas noch so sehr wünschen, es geht nie in Erfüllung.«
»Wünsche es dir, es wird in Erfüllung gehen. Ich möchte, dass du wieder lachst.«
»Dass ich lache?« Nicht einmal der Hauch eines Lächelns lag auf ihrem Gesicht.
Eine Schwester trat auf sie zu. »Bist du auch höflich zu Frau von Wellentin?«, fragte sie mahnend.
Carola drehte sich unvermittelt um und lief davon. »Ich habe Sie ja gewarnt, gnädige Frau. Alles ist in den Wind geredet. Sie wird sich nicht mehr ändern.«
»Welche Bedingungen muss ich erfüllen, um sie zu mir zu nehmen?«, fragte Denise ruhig. »Und wann kann ich sie abholen?«
»Wollen Sie ihr eine Stellung geben?«
»Ja«, erklärte Denise kurz entschlossen.
»Es wird keine Schwierigkeiten geben, wenn sie vierzehn ist. Natürlich wird das Vormundschaftsgericht einen Pfleger bestimmen.«
»Kann ich darauf Einfluss nehmen?«
»Gewiss, wenn Sie eine geeignete Persönlichkeit vorschlagen können.«
»Ich werde jemanden vorschlagen. Sagen Sie Carola bitte, dass ich sie an ihrem vierzehnten Geburtstag abholen werde.«
*
Nick machte ein enttäuschtes Gesicht, als seine Mutter allein aus dem Wagen stieg.
»Hast du denn gar kein Kind gefunden, Mami?«, erkundigte er sich.
»Ich war doch diesmal nicht auf Kindersuche«, beschwichtigte sie ihn, »aber in ein paar Wochen wird Roli kommen. Tröstet es dich?«
»Du hast sie gefunden?«, staunte er.
»Ja, ich habe sie gefunden. Aber Roli ist jetzt schon ein großes Mädchen.«
»Wie Claudia oder Frau Gerlach?«
»Wer ist Frau Gerlach?«, gab nun Denise erstaunt zurück.
»Bei uns tut sich immer was«, meinte er eifrig. »Sie ist gestern gekommen. Sie war bei den Wellentins. Die haben sie vor die Tür gesetzt. Justus hat gesagt, dass man mit so was ja rechnen muss, wenn sich einer hierher wagt.«
»Nun mal schön langsam«, wehrte Denise ab, denn Claudia kam gerade dazu. »Wie ich Nick kenne, hat er schon berichtet«, stellte sie mit einem flüchtigen Lächeln fest. »Das andere werde ich dir erzählen, Isi.«
»Aber jetzt will ich erst wissen, wie es Sascha geht«, verlangte Nick. »Hat er sich über den Elefanten gefreut?«
»Sehr, und noch mehr freut er sich, dass er bald heimkommen kann.«
»Muss er nicht mehr zu seiner Großmama zurück?«
Aber bevor er Antwort darauf erhielt, erstattete Claudia Bericht.
»Sie hat dir gestanden, dass sie Petras Mutter ist«, meinte Denise.
»Aber sie bittet inständig darum, dass es noch niemand erfährt.«
»Es wird kaum zu verhindern sein, wenn Frau von Wellentin es weiß. Sie wird es sicher an die große Glocke hängen.«
»Das glaube ich nicht. Warten wir’s ab. Ich habe schon mit Lutz gesprochen. Viel kann ihr nicht passieren, wenn du nicht querschießt.«
»Ich, warum sollte ich denn querschießen?«
»Wegen der Wellentins. Sie warten doch nur darauf, er wenigstens, um dir etwas am Zeug zu flicken.«
»Das könnte zu einem Bumerang für ihn werden«, entgegnete Denise lächelnd. »Es gibt Augenblicke, in denen man zu Mittteln greift, die einem sonst nicht liegen.«
»Dunkel ist deiner Rede Sinn, aber ich sehe schon, dass du nicht mehr sagen willst. Es ist okay, Isi. Willst du sie jetzt kennenlernen? Sie bangt deinem Erscheinen förmlich entgegen.«
Dazu bestand keine Veranlassung. Denise musterte sie eingehend, dann streckte sie ihr die Hand entgegen.
»Es wird sich schon alles klären«, sagte sie herzlich. »Willkommen in Sophienlust, Frau Gerlach!«
*
»Du weißt mehr, als du mir sagen willst«, herrschte Hubert von Wellentin seine Frau an. »Ich kann ja reden, was ich will, du glaubst mir nicht. Ich wusste gleich, dass sie mit dieser Person unter einer Decke steckt. Nun ist sie da gelandet, wo sie herkam. Du wirst auch nicht klüger, Irene.«
»Ich weiß, dass ich dumm bin«, entgegnete sie eisig. »Ich war sogar so dumm, anzunehmen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast. Aber ich muss wohl deutlicher werden. Ich mache reinen Tisch, Hubert. Ich ziehe die Konsequenzen, die ich schon vor Jahren hätte ziehen müssen.«
Er blickte sie fassungslos an. »Du willst dich scheiden lassen? Welche idiotische Idee. Aus welchen Gründen denn?«
»Weil ich frei sein will. Frei von all diesen quälenden Vorstellungen, die mir das Zusammensein mit dir anlastet. Möchtest du, dass ich dir aufzähle, was ich alles weiß? Von Sibylle angefangen, über …«
»Schweig«, fiel er ihr wütend ins Wort. »Hör mir mit diesem Klatsch auf. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.«
»Gott bewahre, wann hättest du dir jemals Vorwürfe gemacht. Du hast dir nichts vorzuwerfen, du nicht. Schuld sind immer die anderen. Auch die Frauen, die deinem Charme erlagen.«
»Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen«, fuhr er sie an.
»Jetzt nicht mehr«, erwiderte sie kalt. »Du bist ein Heuchler. Und du bist feige. Jetzt habe ich endlich den Mut, das zu erkennen. Du gehst über Leichen, wenn es um dein Ansehen, dein Image geht. Aber du merkst gar nicht, wie sehr auch das schon längst erschüttert ist. Der Name von Wellentin wird jetzt würdiger vertreten, und du kannst froh sein darüber, dass deine Mutter dieses Testament gemacht hat.«
»Du hast vor kurzer Zeit noch ganz anders gesprochen.«
»Natürlich, ich hatte ja Angst vor dir. Was du sagtest, musste auch ich vertreten. Ich bin eben eine dumme Frau, eine einfältige Person. Aber Angst habe ich jetzt nicht mehr.«
Es war ihr ernst, sehr ernst, wie ihre Miene verriet. Hubert von Wellentin war völlig aus der Fassung gebracht. Scheidung? Einen solchen Skandal konnte er sich nicht leisten. Jetzt schon gar nicht. Dreißig Jahre waren sie fast verheiratet, und oft war es ihm gewesen, als würde jedes Jahr doppelt zählen. Manchmal hatte er sie sogar gehasst, aber Scheidung?
»Denkst du auch an die Konsequenzen?«, fragte er.
»O ja! Aber denkst du auch daran? Ich werde mein Vermögen aus dem Unternehmen ziehen. Das ist die erste Konsequenz.«
»Irene!«
Sie lachte bitter. »Das trifft dich, nicht wahr? Wenn es ums Geld geht, regt sich etwas in dir. Würdest du die Freundlichkeit haben, dir ein anderes Quartier zu suchen. Dies ist mein Haus, wie du dich erinnern wirst. Ich möchte hier empfangen und aufnehmen, wen ich will, ohne Gefahr zu laufen, dass meine Gäste oder auch meine künftigen Angestellten von dir hinausgeekelt werden. Alles übrige erfährst du von Doktor Brachmann.«
»Von Brachmann? Bist du wahnsinnig geworden. Er ist mein Anwalt.«
»Er war es. Du wolltest seine Dienste ja nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich werde ihn mit der Wahrnehmung meiner Interessen betrauen.«
»Dann darf ich wenigstens hoffen, dass du bisher nichts in dieser geradezu lächerlichen Angelegenheit unternommen hast?«
»Wie lächerlich sie mir ist, wirst du schon noch merken«, erwiderte sie kühl. »Ich möchte jetzt allein gelassen werden.«
Er war völlig verwirrt und brachte kein Wort über die Lippen. Irene von Wellentin schloss die Augen und deutete wortlos auf die Tür. Diesmal wartete sie vergeblich darauf, dass sie wie sonst mit hartem Knall ins Schloss fallen würde.
*
»Das darf doch nicht wahr sein«, sagte Claudia verblüfft zu Lutz Brachmann. »Ich kann es nicht glauben, dass sie sich tatsächlich scheiden lassen will.«
»Ich sage es dir natürlich unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit, aber es ist wahr. Vater ist auch aus allen Wolken gefallen.«
»Und die Gründe?«
Er zuckte die Schultern. »Wahrscheinlich hat sie alles schon jahrelang mit sich herumgeschleppt. Für ihn wird es insofern ein harter Schlag sein, als sie ihr gesamtes Vermögen aus dem Werk ziehen will. Im Augenblick wird er das kaum verkraften können. Er hatte zu sehr mit dem Vermögen seiner Mutter gerechnet und flott gewirtschaftet.«
»Irgendetwas Gutes muss also doch in ihr sein«, meinte Claudia nachdenklich. »Edith hatte es ja schon angedeutet. Ich bin froh, dass er sie vor die Tür gesetzt hat, sonst müsste sie jetzt seine Wut ausbaden. Sie ist selig, dass sie bei dem Kind sein kann. Man muss sich in ihre Lage versetzen …«
»Das brauchst du nicht«, unterbrach er sie. »Bei uns wird alles hübsch der Reihe nach vonstatten gehen. Erst wird geheiratet, dann werden Kinder in die Welt gesetzt, und ich kann dir versichern, dass du nie in eine solche Lage kommen wirst, dass du eines von ihnen aussetzen musst. Wann heiraten wir, Claudia?«
»Du weißt doch, dass es jetzt noch nicht möglich ist. Wir kennen uns erst ein paar Wochen.«
»Ich kannte dich von der ersten Stunde an bereits genau«, versicherte er.
Sie lachte schelmisch. »Nun übertreib aber bitte nicht. Bis jetzt weißt du noch nicht mal, wie viele Männer ich schon hatte.«
»Gar keinen«, erwiderte er.
»Du bist deiner Sache aber sehr sicher.«
»Ich liebe dich eben«, meinte er. »Da hat man einen sechsten Sinn.«
»Ich dachte immer, da wäre man blind und taub.«
»Bei mir ist es eben umgekehrt.«
»Und Eifersucht gäbe es bei dir natürlich auch nicht«, neckte sie.
»Nein.«
»Du bist ein seltenes Exemplar.«
»Für dich hoffentlich einmalig!«
»Für mich einmalig«, bestätigte sie und schmiegte sich an ihn.
*
Denise ahnte nicht, was um sie herum geschah. Das lag zunächst an der Arbeit, dann an den Überlegungen bezüglich ihrer Zukunft.
Von Susannes Vater war ein langer Brief eingetroffen. Sie las ihn der Kleinen allein vor, worüber Nick beleidigt war.
»Als ob ich nicht wissen dürfte, was er schreibt«, beschwerte er sich.
»Susi wird es dir erzählen«, erwiderte sie unnachsichtig. Sie meinte, dass Susanne das Recht hätte, die Nachricht ihres Vaters zuerst und ganz allein zu erfahren.
»Du bist lieb, Tante Isi«, dankte es ihr das Kind. »Lesen kann ich es ja noch nicht, aber ich kann es Nick dann erzählen.«
Zu ihren Füßen hockend, den Kopf an ihre Knie gelehnt, hörte Susanne, wie sich ihr Vater in Johannesburg einzuleben versuchte. Er hatte eine moderne Wohnung und war mit seiner Stellung und seinem Chef sehr zufrieden.
»Manchmal wäre es mir allerdings recht schwergefallen, mich hier einzuleben, wenn Ines Jakobus mir nicht geholfen hätte«, ließ er am Ende des Briefes verlauten. »Ich habe dir doch von ihr erzählt, Susikind. Ich hoffe so sehr, mein Liebling, dass du gesund bist und dass dich Gott behütet, bis ich dich wieder in meine Arme schließen kann.«
»Mein Papi macht sich Sorgen, dass ich auch gesund bin«, war das erste, was Susi ihrem Freund Nick berichtete.
»Wir werden schon auf dich aufpassen«, versicherte Nick. Er dachte eine Weile nach. »Wenn dein Papi erst eine Wohnung gekriegt hat, wird es hoffentlich noch etwas dauern, bis er ein Haus bauen kann. Ich möchte gar nicht gern, dass er dich schnell wegholt, Susi.«
»Ich habe aber manchmal Sehnsucht nach ihm«, erwiderte die Kleine. »Ein Jahr vergeht wohl doch sehr langsam.«
»Erst kommt mal der Herbst, dann der Winter und Weihnachten, dann wieder der Frühling«, belehrte sie Nick. »Und wenn wir in die Schule gehen, wird die Zeit ganz schnell vergehen. Nun kommen auch bald Robbys Mutter und Sascha, und dann noch Roli.«
»Andrea nicht zu vergessen«, mischte sich Denise ein. »Sascha und Herr von Schoenecker kommen morgen.«
»Warum du immer noch Herr von Schoenecker sagst«, meinte Nick missbilligend. »Es ist doch Onkel Alexander.«
»Für Tante Isi ist er doch kein Onkel«, kicherte Susanne.
»Dann eben Alexander. Du nennst ihn doch auch so, Mutti, dann brauchst du doch zu anderen nicht so fremd von ihm reden.«
Was wird er sich erst für Gedanken machen, wenn er hört, dass wir uns duzen, überlegte Denise.
»Wo stecken eigentlich Robby und Mario?«, erkundigte sich Denise.
»Die hocken jetzt immer beisammen«, murrte Nick, »Mario hat doch Angst, das Frau Trenk Robby gleich wieder mitnimmt. Na ja, ist auch traurig für ihn, weil er keinen Papi und keine Mami mehr hat.«
»Frau Trenk bleibt jetzt erst mal bei uns«, erklärte Denise. »Und dann kommt Roli. Die hat auch niemanden, aber ihr sollt euch an den Gedanken gewöhnen, dass wir alle zusammengehören.«
»Ist ja richtig, Mami, aber Sascha und Andrea haben einen Vater und Susi auch. Robby, Petra und ich haben eine Mami. Das ist eben doch was anderes, als wenn man nur zusammengehört.«
Es ist alles viel schwieriger, als man es sich vorstellt, dachte Denise. Die Kinder empfinden es instinktiv, und besonders diejenigen, die niemanden haben, zu dem sie Vater oder Mutter sagen können.
*
»Ich möchte dich noch sprechen, Alexander«, sagte die Baronin Klees, als er Saschas Koffer im Wagen verstaute.
»Wir haben doch immer wieder versucht, miteinander zu sprechen«, gab er zurück. »Es ist nutzlos. Es kommt nichts dabei heraus.«
»Ich ließ bisher diese Denise von Wellentin unerwähnt. Mich wundert, dass du mir keine Vorwürfe wegen meines Gesprächs mit ihr gemacht hast.«
»Du hast mit ihr gesprochen?«, fragte er überrascht. »Das ist mir neu. Denise hat mir davon nichts gesagt.«
»Sie war sehr unhöflich zu mir«, stieß sie erbittert hervor.
»Du wirst wohl auch nicht gerade freundlich zu ihr gewesen sein.«
»Du hast die Absicht, sie zu heiraten?«, fragte sie lauernd.
Er blickte über sie hinweg und antwortete abweisend: »Ich habe keine Lust, mit dir darüber zu sprechen. Frau von Wellentin hat sich ein Ziel gesetzt, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.«
»Immerhin aber wirst du ihr die Erziehung von Sybilles Kindern weitgehend anvertrauen«, bemerkte sie aggressiv.
»Von meinen Kindern«, betonte er.
»Du wirst nichts unversucht lassen, sie ganz von mir zu trennen«, warf sie ihm vor.
»Sie können dich besuchen, wenn sie den Wunsch haben, und du kannst sie besuchen.«
»Ich werde Schoeneich nie wieder betreten«, erwiderte sie beleidigt. »Ich bitte dich darum, mir Sybilles Bild zu schicken. Dir bedeutet es ja doch nichts.«
Seine Augen verengten sich. »Du weißt, dass ich sie geliebt habe«, sagte er ruhig. »Du weißt auch, dass sie diese Liebe nie ganz erwidert hat. Sybille ist tot. Ich werde die Kinder fragen, ob ich dir das Bild schicken soll. Sie werden es entscheiden. Ihnen wenigstens soll das Andenken an ihre Mutter ungetrübt bleiben. Adieu.«
»Was wollte Großmama noch mal von dir?«, fragte Sascha ängstlich. »Ist sie sehr böse, dass ich mit dir fahre?«
»Es tut mir leid, mein Junge«, erwiderte Alexander leise.
»Du kannst nichts dafür. Ich habe das früher nicht verstanden, Papi.«
Vati … Papa … und nun Papi, drückt er damit den Wandel aus, der in ihm vor sich gegangen ist?
»Es gibt viele Dinge, die auch ich nicht verstehe, Sascha. Du solltest dir keine Gedanken darüber machen.«
»Das muss ich aber. Großmama war böse, dass Tante Isi mich besucht hat. Man darf doch einem Menschen, der lieb ist, nicht böse sein.«
»Du bist sehr verständig, Sascha.«
»Ich werde ja schon elf Jahre«, erwiderte er nachdenklich. »Großmama sagt immer: Noblesse oblige. Warum sagt sie das, Papi?«
»Adel verpflichtet, heißt es im Deutschen, Sascha. Ich denke, er sollte uns vor allem dazu verpflichten, immer gerecht zu sein.«
Sascha nickte. »Aber ältere Leute müssten eigentlich noch gerechter sein«, stellte er dann fest. »Sie haben doch schon viel mehr gelernt als Kinder.«
Doch mancher lernt nie aus, dachte Alexander.
*
Edith Gerlach hatte Petra versorgt und schickte sich gerade an, ihren anderen Pflichten nachzugehen, als sie einen Wagen vorfahren sah. Ihre Augen weiteten sich, als diesem Frau von Wellentin entstieg.
Sie wurde plötzlich blass, denn sie fürchtete für Denise Unannehmlichkeiten, und gerade heute war Denise besonders fröhlich.
Schnell ging sie auf die Ankommende zu. »Oh, gnädige Frau, ich bitte Sie inständig, Frau von Wellentin keine Vorwürfe zu machen«, flehte sie.
»Deswegen bin ich nicht gekommen«, erwiderte Irene von Wellentin wehmütig. »Ich wollte mir Ihre kleine Tochter anschauen, wenn es erlaubt ist.«
Auch Nick hatte die Besucherin bereits erspäht. Er wartete auf die Ankunft von Onkel Alexander und Sascha. Seine Stirn legte sich in nachdenkliche Falten, als er die Dame im hellgrauen Kleid erkannte.
»Mutti«, raunte er, »eben ist jemand gekommen, aber nicht Onkel Alexander. Du wirst dich nicht so freuen. Es ist Großmutter. Weißt du, dass sie kommt?«
»Nein, das wusste ich nicht, Nick«, erwiderte Denise. Kamen nun doch die schon lange befürchteten Unannehmlichkeiten für Edith und sie?
»Ich sage nicht guten Tag«, meinte Nick bockig. »Auch wenn sie freundlich mit Edith redet.«
»Tut sie das?«, fragte Denise.
»Es sieht so aus. Aber Edith ist ganz rot geworden. Eben gibt Frau von Wellentin ihr ein Paket. Es ist ziemlich groß, Mami.«
»Wenn du neugierig bist, solltest du lieber doch hinausgehen«, meinte Denise.
»Bist du etwas nicht neugierig?«, fragte er unschuldig.
»Ich gehe ja hinaus«, erwiderte sie.
»Ach, du meine Güte«, seufzte er. »Bis jetzt haben wir uns so gefreut. Wer weiß, was nun passiert.«
Edith Gerlach kam ihr auf halbem Weg entgegen. Sie war schrecklich verlegen.
»Frau von Wellentin ist nur gekommen, um Petra anzuschauen«, stotterte sie. »Erlauben Sie es, gnädige Frau?«
»Sie sollen mich nicht so nennen, Edith. Warum sollte ich es nicht erlauben? Es ist Ihr Kind.«
»Aber … es ist alles so schwierig, und es ist mir sehr peinlich, sie kommt bestimmt nicht mit einer bösen Absicht. Sie sieht sehr elend aus.«
Das konnte Denise allerdings auch feststellen. Die beiden Frauen maßen sich mit einem langen Blick, dann reichten sie sich die Hände.
»Es hat sich sehr viel verändert, seit wir uns begegneten«, begann Irene von Wellentin verhalten. »Ich habe Ihnen viel abzubitten, Denise.«
»Sie wollen Petra besuchen«, lenkte Denise hastig ab.
»Und Dominik, wenn Sie es mir erlauben.«
Denise zögerte. »Ich werde ihn holen«, nickte sie.
Bockig verschränkte Nick die Arme auf dem Rücken. »Nein, ich sage nicht guten Tag«, erklärte er. »Sie wollte nicht meine Großmutter sein, nun habe ich mich daran gewöhnt.«
»Man soll eine Hand, die einem geboten wird, niemals ausschlagen, Nick«, warnte sie eindringlich. »Es ist für einen älteren Menschen viel schwerer, seine Ansicht zu ändern als für einen jungen.«
»Das sagst du. Warum soll es schwerer sein? Ich hätte doch gern eine liebe Großmutter gehabt. Ich war ja nicht ekelhaft«, trumpfte er auf.
»Ich habe ihr auch die Hand gegeben«, sagte Denise. »Sie ist jetzt ganz allein, Nick.«
»Ist ihr Mann tot?«, fragte er naiv.
»Nein, sie hat sich wohl mit ihm zerstritten. Verstehst du das? Auch Erwachsene sind nicht immer einer Meinung.«
»Justus und Urban streiten auch manchmal, aber dann vertragen sie sich gleich wieder«, meinte er. »Na schön, Mutti, wenn du willst, dass ich mich mit ihr vertrage, oder wenn sie sich mit mir vertragen will, können wir es ja mal versuchen. Ich mag sowieso keinen Streit.«
»Wie gescheit du bist«, lächelte sie.
Das Lob freute ihn sichtlich und erleichterte ihm die Versöhnung.
Irene von Wellentin betrachtete gerade das Baby, als Nick kam.
»Für Sie hat alles einen guten Verlauf genommen, Edith«, sagte sie eben. »Ich bin froh darüber.«
»Ich möchte guten Tag sagen«, meldete sich Nick.
Irene von Wellentin richtete sich auf. Freude lag in ihren Zügen, als der Junge sie erwartungsvoll anschaute.
»Guten Tag, Dominik«, sagte sie. »Ich fürchtete, dass du nicht kommen würdest.«
Ob man mit ihr auch so reden kann wie mit Mutti, überlegte Nick. Er wusste nicht recht, was er sagen sollte. Es war ihm auch ein wenig unheimlich, dass sie seine Hand so sehr drückte.
Edith hatte das Zimmer verlassen. Nick zwinkerte mit den Augenlidern.
»Petra ist niedlich, nicht wahr?«, sagte er.
»Sehr niedlich!«
»Sie ist schon mächtig gewachsen, seit sie bei uns ist«, fuhr er fort. »Möchtest du unsere anderen Kinder auch kennenlernen?«
»Gern, aber zuerst möchte ich dich kennenlernen. Ich habe dir etwas mitgebracht, Dominik. Darf ich es dir geben?«
Er blickte sich nach seiner Mutter um. »Darf ich es annehmen, Mutti?«, fragte er.
Sie nickte.
Dominik beobachtete verblüfft, wie sie ihm eine goldene Uhr in die Hand legte.
»Sie gehörte früher deinem Vater, Nick«, flüsterte Irene von Wellentin, nur mühsam die Tränen unterdrückend.
»Sie ist sehr schön«, stellte Nick fest. »Darf ich sie aufheben, bis ich groß bin? Ich möchte nicht, dass sie kaputtgeht oder dass ich sie verliere. Danke! Wie soll ich zu dir sagen?«
»Wie du willst.«
»Großmutter ist sehr lang. Wie sagt man sonst noch zu Großmüttern, Mutti?«
»Omi vielleicht«, warf Denise ein.
»Omi«, wiederholte er. »Das klingt gut.«
Er konnte nicht begreifen, weshalb sie plötzlich ganz schnell im Haus verschwand.
»Nun wollte ich doch gerade lieb sein, Mutti, und da läuft sie weg«, meinte er kopfschüttelnd. »Was sollen wir jetzt machen?«
»Ein wenig warten und dann zu ihr gehen«, erwiderte Denise und legte den Arm um ihn. »Du warst sogar sehr lieb, Nick. Das hatte sie wohl nicht erwartet.«
»Wo sie mir eine so schöne Uhr von meinem Vater geschenkt hat, da musste ich ja lieb sein.«
Im selben Augenblick fuhr noch ein anderer Wagen vor. »Jetzt kommen Onkel Alexander und Sascha. Was soll ich nun zuerst tun«, seufzte Nick.
»Sie begrüßen. Ich glaube, dass deine Omi lieber ein anderes Mal wiederkommen möchte.«
So ganz konnte Nick das zwar nicht verstehen, aber er war vorerst abgelenkt. Sascha sah noch sehr blass aus, und das erregte sofort Nicks Mitgefühl.
»Fein, dass du wieder bei uns bist«, begrüßte er ihn strahlend.
»Ist noch Besuch da?«, fragte Sascha enttäuscht.
»Es ist meine Omi. Aber sie will lieber ein andermal wiederkommen, meint Mutti.«
»Du hast eine Omi?«, staunte Sascha. »Seit wann denn?«
»Seit heute. Vorher war es die Frau von Wellentin. Ich begreife nicht so ganz, warum das alles so gekommen ist. Du auch nicht, Onkel Alexander, nicht wahr? Du guckst auch ganz komisch.«
*
Es war Irene von Wellentin ganz recht gewesen, sich für heute verabschieden zu können, denn sie wollte am liebsten mit niemandem mehr zusammentreffen. Ein andermal, wie Denise herzlich sagte, konnte sie unbeschwert kommen. Dann hatte sie es auch verarbeitet, dass sie nun Dominiks Omi sein durfte.
Ein Leuchten verklärte Denises Gesicht, als sie Alexander entgegenging. Der fragende Ausdruck in seinen Augen wich einem sehnsüchtigen, und sie mussten sich beide sehr beherrschen, dass sie sich nicht in die Arme sanken.
Sascha warf seinem Vater einen unergründlichen Blick zu. »Komm, Nick, du musst mir viel zeigen«, sagte er plötzlich. »Zuerst möchte ich Habakuk sehen. Und dann Senta und die kleinen Hunde.«
»Und Susanne und Robby musst du auch noch kennenlernen«, ergänzte Nick eifrig.
Sascha war fast einen Kopf größer als Dominik. Gemeinsam entfernten sie sich, und mit einem heißen Glücksgefühl beobachtete Denise, dass sie sich bei den Händen fassten.
»Dein Sohn und mein Sohn«, sagte Alexander neben ihr. »Ich wünsche so sehr, dass …«
»Nichts sagen, Alexander«, fiel sie ihm rasch ins Wort. »Was wir wünschen, müssen wir noch in unseren Herzen verschließen. Aber du bist da, und du bist mir nahe. Das ist schon sehr viel.«
Es ist zuwenig, wenn man liebt, dachte Alexander, aber ich muss dankbar sein, dass es sie gibt.
»Wie geht es dem Baby?«, erkundigte sich Sascha derweil bei Nick.
»Gut. Es hat jetzt auch eine Mami.«
»Sie ist wirklich gekommen?«, fragte Sascha verwundert. »Sie hat es wiederhaben wollen?«
»Sie bleibt jetzt sogar hier«, erwiderte Nick.
»Und Mario?«, erkundigte sich Sascha weiter.
»Seine Eltern sind tot. Er wird immer bei uns bleiben.«
Sascha sah ihn nachdenklich an. »Willst du deine Mutti mit ihm teilen? Wenn sie meine Mutti wäre, würde ich sie mit niemandem teilen wollen.«
»Wir haben es so gewollt«, meinte Nick. »Man kann nicht heute so und morgen anders denken. Das meint Claudia auch. Sie würde jetzt gern heiraten, das heißt, vor allem der Lutz, aber sie warten auch noch. Ich habe mir alles so schön vorgestellt, als ich noch im Haus Bernadette war. Ich wollte nur mit Mutti zusammensein. Jetzt kann ich nicht mehr so einfach sagen, dass ich sie ganz für mich haben will. Das Haus ist doch so groß, und die Urgroßmama hat gewollt, dass es ein Kinderheim wird. Ich darf nur nicht daran denken, dass die Kinder wieder weggehen, wenn man sich an sie gewöhnt hat. So wie Susi. Sie hat nämlich einen Vater.«
Für Sascha waren das alles große Neuigkeiten.
Bald darauf spielte er mit den Kindern im Park, nachdem sie sich miteinander vertraut gemacht hatten.
Alexander und Denise hatten somit Zeit füreinander. Niemand störte sie. Dafür sorgte schon Claudia, die ganz genau wusste, wie sehr Denise diesen Besuch herbeigesehnt hatte, obgleich sie es mit keinem Wort erwähnte.
»Die Kinder werden nun bei mir bleiben«, berichtete Alexander. »Ich muss für Sascha eine geeignete Schule in der Nähe suchen.«
»Es sind mit dem Auto zwanzig Minuten bis zum Gymnasium. Ich habe es schon nachgeprüft«, erwiderte Denise. »Der Chauffeur kann ihn hinbringen und abholen, und wenn du keine Zeit hast oder verreisen musst, können die Kinder bei mir bleiben, Alexander. Jetzt brauchen wir ja nicht mehr zu fürchten, dass sie Einwände dagegen erheben.«
Er legte seine Hände auf ihre Schultern und zog sie an sich. »Jetzt muss ich eher befürchten, dass sie eifersüchtig auf deine anderen Schützlinge werden. Sascha ist es schon.«
»Sie werden einsehen, dass es eine schöne Aufgabe ist, Lieber.«
»Bist du ganz glücklich dabei?«, fragte er hastig.
»Jetzt bin ich ganz glücklich«, erwiderte sie, und ihre weichen Lippen legten sich auf seinen Mund. »Ich glaubte nicht daran, dass ich noch einmal so glücklich werden könnte.«
»Wenn ich nur hoffen darf, dass du mir einmal ganz gehören wirst, Denise«, seufzte er. Und dann küsste er sie voller Leidenschaft.
*
Vierzehn Tage später erhielt Dr. Berkin einen langen Brief aus Sophienlust.
»Mein lieber Papi«, begann er. »Claudia schreibt, was ich ihr sage, Tante Isi hat jetzt wenig Zeit. Es ist sehr viel passiert, seit Du fort bist. Petra hat ihre Mami bekommen, und Robbys Mutter ist jetzt auch bei uns. Sie war sehr krank, aber nun erholt sie sich, und Robby ist sehr froh, dass er wieder mit ihr zusammen ist.
Ich wäre auch froh, wenn ich Dich manchmal sehen könnte. Aber Johannesburg ist so weit weg. Wir haben es auf dem Globus angeschaut.
Stell Dir vor, Nick hat nun auch eine Omi. Die Frau von Wellentin, die ihn erst nicht mochte, kommt jetzt fast jeden Tag, und sie bringt uns allen immer etwas mit. Sie ist viel netter, als wir dachten.
Hoffentlich schreibt Claudia das, denn sie guckt mich ganz komisch an. Aber nach den Ferien kommen wir in die Schule, und dann kann ich bald selbst schreiben. Ich habe Dir auch so viel zu erzählen. Ich möchte nur zu gern wissen, wie es bei Dir aussieht. Wenn ich mir das vorstellen könnte, ginge es noch leichter.
Tante Isi holt heute Roli, die eigentlich Carola heißt, aus dem Waisenhaus ab. Roli war früher auch mit bei Madame Merlinde. Ich kann mich jetzt nicht mehr so gut an sie erinnern, weil wir jeden Tag etwas Neues erleben. Die Kuh Meike hat gekalbt … So ein Kälbchen ist was ganz Niedliches, aber kleine Kinder sind doch noch hübscher. Petra hat ein paar Zähne, und sie lacht schon ganz laut.
Nick habe ich jetzt gar nicht mehr für mich allein, weil Sascha und Andrea auch da sind. Aber wir haben alle viel Spaß und vertragen uns. Manchmal auch nicht, sagt Claudia.
Das ist ein langer Brief, und wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir noch Geburtstag feiern wollen, wenn Tante Isi und Roli kommen. Schreib Du auch mal so einen langen Brief, lieber Papi, und vergiss mich nicht! Viele, viele Bussis von Deiner Susi. Ich muss Dir noch schnell sagen, dass ich das Kettchen immer trage und Dich jeden Tag anschaue. Bitte sag auch schöne Grüße an Ines, ich weiß ihren anderen Namen nicht mehr, und Claudia kann sich auch nicht erinnern.«
Dr. Günther Berkin las den Brief ein paarmal durch. Ein Lächeln lag noch auf seinen Zügen, als Ines Jakobus eintrat und ihm die Post zur Unterschrift brachte. Seit gestern war sie seine Sekretärin, denn ganz unverhofft hatte er die Direktorenstelle bekommen, da sein Vorgänger wegen einer schweren Krankheit seine Arbeit niederlegen musste.
Sie war ein etwas herber Typ, aber wenn sie lächelte, verwischte sich dieser Eindruck.
»Ein Brief von meiner Tochter«, sagte er. »Ich soll Sie grüßen.«
»Sie haben ihr von mir geschrieben?«, fragte sie überrascht.
»Freilich. Ich muss ihr doch alles berichten, wie sie mir auch alles erzählt.«
»Aber sie kann doch noch gar nicht schreiben.«
»Jedoch sehr gut diktieren«, lachte er. »Wollen Sie mal lesen?«
»Das muss sie von ihrem Vater haben«, erwiderte Ines Jakobus, nachdem sie den Brief gelesen hatte.
»Dann darf ich hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Chef zufrieden sind?«
»Sehr!«
Er betrachtete sie nachdenklich. Sie war nicht nur eine perfekte Sekretärin, sondern auch ein Mensch, mit dem man sprechen konnte.
»Darf ich Sie zum Essen einladen?«, fragte er. »Wie ich aus Ihren Papieren entnommen habe, haben Sie heute Geburtstag.«
Sie errötete. »In dem Alter sollte man Geburtstage eigentlich gar nicht mehr feiern.«
»Du liebe Güte, noch nicht mal dreißig und schon so entsagungsvoll? Beeilen wir uns mit der Arbeit, dann können wir Ihr biblisches Alter richtig feiern.«
Sie konnte sich über ihn nur noch wundern. Als er zum erstenmal in Johannesburg gewesen war, hatte er nicht über seine Tochter gesprochen.
Jetzt schien das Kind sein ganzer Lebensinhalt zu sein. Susis Bild stand auf seinem Schreibtisch, und oft betrachtete Ines es entzückt. Es war ein bezauberndes Gesichtchen, das ihr aus dem Lederrahmen entgegenlachte. Ein Kind, das man einfach liebhaben musste.
An diesem für sie so wunderschönen Abend erzählte ihr Dr. Berkin von Denise von Wellentin und Gut Sophienlust. Und sooft er ihren Namen erwähnte, bekam seine Stimme einen ganz eigenartigen Klang.
Er liebt sie, dachte Ines Jakobus, und der Gedanke tat weh, denn sie empfand mehr als Sympathie für diesen zurückhaltenden Mann.
Aber heute war er aufgeschlossen und fröhlich.
Seine beschwingte Laune steckte sie an, und auch Günther Berkin stellte fest, dass sie sehr anziehend sein konnte.
»Ich habe Susanne versprochen, ein Haus für uns zu bauen«, meinte er gedankenvoll.
»Dann werden Sie sie herholen?«, fragte Ines.
»So bald wie möglich. Sie hat mich lange genug entbehren müssen. Wenn Sie das alles wissen, werden Sie mich sicher nicht mehr mögen, dabei liegt mir sehr viel daran, dass wir uns auch weiterhin gut verstehen.«
»An mir soll es bestimmt nicht liegen«, erwiderte sie befangen.
Er nahm ihren Arm und ging mit ihr durch die nächtlichen Straßen. Die Stadt war ihm schon vertraut geworden. Vielleicht konnte er ein Haus günstig erwerben. Man brauchte es ja nicht unbedingt erst zu bauen. Aber zu einem Mann, einem Haus und einem Kind gehörte schließlich auch eine Frau.
Ob Ines Jakobus die Frau war, die seinem Kind die Mutter ersetzen würde?
Und er? Genügte es ihm, wenn Susanne eine Mutter bekam? Genügte eine gute Kameradschaft für eine Ehe?
Das alles musste reiflich überlegt werden. Nein, solche Entscheidungen konnte man nicht impulsiv treffen. Zweimal in seinem Leben war er schwer enttäuscht worden. Eine Frau wie Ines würde ihn gewiss nicht enttäuschen, aber verdiente sie nicht mehr als freundschaftliche Zuneigung?
Plötzlich begann er ihr von seiner Ehe und von Susanne zu erzählen, um die er sich so lange nicht gekümmert hatte.
»Das Kind liebt Sie dennoch. Was wollen Sie mehr?«, fragte sie.
Sie wandte ihm ihr Gesicht zu.
»Ich mag Sie sehr, Ines«, gestand er. »Könnten Sie sich vorstellen, meine Frau zu werden?«
»Ich will es mir nicht vorstellen. Ich werde niemals eigene Kinder haben können«, erwiderte sie sehr ernst.
»Ist das Ihr ganzer Kummer?«
»Ich mag Sie auch sehr, Günther«, gab sie zurück. »Aber wird Susanne mich auch mögen? Davon hängt doch alles für Sie ab.«
»Wir werden sie fragen«, meinte er. »Wenn Sie wollen, Ines.«
»Ich werde mich nicht in Zukunftsträume verlieren«, beschloss sie tapfer. »Ich werde warten.«
*
Auf Gut Sophienlust reiften die Äpfel. Für die Kinder kam die Zeit, an den Schulanfang zu denken. Nun war es auch entschieden, dass Frau Trenk und Robby bei ihnen bleiben sollten. Für Liesl Trenk war es ein leichter Entschluss gewesen.
Sie konnte die Buchführung übernehmen, darin war sie perfekt. Denise war froh, dafür eine so zuverlässige Kraft gefunden zu haben. Robby brauchte sich nicht von den Kindern zu trennen, und Mario war überglücklich, seinen großen Freund nicht entbehren zu müssen.
Auch Roli lebte sich bald ein und verlor zunehmend ihre Scheu. Sie hatte es lange nicht glauben wollen, dass es nun doch Wirklichkeit geworden war, was sie nicht einmal zu hoffen gewagt hatte.
Sie machte sich überall nützlich, wo man sie brauchen konnte. Selig war sie, wenn man sie malen ließ, was immer sie malen wollte. Denise hatte sehr rasch erkannt, dass ein ganz großes Talent in ihr steckte und dass es ein Jammer gewesen wäre, wenn es sich nicht hätte entfalten können.
Wieder hatte sie ein Kind glücklich machen können. Und nun, da der Sommer schon dem Herbst zu weichen begann, zog sie erstmals die Bilanz der vergangenen Monate.
An diesem Tag sollte die offizielle Verlobung von Lutz Brachmann und Claudia gefeiert werden. Wenn sie dann im Frühjahr heirateten, denn länger wollte Lutz nicht warten, konnte Edith Gerlach Claudias Stelle einnehmen.
Sie war sehr umsichtig und sehr fleißig. Stillschweigend hatte sich auch Bürgermeister Lenhard damit abgefunden, dass sie Petras Mutter war. Wo Denise von Wellentin als Schutzengel auftrat, bemühte man sich, ihr gefällig zu sein.
Das neue Schulhaus konnte auch rechtzeitig eingeweiht werden.
Ein neuer Abschnitt begann für das Dorf und für Gut Sophienlust. Ich kann zufrieden sein, dachte Denise. Ein Lächeln ging über ihr Gesicht, als das Telefon läutete und sie Alexanders Stimme vernahm.
Die Kinder wollten wissen, ob sie in Sophienlust schlafen könnten, wenn Claudias Verlobung gefeiert würde. Natürlich durften sie.
»Ich freue mich auf unser Beisammensein, Denise«, schloss Alexander. »Ich habe große Sehnsucht nach dir.«
»Ich auch«, entgegnete Denise glücklich.
*
»Dürfen wir?«, fragten Sascha und Andrea gespannt. »Macht es Tante Isi nicht zu viel Mühe, wenn so viele Leute da sind?«
»Nein, ihr dürft selbstverständlich drüben schlafen.«
»Tante Isi kann ja gar nicht nein sagen«, meinte Sascha. »Sie hat uns nämlich richtig lieb.«
Alexander wandte sich ab. »Ich wollte euch schon lange etwas fragen«, begann er mit ernster Stimme. »Großmama hat mich um das Bild eurer Mutter gebeten. Sie möchte es gern haben.«
»Warum fragst du uns da erst?«, meinte Andrea verwundert. »Schick es ihr doch, wenn sie es haben will. Mir ist es lieber, als wenn sie uns haben möchte.«
»Und du, Sascha, was meinst du?«, fragte Alexander seinen Sohn.
Der Junge betrachtete ihn forschend. »Es wird einen Fleck an der Wand geben«, stellte er gelassen fest. »Der Maler muss eben kommen.«
»Bei dieser Gelegenheit könnten wir dann alle Räume renovieren lassen«, erklärte Alexander.
»Das finde ich toll. Dann bleiben wir so lange in Sophienlust«, freute sich Andrea. »Bekommen wir dann auch so schöne moderne Möbel wie Nick?«
Sascha seufzte plötzlich. »Wenn Tante Isi nicht so viele Kinder zu sich nehmen würde, hätten wir viel mehr von ihr.«
Alexander ging rasch aus dem Zimmer. Ich liebe sie, und die Kinder lieben sie nun auch, dachte er. Warum sollte es für uns keine gemeinsame Zukunft geben? Es muss sich doch ein Weg finden lassen.
»Papi wäre es auch recht, wenn Tante Isi mehr Zeit für uns hätte«, meinte Andrea verschmitzt.
»Ich war richtig blöd«, erklärte Sascha in schöner Selbsterkenntnis. »Wenn ich damals nicht so bockig gewesen wäre, und wenn Großmama nicht immer von der bösen Stiefmutter geredet hätte, hätte Papi Tante Isi heiraten können.«
Andrea sah ihren Bruder erst verdutzt an. »Aber das kann er doch immer noch«, erwiderte sie dann begeistert.
»Wir müssen es ihnen bloß noch beibringen. Es wird uns schon was Gescheites einfallen«, überlegte Sascha. »Die Hauptsache ist ja, sie hat keinen anderen Mann.«