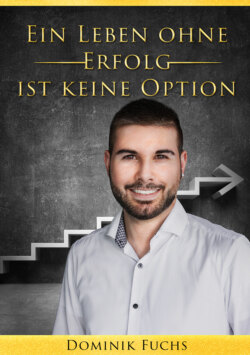Читать книгу Ein Leben ohne Erfolg ist keine Option - Dominik Fuchs - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3.2: Ebenen der Psychologie
Um die größten Ebenen auseinander halten zu können, werde ich in diesem Unterkapitel mehr auf die biologische Psychologie, statt der Psychologie im philosophischen Sinne eingehen. Der große Unterschied liegt darin, dass man in der Philosophie mehr auf die Seele und die Individualität der Menschen eingeht, während der biologische Teil sich eher mit den Auswirkungen von Nervenzellen auf das Gehirn und deren Verhaltensmustern auseinandersetzt. Auf die philosophische Psychologie gehe ich später in den anderen Unterkapiteln ein, da auch diese wichtig für deinen Erfolg ist.
Du wirst nach diesem Kapitel sicher keine Prüfung für ein Psychologie Studium ablegen können, aber nachvollziehen zu können, warum es so wichtig ist, deine eigene Psyche unter Kontrolle zu haben und rational zu denken, sollte hilfreich sein. Daher werde ich dir auch die Schritte beibringen, wie du durch Steuerung deines eigenen Denkens das Handeln der Zukunft bestimmen kannst.
Aus diesem Grund ziehen wir das erstmals 1923 erwähnte Strukturmodell der Psyche von Sigmund Freud heran. Dieses besteht aus drei großen Instanzen mit unterschiedlichen Funktionen und wird deshalb auch Drei-Instanzen-Modell genannt. Egal um welche Art Mensch es sich nun handelt, jeder von Ihnen besitzt eine Psyche, die sich aus diesen drei Teilen zusammensetzt. Um selbstentscheidend handeln zu können, musst du jeden dieser Teile kennenlernen und versuchen eine gesunde Balance zu finden sowie unnötige Konflikte derer zu vermeiden.
Das Es
Diese Struktur stellt den unbewussten Anteil dar, der die Bedürfnisse und Triebe umfasst. Dieser Teil besteht von Geburt an und ist ein Verlangen nach sofortiger Befriedigung. Ein solcher Trieb ist zum Beispiel das Gefühl des Hungers. Bekommt ein Kleinkind nicht sofort etwas zu essen, fängt es an zu weinen und hört erst wieder auf, wenn der Hunger gestillt ist.
Das Es funktioniert nach dem Lustprinzip und interessiert sich nicht für gesellschaftliche Normen. Ein Teil deiner Persönlichkeit wird immer von diesem gesteuert und kann auch nicht komplett unterdrückt werden.
Das Über-Ich
Das Über-Ich ist das genaue Gegenteil vom Es. Hier werden die moralische Instanz und die Werte der Gesellschaft vertreten. Die Normen werden teilweise bewusst und unterbewusst wahrgenommen.
Das Ich
Die Ich-Struktur stellt die genaue Mitte zwischen dem Es und Über-Ich dar. Sie wird benötigt, um Triebe zu zügeln und die Moral entsprechend anzupassen. Diese Struktur bildet sich erst im Kindesalter aus und besteht dementsprechend auch nicht instinktiv von Anfang an.
Wie du vermutlich herauslesen konntest, ist es also wichtig, die Ich-Struktur entsprechend auszubilden, um deine eigene Mitte zwischen dem Über-Ich und dem Es zu finden.
Da das Es teilweise unterbewusst handelt, ist es natürlich von Vorteil, zu wissen, was Bewusstsein überhaupt ist. Dieses Bewusstsein wird im Strukturen-Modell der Psyche von Freud auch wieder in drei Ebenen unterteilt. Hier muss aber auch wieder ein klarer Schnitt zwischen dem Bewusstsein und der Wahrnehmung gemacht werden.
Daher komplementiere ich nun zuerst Freuds Modell und gehe im Nachgang auf die Wahrnehmung ein, die wiederum in zwei Teile aufgegliedert werden kann. Ich spreche es nur bereits an dieser Stelle an, da in der folgenden Erläuterung der Bewusstseinsebene die Wahrnehmung von Gedanken und Sinnesgefühlen eine Rolle spielt.
Das Unbewusste
Das Unbewusste, oder auch Unterbewusstsein genannt, umfasst deine nicht aktiv steuerbaren Gedanken und Handlungen, die von deinem Körper autonom abgerufen und verarbeitet werden. Oft sind in diesem Bereich auch die verdrängten und unangenehmen Erinnerungen oder nicht erlaubte Triebwünsche zu finden, die deine Persönlichkeit prägen und dich daran hindern, deine Ziele zu erreichen.
Unbewusste Erlebnisse und Erfahrungen können aber selbst bei größter Anstrengung nicht ohne psychologische Hilfsmittel abgerufen werden. Ein solches Hilfsmittel wäre hier die bereits angesprochene Psychoanalyse oder Hypnose.
Das Bewusste
Laut Freud ist das Bewusste die Oberfläche des seelischen Apparats. Hier wird das im Moment bewusste Erleben verarbeitet. Darunter fallen alle augenblicklichen Zustände wie Gedanken, Vorstellungen, Wahrnehmungen und Gefühle. In dieser Ebene kann nach Belieben etwas in den Fokus oder zur Seite gerückt werden.
Das Vorbewusste
Das Vorbewusste steht zwischen der unbewussten und der bewussten Ebene. Hier liegen alle Inhalte und psychischen Vorgänge, die zwar grundsätzlich bewusstseinsfähig wären, es zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sind. Eine Bewusstwerdung ist aber durch Richtung deiner Aufmerksamkeit darauf durch die oben genannten psychischen Hilfsmittel möglich.
Im Vorbewussten kommt auch erstmalig das Realitätsprinzip hinzu. Dieses sorgt dafür, dass deine bildhaften Fantasien nun auch eine Logik beinhalten und in eine artikulierbare Vorstellung umgewandelt werden können.
Deiner einst unbewussten Vorstellung, die in das Vorbewusste übergangen ist, folgt nun ein Abgleich deines Gewissens, deiner Vernunft und der äußeren Verhältnisse. Das Ergebnis wird entsprechend an die Realität angepasst. Ein Übergang von dieser Ebene in die bewusste ist um einiges durchlässiger, als von der unbewussten Ebene in das Vorbewusste.
Wie bereits angekündigt, gehen ich an dieser Stelle von dem Bewusstsein in die Wahrnehmung über. Dazu verwende ich ein Denkmodell zum Thema Bewusstsein von Vera F. Birkenbihl, das auf wissenschaftlichen Daten basiert.
Vera war eine wirklich großartige Management-Trainerin und Sachbuchautorin, die zum Thema Psychologie und Erfolg einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Die Kerninformation ihres Modells besagt, dass, wenn wir alle Sinnesorgane zusammen nehmen und deren gleichzeitige Wahrnehmung betrachten, eine Bandbreite entsteht, die in einer Strecke berechnet folgende Daten ergibt: Während die bewusste Wahrnehmung gerade einmal 15 Millimeter beträgt, liegt die unbewusste Wahrnehmung bei einer Strecke von 11 Kilometern. Die Wissenschaft spricht auch von ungefähr 15.000.000 Bits unbewusster Wahrnehmung und 60 Bits bewusster Wahrnehmung pro Sekunde, die verarbeitet werden können.
Als ich diese Zahlen das erste Mal las, war ich sichtlich geschockt und erstaunt darüber, in welcher Lage das menschliche Gehirn ist. Diese Daten lassen einen erst klar darüber werden, wie eine so wegweisende Prägung zustande kommen kann, ohne den empfangenen Informationen wirkliche Beachtung zu schenken.
Nachfolgend werde ich die zwei Wahrnehmungen noch etwas genauer definieren. Zudem gehe ich noch auf die Bewusstseinsfilter, also deine selektive Wahrnehmung, ein, um dir zusätzlich aufzuzeigen, warum es nicht nur so wichtig ist, was du denkst, sondern auch wie du deine Informationen erhältst und verarbeitest.
Bewusste Wahrnehmung
In einer Kurzfassung könnte man sagen, dass die bewusste Wahrnehmung sich aus den Sinnesorganen und deren erhaltenen Informationen zusammensetzt. Alles was du zum aktuellen Zeitpunkt durch Reize erlebst, wird als Information an dein Gehirn übertragen und aktiv wahrgenommen. Bis hierhin ist alles identisch mit Freuds Modell.
Während er die Wahrnehmungsebenen aber mehr als Stufen-modell beschreibt, werden in Veras Modell eher die Übergänge, Handlungen und die Zusammenarbeit derer angesprochen. Nimmst du also nun etwas aktiv wahr, wird auch gleichzeitig auf dein Unterbewusstes zugegriffen, um eventuell vorhandene Erfahrungen abzugleichen. Genau ab diesem Zeitpunkt ist es auch schon vorbei mit der bewussten Wahrnehmung. Ab hier werden nun deine massig vorhandenen Erinnerungen abgefragt und deine folgende Handlung an die alten Erfahrungen angepasst.
Zusammengefasst ist die bewusste Wahrnehmung der kurze Zeitpunkt zwischen dem Geschehnis selbst und der Aufnahme durch die verschiedenen Sinnesorgane. Alles andere läuft passiv beziehungsweise unterbewusst ab und passt sich an vergangene Erfahrungswerte an. Du greifst also auf deine Schubladen zu und kramst deine alten Handlungen und Erfahrungswerte aus, die dir meistens keinen Vorteil verschaffen, wenn sie bisher nicht richtig geordnet und aufgeräumt wurden.
Unterbewusste Wahrnehmung
Da das Unterbewusste von verschiedenen Forschern jeweils unterschiedlich betrachtet und definiert wird, möchte ich nachfolgend festlegen, auf welche Eckpunkte ich mich hierbei explizit beziehe. Wenn ich also nun die unterbewusste Wahrnehmung erwähne, gehe ich lediglich auf die psychologisch ablaufenden Handlungen und Emotionen, die oft als Bauchgefühl oder Intuition betitelt werden, ein. Eine Erläuterung über Nervenenden und deren Wirkungsweise auf die einzelnen Reize lasse ich an dieser Stelle komplett außen vor.
Die unterbewusste Wahrnehmung ist also das genaue Gegenteil der aktiven Wahrnehmung. Diese wird nicht durch die Sinnesogane oder Reize wahrgenommen, sondern von Erfahrungswerten gesteuert.
In Veras Denkmodell wurde zu diesen Erfahrungswerten ein Thema namens »Katakomben des Wissens« vorgestellt. Dieses sagt im Groben aus, dass das menschliche Gehirn aus mehreren Schubladen besteht, die durch die Häufigkeit der Nutzung entweder dauerhaft aktiviert oder sehr oft komplett verschlossen bleiben.
Sendet also nun die aktive Wahrnehmung einen Sinnesreiz oder eine Information, greift die unterbewusste Wahrnehmung auf deine Schubladen zu. Wurde diese häufig verwendet, geht dein Gehirn davon aus, dass diese Schublade eher von Vorteil für dich ist, als eine die selten oder nie verwendet wird. Da kann es natürlich nur von Vorteil sein, wenn deine Schublade auf Erfolg statt Misserfolg und Pessimismus ausgelegt ist. Wie du aber sehen kannst, geht einer bewussten Handlung oder Entscheidung immer eine unbewusste Entscheidung voraus.
Selektive Wahrnehmung
Das Gute an den Schubladen ist aber, dass diese immer weiter bestärkt werden, wenn sie richtig angewendet werden. Bei schlechter Handhabung wirkt sich diese Bestärkung aber eher negativ aus.
Es entwickeln sich Bewusstseinsfilter, die deine selektive Wahrnehmung zum Negativen verfälschen. Dein Gehirn besitzt nämlich die Fähigkeit, Muster zu erkennen und für dich unnötige Informationen zu filtern. Dies ist bei der Menge an Informationen, die du zu dir nimmst, auch notwendig. Es kann ein wahrhafter Vorteil für dich sein, wenn du die richtigen Gedanken pflegst und deine Schubladen regelmäßig aufräumst.
Setzt du dich jedoch regelmäßig mit schlechten Erfahrungen und Denkmustern auseinander, wird dein Gehirn dir auch immer genau diese herausfiltern!
Zur Vereinfachung werde ich solch eine Selektion anhand einer Situation beschreiben, die du bestimmt schon einmal erlebt hast: Du kaufst dir etwas für dich Einzigartiges, egal ob das eine neue Tasche, ein Auto oder vielleicht sogar ein Kinderwagen ist. Plötzlich siehst du dieses Exemplar, das vor dem Kauf für dich einzigartig war und du dir sicher warst, dass es außer dir keiner besitzt, an jeder Ecke. Schuld daran ist dein Fokus, den du komplett darauf richtest. Hierdurch entwickelt dein Gehirn einen neuen Filter, der dich schlagartig Sachen wahrnehmen lässt, die für dich vorher nicht existierten. Dir wird also umgangssprachlich die rosarote Brille aufgesetzt. Natürlich wirkt das Ganze nicht nur bei materiellen Dingen, sondern auch bei Vorurteilen, Emotionen, diverser Abläufe und so weiter.
Kapitel 3.3: Kognitive Entwicklung
Der bisherige Lernstatus hat sich ausschließlich auf die Zusammen-setzung der Psyche und einer Methode zur Beschäftigung mit ihr beschränkt. Um das Ganze etwas praktischer darzustellen, ziehe ich hierfür das Stufenmodell zur kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hinzu. Die Theorie der kognitiven Entwicklung stammt vom schweizerischen Biologen und Entwicklungsforscher Jean Piaget und ist bis heute einer der bekanntesten Modelle.
Das Nachfolgende klingt im ersten Moment ähnlich wie das Modell von Erikson. Während Erikson jedoch eher auf die psychosoziale Ebene, also den Umgang mit anderen und dem eigenen Selbstbild in der Welt, eingeht, setzt sich Piaget mit diversen Denkschemata und deren Entwicklung auseinander. Viele der später genannten Entwicklungsstadien decken sich auch mit der psychosexuellen Theorie von Freud. Da die ganzen Theorien und Modelle im Endeffekt trotz allem nicht identisch sind, hat sich dieses Modell ihre Daseinsberechtigung in diesem Buch mehr als verdient.
Das Ergebnis der Entwicklung eines Kindes entsteht laut Piaget aus Interaktionen zwischen dem Kind und der Welt. Seiner Meinung nach kann ein Kind sich nur durch Auseinandersetzungen mit der Umwelt und nicht durch bloße Wissensvermittlung entwickeln. Primär steht das Lernen von immer komplizierteren und konkreteren Denkschemata im Vordergrund.
Während Neugeborene jedoch nur über sehr wenige Denkschemata verfügen, werden diese im Laufe der frühkindlichen Entwicklung schlagartig vermehrt. Diese Vermehrung erfolgt ganz einfach über Adaption und Organisation.
Die Organisation ist in diesem Fall nur das Zusammensetzen bestehender Denkschemata zu größeren und komplexeren Schemata. Die sogenannte Assimilation sorgt dafür, dass vorhandene Schemata und Strukturen an das eigene Vorgehen angepasst werden, wenn bereits ähnliche Erfahrungen vorliegen. Das Gegenteil ist die Akkommodation, also die Erweiterung dieser Schemata, wenn die Erfahrungen noch nicht ausreichend vorhanden sind. Ein Kind strebt immer ein Gleichgewicht zwischen einer Assimilation und Akkommodation an, dies wird auch Äquilibrium genannt.
Ein gutes Beispiel an dieser Stelle ist ein Kleinkind, das etwas trinken möchte. In einem bereits adaptierten Schema ist das Kind in der Lage, eine Tasse zu greifen und im anderen aus einer zu trinken. Aus der Organisation heraus resultiert, dass das Kind die Tasse in die Hand nimmt und daraus trinkt.
Laut Piaget stehen Assimilation und Akkommodation im Gegensatz zueinander, sind aber beide unverzichtbar für die kognitive Entwicklung. Da sich die Umwelt regelmäßig ändert und wir uns entsprechend an die Umwelt anpassen, solltest du die Akkommodation und Adaption neuer Schemata niemals vernachlässigen.
Da ein Kind sich nur durch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt aktiv entwickeln kann, ist eine Förderung und Anregung des Kindes für dessen Entwicklung von enormer Bedeutung. Obwohl der Drang zur Entwicklung laut Piaget vom Kind selbst kommt, ist es wichtig, eine möglichst konstruktive Umgebung zu schaffen, um sich mit der Umwelt auszutauschen.
Anknüpfend an das Stufenmodell von Piaget erläutere ich nun die einzelnen Entwicklungsphasen, die immer fließend ineinander verlaufen etwas näher.
Sensomotorische Phase (bis zum 2. Lebensjahr)
In den ersten beiden Lebensjahren sammelst du hauptsächlich Erfahrungen und lernst durch das Beobachten und Wahrnehmen. Im Mittelpunkt steht einzig und allein die Wahrnehmung von Objekten und was mit diesen gemacht werden kann. Du erkundest die Welt am Anfang noch mit deinen Sinnen und Bewegungen, in der Fachsprache wird das Ganze sensomotorisch genannt. Deine Intelligenz tritt zu diesem Zeitpunkt nur in Form von Reaktionen auf sensorische Reize sowie als motorische Aktivität in Erscheinung.
In der sensomotorischen Phase finden entscheidende Prozesse statt, die deine gesamte Grundlage der kognitiven Entwicklung ausmacht.
Als Neugeborenes übst du zuerst ausschließlich durch angeborene Reflexe. Danach geht es in die Phase über, in der Gegenstände ertastet, gegriffen und in den Mund genommen werden. Freud benennt diesen Lebensabschnitt in seinen Modellen sinngemäß die »orale« Phase.
Kurz darauf stellst du fest, dass Handlungen existieren. Du realisierst also nun, dass, wenn du etwas Bestimmtes tust, auch etwas Bestimmtes daraus resultiert. Zuerst passiert das rein zufällig. Mit der Zeit nimmst du aber aktiv Einfluss auf deine Umwelt.
Ungefähr ab dem achten Monat erkennst du, dass Dinge, auch wenn sie zurzeit nicht präsent sind, trotzdem vorhanden sind. In den darauffolgenden Monaten werden bereits bekannte Handlungen in fremden und neuen Situationen ausprobiert.
Ab dem ersten Lebensjahr werden bereits Experimente durchgeführt, also die Handlungen werden in abgewandelter Form erneut ausprobiert und legen somit neue Schemata an.
Zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat bist du schon in der Lage, eine Handlung nachzuvollziehen und vorherzusagen. Ebenso ist eine gedankliche Auseinandersetzung mit einem Objekt, auch wenn es gerade nicht präsent ist, möglich.
Präoperationale Phase (2. bis 7. Lebensjahr)
Du lernst erstmalig durch Symbole, allen voran die menschliche Sprache, um mit deiner Umwelt zu kommunizieren und diese zu beeinflussen. Das bringt den Vorteil mit sich, dass du nicht zwingend nach etwas greifen musst, sondern auch darum bitten kannst. Das Objekt muss hierfür auch nicht unbedingt anwesend oder präsent sein. Trotz allem überwiegt in dieser Phase immer noch die sinnliche Wahrnehmung.
Konkretoperationale Phase (7. bis 12. Lebensjahr)
Hier entwickelt sich das logische und rationale Denken, jedoch stehen anschauliche Objekte immer noch im Vordergrund. Ebenso bist du erstmalig in der Lage, mehrere Gedanken- und Handlungsprozesse gleichzeitig zu erfassen und in Verbindung zu bringen. Ein vorausschauendes Denken und das Reflektieren deines eigenen Handels sind ab diesem Zeitpunkt möglich. Ein abstraktes Denken fällt dir aber immer noch sehr schwer. Zudem entstehen erste Wertehierarchien. Dies bedeutet, dass du deine Werte nach Wichtigkeit sortierst und priorisierst.
Formaloperative Phase (12. bis 15. Lebensjahr)
Nicht nur das abstrakte Denken, sondern hypothetisches Denken sowie Gedankenspiele sind ab sofort möglich. Dinge werden analysiert und von allen erdenklichen Seiten beleuchtet. Nun löst du dich auch endgültig von reiner Wahrnehmung der Objekte und Situationen. Es steht also nicht mehr das Handeln, sondern das Denken selbst im Mittelpunkt.