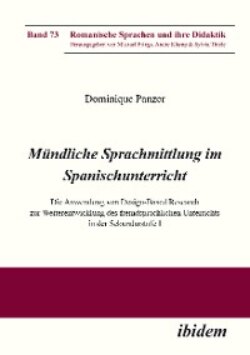Читать книгу Mündliche Sprachmittlung im Spanischunterricht - Dominique Panzer - Страница 11
Translationswissenschaft
ОглавлениеZunächst scheint ein Blick in die Translationswissenschaft unerlässlich, da sich auch innerhalb dieser Disziplin der Terminus ‚Sprachmittlung‘ finden lässt und zudem weitere Konzepte wie das der ‚Adäquatheit‘ aufschlussreich erscheinen. Begrifflich sind ‚Translation‘ und ‚Übersetzung‘ synonymisch zu verwenden, so dass unter Translationswissenschaft die Wissenschaft der Übersetzung zu verstehen ist (vgl. Prunč 2012: 15).
Bereits im Jahr 1940 finden sich in der Translationswissenschaft erste Ansätze, die sich mit den Themen ‚Übersetzung‘, ‚Dolmetschen‘ und ‚Sprachmitteln‘ auseinandersetzen, auch wenn dabei zunächst nur der Begriff des ‚Sprachmittlers‘ durch den deutschen Otto Monien (1940) besetzt wurde. Innerhalb der Reichsfachschaft für das Dolmetscherwesen stand dieser Oberbegriff für Personen, die dolmetschen, übersetzen oder sprachkundig sind und galt als Versuch, die bisherigen uneinheitlichen Begriffe durch einen neuen zu ersetzen.
„So müssen wir eine Neuschöpfung bekanntgeben. Gibt nicht der Ausdruck ‘Sprachmittler‘ all die Werte wieder, die in den alten, unzulänglichen Bezeichnungen enthalten sind? […] Dolmetscher – Übersetzter – Sprachkundiger, sie alle sind ‘mittelnde‘ Glieder zwischen verschiedenen Sprachen, sie sind alle ‘Sprachmittler‘.“ (Monien 1940: 1f., zitiert nach Salevsky 1992: 111f.; Hervorhebungen im Original).
Dieses subsummierende Verständnis wurde ab 1960 in der DDR durch die sogenannte Leipziger Schule genauer expliziert, wobei Kade (1968) als deren Begründer zunächst den Begriff der ‚Translation‘ als Hyperonym für die Tätigkeit des Übersetzens wie auch des Dolmetschens verstand (vgl. Prunč 2012: 15f.). ‚Sprachmittlung‘ wurde später von Jäger (1975: 30ff.) weiter untergliedert in eine ‚kommunikativ äquivalente Sprachmittlung‘ und eine ‚kommunikativ heterovalente Sprachmittlung‘. Unter ersterer verstand er die Übersetzung im eigentlichen Sinn bzw. die wörtliche Übersetzung laut Reimann (2013b), die dann im Weiteren auch als Translation bezeichnet wurde. Der entscheidende Aspekt ist hier der kommunikative Wert des ursprünglichen Ausgangstextes, der im zu erstellenden Zieltext erhalten bleibt. Letztere Form der Sprachmittlung beschrieb Jäger (1975) auch als textbearbeitende Wiedergabe oder, mit den Worten von Reimann (2013b), als inhaltsbearbeitende Übertragung, bei der der ursprüngliche Ausgangstext verändert wird beispielsweise durch Kürzungen, Umformungen oder Erweiterungen und dadurch der kommunikative Wert im Zieltext nicht mehr vorhanden ist (vgl. ebd.: 6; Koller 2011: 203).
In diesem Kontext entsteht auch die Frage nach den zentralen Begriffen der ‚Invariante‘, ‚Äquivalenz‘ und der ‚Adäquatheit‘, die ebenfalls eng mit der Translationswissenschaft in Verbindung stehen und wichtige Anhaltspunkte darstellen. Diese sind in unterschiedlichem Maß auch für Sprachmittlung bedeutsam, obwohl keine begriffliche Einheit vorhanden ist und sich zahlreiche Definitionsversuche finden, unter anderem bei Königs (1981) und Nida (1964). So beleuchten sie allgemein das Verhältnis von Ausgangs- und Zieltext bzw. die Veränderung des Textes im Übergang und argumentieren dabei sowohl auf deskriptiver wie auch auf präskriptiver Ebene (vgl. Kolb 2016: 107). Die vermeintlich synonyme Verwendung der Begriffe ‚Adäquatheit‘ und ‚Äquivalenz‘, wie sie Stolze (2011) vorschlägt, erscheint nicht sinnvoll, da bereits 1984 Reiß und Vermeer eine gelungenere Differenzierung vorlegen, die sich unter anderem auch bei Kolb (2016) und Prunč (2012) widerfinden lässt.
Reiß und Vermeer (1984) definieren diese beiden Konzepte wie folgt:
„Adäquatheit bei der Übersetzung eines Ausgangstextes (bzw. -elements) bezeichne die Relation zwischen Ziel- und Ausgangstext bei konsequenter Beachtung eines Zweckes (Skopos), den man mit dem Translationsprozeß[sic] verfolgt. […]
Äquivalenz bezeichne eine Relation zwischen einem Ziel- und einem Ausgangstext, die in der jeweiligen Kultur auf ranggleicher Ebene die gleiche kommunikative Funktion erfüllen (können).“ (ebd.: 139f.; Hervorhebungen im Original).
‚Invariante‘ als ein drittes Konzept, bei dem Elemente des Ausgangstextes unverändert in den Zieltext übertragen bzw. übernommen werden (vgl. Prunč 2012: 36; Schreiber 2001), ist für Sprachmittlung nur von geringer Bedeutung, da die Lernenden während der Übertragung den Text verändern und in diesen eingreifen. Ein unverändertes Übertragen bzw. Übernehmen von Inhalten kommt nur in den seltensten Fällen vor.
Bevor im Weiteren genauer auf die bereits angesprochene ‚Skopos-Theorie‘ eingegangen wird, soll zunächst das Konzept der ‚Äquivalenz‘ näher betrachtet werden, da davon ausgehend einige Aspekte auch auf die schulische Form der Sprachmittlung übertragen werden können.
Im deutschsprachigen Raum ist die von Koller (2011) im Rahmen seiner Einführung in die Übersetzungswissenschaft vorgelegte Differenzierung der ‚Äquivalenz‘ am einflussreichsten und soll exemplarisch wiedergegeben werden (vgl. Kolb 2016: 108). Er schlägt folgende fünfgliedrige Systematisierung vor (vgl. im Folgenden Koller 2011: 219, 230-269):
1 Denotative Äquivalenz: Die Orientierung der Übersetzung erfolgt an außersprachlichen Sachverhalten, die mit dem Text vermittelt werden. Für die beteiligten Sprachen müssen Äquivalenzen gefunden werden und deren Auswahlkriterien sind transparent, meist in Form von Kommentierungen, darzustellen.
2 Konnotative Äquivalenz: Die Konnotationen und Denotationen, die durch verschiedene Verbalisierungen Einfluss auf den Text haben, wie beispielsweise Dialekte, sollten auch bei größeren Schwierigkeiten anhand verschiedener Strategien in die Übersetzung mit einfließen.
3 Textnormative Äquivalenz: Für bestimmte Texte werden verschiedene Normen in Bezug auf Sprache und Text verwendet, die auch bei einer Übersetzung in die andere Sprache und den Text übertragen werden müssen.
4 Pragmatische Äquivalenz: der/die Leser/in oder Empfänger/in des Textes und sein/ihr jeweiliges Vorwissen sind für die Anfertigung der Übersetzung zu berücksichtigen; dabei stellt sich die Frage, in wie weit der/die Übersetzer/in dabei in den Text eingreifen darf.
5 Formal-ästhetische Äquivalenz: bestimmte Merkmale des Ausgangstextes hinsichtlich Ästhetik, Form und Individualität sollten mit Eingang in die Übersetzung finden, so dass ein möglichst analoger Text entsteht.
Die Frage der ‚Äquivalenz‘, die innerhalb der Translationswissenschaft vielfach diskutiert wird, hat auch Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht in der Schule. So stellt sich bei Übersetzungen immer die Frage, wie frei oder wie wörtlich der Text übersetzt werden darf bzw. muss, um nicht den Sinn zu verfälschen. Anfänglich wurden diese Überlegungen auch im Rahmen der Sprachmittlung diskutiert, die aber dann durch den Gedanken der ‚Skopos-Theorie‘ abgelöst wurde (vgl. Reimann 2013b: 6; Rössler 2008: 58).
Die von Reiß und Vermeer (1984) postulierte ‚Skopos-Theorie‘ rückt vor allem die Frage, ob die Übersetzung für eine bestimmte Person gut gelungen ist, in den Vordergrund. So muss nicht mehr nur die Übersetzung an sich für gut befunden werden, sondern die Person, für die sie angefertigt wurde, muss diese in einer bestimmten Situation auch verstehen: „Die Dominante aller Translation ist deren Zweck“ (ebd.: 96.). Demnach sind das Ziel bzw. der Zweck, im Griechischen ‚σκοπόσ‘, prioritär zu behandeln und nicht mehr nur der Ausgangstext (vgl. Reimann 2013b: 6; Hallet 1995: 298).
Gänzlich unbeachtet bleibt dieser Aspekt bei der von Knapp und Knapp-Potthoff (1985) vorgelegten Unterscheidung der Begriffe ‚Dolmetschen‘, ‚Übersetzen‘ und ‚Sprachmitteln‘. Die Autoren legen eine detaillierte Abgrenzung der Begriffe vor (vgl. auch Tabelle 2.1), auch wenn diese drei Aktivitäten dabei aber immer als „translatorische Tätigkeit“ (Knapp, Knapp-Potthoff 1985: 450) bezeichnet werden, da bei dieser Form der Textverarbeitung immer mindestens eine Sprache beteiligt ist. Darunter subsummieren sie auch noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das mündliche Übertragen von schriftlichen Informationen in eine andere Sprache, die hier aber nicht weiter von Relevanz sind.
| Tätigkeit Charakteristikum | Dolmetschen | Sprach- mittlung | Übersetzen | |
| Repräsentationsform des Textes | graphisch | --- | --- | X |
| phonisch | X | X | --- | |
| Face-to-face Interaktion | (X) | X | (X) | |
| Eigenständige/r Kommunikationspartner/in | --- | (X) | --- | |
| Eigene Mitteilungsintention | --- | (X) | --- | |
| Professionelle Tätigkeit | X | --- | X | |
| Alltägliche Tätigkeit | --- | X | --- |
Tabelle 2.1: Unterscheidung Dolmetschen - Übersetzen - Sprachmittlung (nach Knapp, Knapp-Potthoff 1985: 451)
Legende: X = Aspekt lässt sich in der Tätigkeit wiederfinden; (X) = Aspekt lässt sich nur in Ansätzen in der Tätigkeit wiederfinden; --- = zu diesem Aspekt werden keine Aussagen gemacht
Hier können sowohl zwischen ‚Sprachmittlung‘ und ‚Übersetzen‘ wie auch zwischen ‚Sprachmittlung‘ und ‚Dolmetschen‘ Parallelen gezogen werden, so dass eine strikte Abgrenzung voneinander weder sinnvoll noch möglich erscheint, denn auch Knapp und Knapp-Potthoff (1985) selbst geben an, dass die Unterschiede nur gradueller Natur sind (vgl. ebd.: 452; Wieland 2016). Aus heutiger Sicht scheint vor allem die Tatsache fraglich bzw. nicht mehr haltbar, dass Sprachmittlung ausschließlich an phonisch repräsentierte Texte gebunden sei, denn im GeR wie auch in den anderen bildungspolitischen Vorgaben wird zum Teil immer explizit auf die schriftliche und mündliche Form der Sprachmittlung hingewiesen (vgl. dazu Teilkapitel 2.2).
Charakteristisch für Sprachmittlung ist, dass der/die Mittler/in zumindest teilweise als eigenständige/r Kommunikationspartner/in auftritt und dabei auch eine eigene Mitteilungsintention haben kann. Diese, in zumindest begrenztem Umfang, aktive Rolle ist gerade im Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung und sollte auch dementsprechend produktiv genutzt werden, denn dadurch, dass die Position nicht festgelegt ist, können die Lernenden in einen möglichen Aushandlungs-prozess eintreten (vgl. Teilkapitel 2.2.2). Definiert wird Sprachmittlung als eine Übertragung von mündlichen Texten, die ausschließlich in einer persönlichen vis-à-vis-Interaktion stattfindet. Das Besondere an dieser Tätigkeit ist, dass sie nicht-professionell ist, sondern einen Teil der alltäglichen Kommunikation darstellt und die Beteiligten dadurch, wie bereits erwähnt, aktiv in den Gesprächsverlauf eingreifen können, indem sie Nachfragen stellen, um Missverständnisse zu beseitigen oder aber den Gesprächsverlauf zu steuern. Der sprachmittelnden Person kommt so eine entscheidende Rolle zu, da er/sie gleichzeitig übermittelt und vermittelt und somit vor besondere Herausforderungen gestellt wird (vgl. Knapp, Knapp-Potthoff 1985: 451f.).
Besonders deutlich wird dies an folgendem Beispiel des Satzes ¿Alguna vez has estado aquí antes? der in einer Übersetzung mit den Worten Sind Sie schon einmal hier gewesen? wiedergeben werden könnte; in einer Sprachmittlungssituation aber als Er/Sie fragt, ob Sie schon mal hier gewesen sind? paraphrasiert wird (in Anlehnung an ebd.: 451).