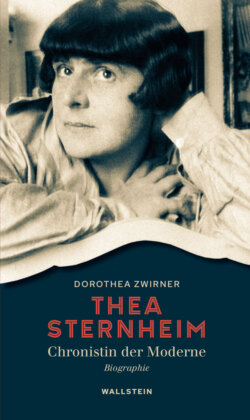Читать книгу Thea Sternheim - Chronistin der Moderne - Dorothea Zwirner - Страница 6
I. Kindheit, Jugend und erste Ehe (1883 – 1906) Großbürgerliche Kindheit im Rheinland (1883–1896)
»Anarchie und Frommsein«
ОглавлениеAls Thea das Licht der Welt erblickt, beginnt es gerade zu dämmern. Das Sonntagskind Olga Maria Theresia Gustava Bauer wird am 25. November 1883 im Haus ihrer Eltern in der Crefelder Straße G 176 in Neuss um halb vier Uhr nachmittags geboren.[1] Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der dem Andenken an die Verstorbenen gilt. Kirchenglocken und Totenklage bilden den Wechselklang aus Gottvertrauen und Schwermut, der ihr schon an der Wiege gesungen wird.
Im Rückblick sieht Thea Sternheim ihren Lebensbeginn im Zeichen dieser unheilvollen Konstellation, der sie sich jedoch schreibend entgegenzusetzen weiß. Es ist der Wille zur Feststellung, der unbedingte Ausdruckswille eines literarischen Naturells, der ihren Lebensweg prägen, gestalten und sublimieren wird. Im Spannungsfeld zwischen Leben und Schreiben entsteht mit ihrem Tagebuch eine minutiöse Chronik, die dem Leben dokumentierend, kommentierend und reflektierend gegenübersteht, ein buchstäbliches Lebenswerk, das sie von ihrem zweiundzwanzigsten Lebensjahr bis kurz vor ihrem Tod fast täglich führen wird. Entsprechend wissen wir über die Zeit ihrer Kindheit und Jugend nur aus den rückblickenden Aufzeichnungen und vor allem aus ihren autobiographischen Erinnerungen, mit denen sie 1936 im Alter von 53 Jahren begonnen hat.[2] Sosehr sich Thea Sternheim zeitlebens um größtmögliche Aufrichtigkeit bemüht hat und ihre Erinnerungen mit den »authentischen« Eintragungen ihres Tagebuchs zu belegen sucht, so sehr bleibt ihre wie jede Erinnerung subjektiv und selektiv und birgt bereits die Perspektive rückblickender Deutung. Im steten Zwiegespräch zwischen Leben und Schreiben gilt es, zwischen der Realität und dem Roman ihres Lebens zu unterscheiden.
Der Schatten, den Thea über ihrer Geburtsstunde liegen sieht, entspricht jedenfalls nicht den wohlhabenden Verhältnissen, in die sie hineingeboren wird. Ihr Vater, Georg Bauer, ist als Mitinhaber der Rheinischen Schrauben- und Mutternfabrik »Bauer und Schaurte« ein erfolgreicher Unternehmer. Mit 24 Jahren hat er 1874 seine Firma im linksrheinischen Neuss gegründet, das durch den Ausbau des Hafens gerade im Begriff ist, sich von einer Agrar- zu einer Industriestadt zu entwickeln.[3] Damit ist der Grundstein zu einer erfolgreichen Firmengeschichte gelegt, die mit der Erfindung von Mutter und Schraube und dem späteren Patent für den Innensechskantschlüssel »Inbus« über hundert Jahre unter demselben Namen weiter betrieben wird. Schon nach wenigen Jahren ist das Unternehmen mit über 400 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber der Stadt.[4] Im Jahr der Firmengründung kann es sich der Jungunternehmer bereits leisten, die 22-jährige Ingenieurstochter Agnes Schwaben zu heiraten. Diese ist wie er katholisch und stammt ebenfalls aus zwar wohlhabenden, aber unglücklichen Familienverhältnissen. Ihre Eltern haben viele Jahre im englischen und russischen Ausland gelebt, bis ihr Vater, Carl Wilhelm Schwaben, seine Frau mit fünf Kindern wegen einer polnischen Sängerin verließ. Verluste in russischen Werten ließen das Vermögen von Großmutter Schwaben, wie Thea ihre Großmutter mütterlicherseits nannte, zusammenschrumpfen. Das Unglück der Großmutter setzte sich in der nächsten Generation fort. Von den fünf Kindern gelang es nur Theas Mutter Agnes sich standesgemäß, wenn auch glücklos, zu verheiraten, während ihre beiden Schwestern Carola und Hedwig sich von ihren Männern trennten.
Ein Jahr nach der Hochzeit von Georg Bauer und Agnes Schwaben wird 1875 der erste Sohn, Richard, geboren, drei Jahre später der zweite Sohn, Theodor. Nach den beiden älteren Brüdern ist Thea das dritte und letzte Kind ihrer Eltern. Als einzige Tochter und jüngstes Kind nimmt sie unter den Geschwistern zwar eine gewisse Vorzugsstellung beim Vater ein, empfindet sich aber als weibliches Wesen ihren Brüdern gegenüber als minderwertig. Insbesondere von dem als Lieblingssohn der Mutter verehrten Theo fühlt sie sich als »Göre« und »Tränendose« zurückgewiesen, so dass keine besonders enge Geschwisterbindung entsteht.[5]
Zum Haushalt der fünfköpfigen Fabrikantenfamilie gehört fast ebenso viel Personal, um den aufwendigen und repräsentativen Lebensstil zu gewährleisten. Für die neugeborene Thea wird ein Kindermädchen engagiert, das mit dem Säugling im selben Zimmer schläft und nacheinander durch das zarte Fräulein Blaßneck als Betreuerin und die klatschsüchtige Hulda Kunze als Erzieherin abgelöst wird. Die Jungfer Helene steht der Hausherrin als Kammerzofe zur Seite, der Diener Heinrich dem Hausherrn, und die Köchin Anna Winter versieht über dreißig Jahre lang die Küche. Befinden sich die Kinder in der Obhut von Kinderfrauen und Hauslehrern, so vergeht für die Eltern kein Tag ohne Gäste. Diners, Pferderennen, Jagden, Theater und Reisen sind an der Tagesordnung. Auch wenn das distanzierte Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern keine Ausnahme im großbürgerlichen Milieu der Zeit bildet, empfindet Thea ihre Kindheit als einsam. In der frühkindlichen Erinnerung erscheint der Vater als furchteinflößende, dominante und maßregelnde Autorität, die Mutter dagegen seltsam blass.
In Theas fünftem Lebensjahr zieht die Familie 1888 von Neuss nach Köln in das eigens von ihrem Onkel Hubert, dem jüngeren Bruder ihres Vaters, errichtete Haus am Hansaring 53. Der seit den 1880er Jahren an der Stelle der alten Stadtmauer errichtete Prachtboulevard gilt als erste Adresse der expandierenden Rheinmetropole. Das vierstöckige herrschaftliche Haus wird mit viel Dekor und historisierenden Stilelementen im Geschmack der Gründerzeit erbaut, über den sich Thea rückblickend als »Plüsch« mokiert. Der repräsentative Zuschnitt der unteren Geschosse gipfelt in einer steilen Marmortreppe, über deren Unbequemlichkeit Theas Mutter ständig zu klagen pflegt. Die Unzufriedenheit der Mutter hat indes tiefere Ursachen, die Thea erst später begreifen wird. Das Haus verfügt zudem über eine ausgedehnte Gartenanlage mit Springbrunnen, einen Pavillon mit Fremdenzimmern und Billarddiele sowie einen Stall mit Remise und Kutscherwohnung. Von Theas zum Garten gelegenem Spiel- und Schlafzimmer kann man die beiden Türme des Doms, einen Teil der römischen Stadtmauer und das städtische Gefängnis, den Klingelpütz, sehen.
Wie in den meisten bürgerlichen Familien des 19. Jahrhunderts sind auch bei den Eheleuten Bauer die Wirkungskreise von Mann und Frau weitgehend getrennt.[6] Während Agnes Bauer für die privaten Bereiche der Haushaltsführung und Familie zuständig ist, steht ihr Unternehmergatte viel stärker im öffentlichen Leben.[7] Täglich außer sonntags fährt er die dreißig Kilometer zur Fabrik nach Neuss und kommt zum Mittagessen um 14 Uhr nach Hause. Die Eisenbahnfahrt vom nahe gelegenen Centralbahnhof am Dom, dessen prachtvoller Neubau mit seinem riesigen Glasgewölbe über der zweigeschossigen Wartehalle gerade Gestalt annimmt, dauert keine halbe Stunde. Nach dem Mittagsschlaf trifft er sich mit Freunden und Kollegen im Weinrestaurant und kehrt erst zum Abendessen gegen 21 Uhr zurück. Die Mutter versieht mit Hilfe des Personals den Haushalt, organisiert die gesellschaftlichen Verpflichtungen und pflegt die familiären Kontakte.
Mindestens einmal wöchentlich fährt Thea mit ihrer Mutter über die Rheinbrücke nach Deutz, um ihre Großmutter Schwaben zu besuchen, die mit ihrer ledigen Schwester und ihrer geschiedenen Tochter Carola samt Enkeltochter Olga in einem reinen Frauenhaushalt zusammenlebt. Thea liebt diese Besuche in der Neuhöfferstraße bei ihrer warmherzigen und weitgereisten Großmutter und ihrer Linchen genannten Lieblingstante, wo es zwei Hunde, einen russisch sprechenden Papagei und köstlichen Kuchen gibt. Die liebevolle Atmosphäre des großmütterlichen Haushalts wird sich Jahre später zu einer tröstlichen Erinnerung verdichten:
»Nie hat mein Elternhaus einen ähnlichen Eindruck auf mich ausgeübt als das bescheidene Haus meiner Grossmutter mit seinen Weinstöcken, seinem Taubenschlag. Da spiegelte jedes Ding, jeder Raum die Würde ihres gütigen Herzens wider. Die beiden Hunde. Der Papagei.
Welch eine Wohltat war’s dem Kind aus den Misshelligkeiten des elterlichen Hauses kommend in diese Wohnung des Friedens zu treten. Pistazientorte und Blancmanger waren nur schwache Symbole für die sentimentalen Genüsse, die das Fühlbarwerden einer grossen Sympathie in mir auslöste.«[8]
Im Gegensatz dazu verabscheut Thea die Besuche bei ihrer erblindeten Großmutter Bauer auf dem Salierring, die ebenfalls mit ihrer geschiedenen Tochter Therese zusammenlebt und offenbar ihre Ablehnung der Schwiegertochter gegenüber auf ihre Enkeltochter übertragen hat. Ob verlassen, verwitwet, geschieden oder ledig, die starke Häufung alleinstehender Frauen prägt Theas unmittelbares familiäres Umfeld.
Mit sechs Jahren wird Thea 1889 in die Kuttenkeulersche Schule am Gereonsdriesch eingeschult zusammen mit ihrer gleichaltrigen Kusine Elisabeth Bauer, der Tochter ihres Architekten-Onkels Hubert, die zu ihrer täglichen Spielgefährtin wird. Die Schulausbildung der drei Geschwister Bauer verläuft dem Alter und Geschlecht entsprechend unterschiedlich. Während ihr ältester Bruder, Richard, beim Umzug nach Köln mit nur elf Jahren zunächst noch in der Obhut seines Privatlehrers in Neuss bleibt, besucht der mittlere Bruder, Theo, ein neusprachliches Kölner Realgymnasium. Im Unterschied zu den bereits weitgehend staatlich regulierten Jungenschulen steht die »private höhere Töchterschule Kuttenkeuler« zwar auch unter behördlicher Aufsicht, wird in ihrer pädagogischen Ausrichtung und Qualität aber von der jeweiligen Schulleitung und Zusammensetzung der Schülerinnen bestimmt.[9] In der Zeit von Theas Einschulung muss sich Johanna Kuttenkeuler immer wieder mit der Schulaufsicht auseinandersetzen, um das allgemeine Durcheinander nicht regulierter Lehrpläne und unterschiedlicher Bildungsvoraussetzungen in den Griff zu bekommen. Dabei mögen die sittlichen Werte wie Demut, Bescheidenheit, Gehorsam und Akzeptanz der gottgegebenen Unterschiede, die in der konfessionellen Standesschule neben den Bildungsinhalten vermittelt werden, bei Thea etwas zu kurz gekommen sein. Ohnehin entsprechen weder die preußischen noch die kirchlichen Tugenden Theas Naturell, die sich mit einem Aufsatz gegen die Kreuzzüge und einem Spottgedicht über einige Klassenkameradinnen schon bald den Ärger der Schulleitung zuzieht, woraufhin einigen Kindern der Umgang mit ihr wegen »ihres anarchischen Einflusses« verboten wird. Im späten Rückblick auf ihre Kölner Schulzeit hat Thea Sternheim als alte Frau ihr kindliches Wesen sehr treffend als eine Mischung aus »Anarchie und Frommsein«[10] charakterisiert.
Den Gegenpol zu ihrem anarchischen Wesen bildet eine bereits frühkindlich ausgeprägte Frömmigkeit, wie sie Thea von beiden Großmüttern vertraut ist, aber deutlich über den konventionellen Rahmen ihres katholischen Elternhauses hinausreicht. Während die Eltern nur gelegentlich zur Kirche gehen, wird Thea zu regelmäßigen Gottesdienstbesuchen angehalten. Auf Anregung von Fräulein Blaßneck errichtet Thea einen kleinen mit einem Marienbild, Kerzen und Blumen geschmückten Hausaltar in ihrem Zimmer. Die Bibel, Heiligenlegenden und Märtyrergeschichten gehören zusammen mit der griechischen Mythologie zu ihrer ersten Lieblingslektüre; die in einem Bastkörbchen verwahrten Heiligenbildchen bilden den Grundstock ihrer späteren Kunstbegeisterung und Sammelleidenschaft.
Die frühkindliche Phase bedingungsloser Frömmigkeit ist längst vorbei, als Thea mit zwölf Jahren zusammen mit ihrer Kusine Elisabeth zum Kommunionsunterricht kommt. Ihre ersten Glaubenszweifel sind mit einer unbedingten Aufrichtigkeit gepaart, die sie bei der Erstkommunion Übelkeit vortäuschen lässt, weil sie nicht an die Gegenwart Jesu im Altarsakrament glauben kann. Denn ihr Glaube gilt nicht dem göttlichen, sondern dem barmherzigen und sanftmütigen Jesus.
Zusätzlich wird ein Hauslehrer zur Beaufsichtigung nach den Schulstunden eingestellt. Thea zieht den Privatunterricht des Schriftstellers Hans Willy Mertens den regulären Schulstunden vor. Ihre Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten ist zumindest in den Wintermonaten ein guter Vorwand, um den Unterricht lieber zuhause zu absolvieren.[11] Daneben gehören Klavier-, Tanz- und Gesangsunterricht zum klassischen Repertoire für höhere Töchter. Musikalisch und sportlich eher unbegabt, verbringt Thea ihre Freizeit lieber mit Malen und Lesen.
Das Geschenk ihrer Lieblingstante Linchen, eine Sammlung von Reclam-Heften klassischer Dramen, regt sie zur Deklamation und bald auch zum Schreiben eigener Stücke an. Ein Puppentheater als Weihnachtsgeschenk wird zu ihrem Lieblingsspielzeug, mit dem sie die ersten Theater- und Opernaufführungen, die sie im Kölner Stadttheater gesehen hat, nachspielen kann. Mit dieser Neigung lernt Thea bei den Freundinnen ihrer Kommunionszeit, Isolde und Gudrun Wette, ein anregendes und neuartiges Milieu kennen. Der Vater, Hermann Wette, ist Schriftsteller und Ohrenarzt, die Mutter Adelheid Wette, geborene Humperdinck, die Schwester des bekannten Komponisten. In dem turbulenten Bohème-Haushalt am Hohenzollernring, in dem die Kinder eigene Theaterstücke zur Aufführung bringen, erlebt Thea eine sehr viel bescheidenere, aber auch ungezwungenere und familiärere Atmosphäre als im eigenen Elternhaus. Noch zwanzig Jahre später wird Thea einen Traum in ihr Tagebuch notieren, in dem sich ihre Begeisterung für das unbürgerliche und künstlerische Milieu der Familie Wette mit unbedingter Solidarität und ihrem ersten Aufbegehren gegen den Standesdünkel ihrer eigenen Familie verbindet:
»Die anderen haben vielleicht recht mir diesen Verkehr mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, zu untersagen; aber sie vergessen, dass ich aus einem höheren Beweggrund standhaft bleiben muss: Diese Treue, die in Überschwänglichkeit ausartet, ist mein erster Feldzug gegen das bürgerlich Herkömmliche, der erste Versuch, Fesseln, die mir durch Geburt und Erziehung auferlegt worden, zu sprengen.«[12]
Im Elternhaus am Hansaring verkehrt außer der weitverzweigten Verwandtschaft ein großer Freundeskreis, der vornehmlich aus militärischen und kaufmännischen Kreisen stammt. Die politische Gesinnung ist wenig spezifisch: Man feiert mit Bismarcks Geburtstag die Reichsgründung und teilt einen latenten Antisemitismus, der jedoch die Lektüre von Heinrich Heine und Ludwig Börne keineswegs ausschließt. Zum Freundeskreis gehört auch der Firmen-Mitinhaber Christian Schaurte, dessen junge Frau Hedwig für Thea zum weiblichen Idealbild ihrer schwärmerischen Veranlagung wird. Die jugendliche und lebenslustige Hedwig, altersmäßig zwischen Thea und der Elterngeneration, lässt sich die kindliche Schwärmerei gerne gefallen. Als Tochter des Schriftstellers, Journalisten und Theaterleiters Paul Lindau verkörpert sie einen mondänen Frauentypus, der anders als Theas Mutter die verehrte und verwöhnte Ehefrau repräsentiert. Agnes Bauer muss dagegen die undankbare Rolle der unzufriedenen Ehefrau übernehmen, die der Untreue ihres Ehemanns wenig mehr als Rückzug, Verbitterung und Krankheit entgegenzusetzen hat. Auch wenn es in Deutschland, insbesondere in Preußen schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts, ein relativ liberales Scheidungsrecht und entsprechend bereits vor 1900 eine relativ hohe Scheidungsrate gab,[13] mögen die Erfahrungen, sicherlich aber das gute Zureden ihrer geschiedenen Schwestern, sie von dieser letzten Konsequenz abgehalten haben. Stattdessen wird die treulose Jungfer Helene entlassen, ebenso wie Theas Kinderfräulein Blaßneck, die das außereheliche Verhältnis entdeckt hat, während Agnes’ jüngste Schwester zur Stimmungsaufbesserung mit ins Haus zieht. Nicht ohne Selbstvorwurf wird sich Thea aus eigener leidvoller Erfahrung als junge Frau erinnern:
»Meine Mutter sehe ich wieder vor mir. Wie sie Monate lang von dem Vater getrennt lebte. Sie zerfloss in Tränen und machte ihrem gepressten Herzen durch Schmähungen Luft. Ich war zehn, elf Jahre alt. Ich verstand vag und hatte nicht Mitleid mit ihr, sondern hielt eher (auch die Brüder) zu dem Ehebrecher.«[14]
Der Patriarch und Familienvorstand hat nicht nur die bürgerliche Rechtstradition, sondern auch die Sympathie seiner Kinder auf seiner Seite. Auch wenn die Episode kein Einzelfall bleiben wird, gelingt es, die Fassade der gutbürgerlichen Familie zu wahren.
Dazu trägt eine neue Form von Freizeitkultur bei, die man neben der Pflege kultureller Interessen an Theater, Musik und Lektüre auch mit Bildungsreisen und Kuraufenthalten verbringt, um für Abstand, Zerstreuung und Abwechslung im großbürgerlichen Familienleben zu sorgen. Jeden Sommer begleitet Thea ihre zuckerkranke Mutter zur Kur nach Karlsbad, wo man regelmäßig mit standesgemäßen Bekannten und Verwandten zusammentrifft. Als Thea im Sommer 1894 während des Kuraufenthaltes lebensgefährlich an Typhus erkrankt, muss die Reise jedoch abgebrochen werden. Die langwierige Krankheits- und Genesungszeit zieht sich bis in den Winter und bedeutet einen spürbaren und sichtbaren Einschnitt, da aus dem eher zarten und anfälligen Kind eine pummelige Elfjährige wird. Außer den Kuraufenthalten führen weitere Reisen in die Reichshauptstadt, in das mondäne Seebad Ostende und zu Wanderungen in die Tiroler und die Schweizer Berge.
Die heranreifende Tochter genießt zunehmend die väterliche Bevorzugung in Form von kostbaren und geschmackvollen Geschenken. Bei einem Kuraufenthalt zieht sie erstmals auch die Aufmerksamkeit eines Freundes des Vaters, Franz Wicküler,[15] auf sich, der die Familie nach Karlsbad begleitet hat. Zwar schmeichelt der ungefähr Zwölfjährigen das Interesse des sehr viel älteren Mannes; zum ersten Mal verliebt sich Thea jedoch im selben Alter in Fritz Werner, der als erster Tenor buffo am Kölner Stadttheater engagiert ist und regelmäßig im Hause Bauer verkehrt.[16] Nicht dem vermögenden Brauereibesitzer Wicküler, sondern dem gefeierten Sänger gilt ihre schwärmerische Bewunderung, die von der Mutter geteilt und vom Vater missbilligt wird. Den vorläufigen Höhepunkt von Theas jugendlicher Schwärmerei bildet das Abschiedsdiner zu Ehren von Fritz Werner, aus dessen Anlass sie ein Gedicht verfasst hat. Der Vortrag ergreift sie jedoch dermaßen, dass sie schluchzend aus dem Speisezimmer zu Bett gebracht werden muss. Inwiefern der Überschwang ihrer Gefühle, sei es für die Jungfrau Maria, den Gekreuzigten, die mondäne Hedwig Schaurte oder den bejubelten Tenor, ihrer frühreifen Jugend, ihrem gefühlsarmen Elternhaus, ihrem leidenschaftlichen Naturell oder dem überbordenden Gefühlsdekor der Gründerzeit geschuldet ist, lässt sich schwer entscheiden. Eine Mischung all dieser Aspekte fließt zweifellos zusammen in einem Bedürfnis nach Idealisierung, das sich immer wieder an der alltäglichen Wirklichkeit reiben wird.