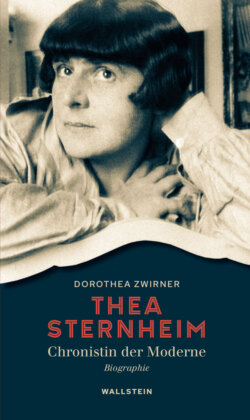Читать книгу Thea Sternheim - Chronistin der Moderne - Dorothea Zwirner - Страница 8
Erste Ehejahre mit Arthur Löwenstein (1901–1903)
»Recht auf Glück«
ОглавлениеAm Morgen des 9. November 1901 brennt die siebzehnjährige Thea mit einer Ausgabe von Maeterlincks Essaysammlung Le Trésor des Humbles in der Hand durch.[40] Nach einer pathetischen Verabschiedung von Hedwig Schaurte bricht sie von Neuss nach Hoek van Holland auf, wo Arthur Löwenstein sie zur Überfahrt nach England erwartet. Dort hat er alle Vorbereitungen für die standesamtliche Trauung getroffen, die am nächsten Morgen in Gegenwart von zwei unbekannten Zeugen in London stattfindet. Anschließend geht es weiter nach Cambridge, wo das junge Paar von einem Freund Löwensteins und einem Strauß weißer Rosen von Hedwig Schaurte zu einer kleinen Hochzeitsfeier erwartet wird.
Die Ernüchterung lässt nicht lange auf sich warten. Schon am Morgen nach der Hochzeitsnacht erwacht Thea aus ihren romantischen Träumen und wird sich des Unterschiedes zwischen himmlischer und irdischer Liebe schmerzhaft bewusst. Die erste sexuelle Erfahrung ist nicht nur schmerzhaft und schockierend für Thea, sondern lässt Arthur in einem völlig neuen Licht erscheinen. Der galante und kultivierte Schöngeist stellt sich als ein Mann aus Fleisch und Blut heraus, noch dazu als einer, der in Theas leidenschaftlichem Temperament keine Sinnlichkeit zu wecken weiß. In ihrer grenzenlosen Unerfahrenheit, in der junge Bürgerstöchter unter ständiger Aufsicht bewusst gehalten werden, ist die Hochzeitsnacht ein regelrechter Schock für Thea. Statt für die körperliche Liebe ist ihre jugendliche Vorstellungswelt für eine mystische Sicht empfänglich, wie sie in Maeterlincks philosophischen Schriften um die Jahrhundertwende ausgesprochen populär ist.[41]
Die neu-romantische und neu-mystische Geistesströmung eines Maeterlinck, die sich gegen die Philosophie des Naturalismus auf das seelische Empfinden des Menschen richtet, entspricht nicht nur Theas literarischem Geschmack, sondern auch ihrem seit frühester Kindheit ausgeprägten metaphysischen Bedürfnis. Als Vertreter einer literarischen Avantgarde und als moralische Autorität bietet der Modeschriftsteller einer breiten Leserschaft Orientierung und Lebenshilfe in einer sich rasant verändernden Welt. Die ganz persönliche Bedeutung von Maeterlincks Schriften für seine Leser wird auch von Thea bezeugt, die sich noch fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Flucht stärker an ihre Maeterlinck-Lektüre als an die Hochzeitsnacht erinnert.[42]
Aus Maeterlincks Ermutigung zur Befreiung von Zwängen und Ängsten, Passivität und Entsagung hin zu einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung kann Thea ihr eigenmächtiges Handeln rechtfertigen und ihr »Recht auf Glück« ableiten. Auf ähnliche Weise wird Maeterlinck auch von der frühen Emanzipationsbewegung als »Dichter der neuen Frau« interpretiert, der sich zur Legitimation und Selbstbestätigung der eigenen Ideologie vereinnahmen lässt.[43] Ricarda Huch warnt hingegen vor der »Unklarheit und Verschwommenheit des Buches«, in dem eine »schwüle, etwas betäubende Stimmung wie etwa in einem verhangenen Zimmer mit Blumen, das nie dem Tageslicht und der frischen Luft geöffnet wird«, herrsche.[44]
Hin- und hergerissen zwischen ihrem Anspruch auf Freiheit und dem Zwang zur Anpassung träumt Thea von einer mystischen Welterfahrung jenseits aller etablierten Hierarchien und Reglementierungen, von einem wortlosen Einvernehmen jenseits aller bürgerlichen Konventionen. Umso ernüchternder erlebt sie die Realität der bürgerlichen Ehe an der Seite Arthur Löwensteins, der nach seinem gerade abgelegten Assessor-Examen nun den gemeinsamen Lebensunterhalt als Anwalt verdienen muss und wenig Sinn für Theas literarische Neigungen zeigt.
Unterdessen hat die heimliche Eheschließung einen regelrechten Zeitungsskandal ausgelöst. Unter den sensationsträchtigen Vermischten Nachrichten aus dem Reich weiß das Berliner Tageblatt aus Köln zu berichten: »Stadtgespräch bildet hier die Entführung der achtzehnjährigen Tochter eines hiesigen Millionärs durch einen Assessor jüdischer Konfession, der deshalb nicht hoffen konnte, von den katholischen Eltern seiner heimlichen Braut die Einwilligung zur Ehe zu erlangen. Beide reisten, der ›Frankfurter Zeitung‹ zufolge, nach London und ließen sich dort trauen, nachdem der Assessor zur katholischen Religion übergetreten war. Nun soll der Vater der jungen Frau mit der Heirat sich einverstanden erklärt haben.«[45]
Davon kann freilich nicht die Rede sein. Vielmehr gilt es nach der Rückreise von England, der Realität ins Auge zu sehen und eine gemeinsame Existenz ohne elterlichen Segen und finanzielle Unterstützung aufzubauen. Auf dem Heimweg bietet ein kurzer Besuch in Brüssel bei Louisa Merck noch einen vertrauten Zwischenhalt, wo sich Thea am gemeinsamen Musizieren ihrer ehemaligen Klavierlehrerin mit ihrem Mann freuen kann. Am liebsten würde sich Thea gleich in Brüssel niederlassen, muss aber einsehen, dass es für einen angehenden deutschen Juristen dort keine Existenzgrundlage gibt. Wo die verheißungsvolle Zukunft beginnen und das gemeinsame Heim aufgeschlagen werden soll, ist völlig offen. Vorübergehend führt der Weg wieder nach Köln, wo das junge Paar die Weihnachtszeit bei der Familie von Arthurs Schwester Clara Loewengard verbringt. Zu Gast in dem neuen Milieu der angeheirateten Familie fühlt sich Thea noch nicht heimisch, in der vertrauten Umgebung ihres nahe gelegenen Elternhauses ist sie es nicht mehr. Sosehr sich Clara auch um Thea bemüht, so unwohl fühlt diese sich im Haus ihrer Schwägerin, deren pubertierende Söhne sie genauso abstoßend findet wie Claras Liebhaber mit seinen anzüglichen Reden. Hat sich Arthur immer über die Affären ihres Vaters empört, so scheint ihn die Liaison im Haus seiner Schwester überhaupt nicht zu stören. Hat Thea gehofft, durch die Ehe mit Arthur Löwenstein der Doppelmoral ihres Elternhauses zu entkommen, so sieht sie sich jetzt getäuscht. Nun sitzt sie zwischen allen Stühlen, und ihr Ehemann ahnt nichts von der Kluft der Enttäuschung, die sich für Thea zwischen »nicht mehr« und »noch nicht« aufgetan hat. Unfähig, über Sorgen zu sprechen, die der andere noch nicht einmal ahnt, und ohne private Rückzugsmöglichkeit wächst die Spannung zwischen dem jungen Ehepaar, so dass ein marginaler Anlass am Neujahrstag 1902 zum ersten handfesten Streit führt.
Es ist höchste Zeit, sich aus dem Loewengard’schen Haus zu verabschieden und sich nach einer eigenen Bleibe umzuschauen. Tatsächlich sorgt eine gemeinsame Reise nach Frankfurt, wo Arthur seine beruflichen Möglichkeiten in einer Anwaltskanzlei zu klären hofft, schon bald für die nötige Entspannung. Bei einem Besuch im Goethehaus fühlt sich Thea dem ersten Idol ihrer Jugend so nahe, dass sich der vollzogene Bruch mit dem Elternhaus leichter vergessen lässt. Doch bei einer Besichtigung des Städelschen Kunstinstituts empfindet sie die gemeinsame Kunstbetrachtung mit ihrem Mann schon wieder als eher einengend denn bereichernd. Wie gerne würde sie ihre Eindrücke wie gewohnt schriftlich festhalten, fühlt sich aber Arthur gegenüber zu befangen. Vermutlich würde sie vor dem kleinen Andachtsbild der Lucca-Madonna ihres geliebten Jan van Eyck länger verweilen und sich in den Bildraum hineinziehen lassen, um der intimen Szene der stillenden Muttergottes aus nächster Nähe beizuwohnen. Vielleicht wäre sie sogar der symbolischen Bedeutung des Apfels in der Hand des Jesuskindes nachgegangen. Ist es der Apfel vom Baum der Erkenntnis, den der neue Adam von der neuen Eva empfangen hat oder ist es der Apfel aus dem Hohelied der Liebe, der Maria in ihrer Doppelrolle als Mutter und Braut zeigt? Welches ist die eigentliche Bestimmung der Frau, wenn selbst Marias Rolle so mehrdeutig ist?
Auf der Suche nach ihrem weiblichen Selbstverständnis hat Thea sich kaum aus der Bevormundung des Elternhauses befreit, als sie sich schon in einer neuen Abhängigkeit sieht. Die Notwendigkeit zur Anpassung und der Wunsch nach Selbstbestimmung stellen für die junge Ehefrau eine ebenso komplizierte Gradwanderung dar wie gerade noch für die heranwachsende Tochter. Im Zweifel über den grundsätzlichen oder individuellen Charakter dieses Zweispalts beginnt Thea den radikalen Bruch mit ihren Eltern zu bereuen und schreibt am 26. Februar 1902 einen versöhnlichen Brief an den Vater. Die Antwort erfolgt prompt und fällt ebenso liebevoll wie prinzipiell aus. Georg Bauer findet deutliche Worte, wie sehr er das eigenmächtige Handeln seiner Tochter für einen fatalen Fehler hält und wie sehr er sie dennoch liebt. Thea ist hin- und hergerissen zwischen dem eigenen Zweifel an ihrer Entscheidung und trotzigem Stolz, dafür geradezustehen. Um keinen Preis würde sie ihren Eltern eine Fehlentscheidung eingestehen, findet jedoch mit zwei weiteren Briefen an Vater und Mutter im März den richtigen Ton, um eine Versöhnung anzubahnen.
Nachdem die Anstellungsverhandlungen in Frankfurt gescheitert sind, lassen sich Thea und Arthur Löwenstein im April in Düsseldorf nieder, wo sie in Oberkassel eine Fünfzimmerwohnung beziehen. Erst jetzt kann das eigentliche Eheleben beginnen, das für Thea zum ersten Mal in ihrem Leben mit sämtlichen Haushaltspflichten verbunden ist. Drei Öfen müssen in dem zugigen Neubau ständig geheizt werden, und selbst die einfachsten Grundlagen des Kochens bedürfen der Übung. Zwar steht ihr eine Hilfe für die Wäsche und Putzarbeit zur Seite, aber praktisch wie wirtschaftlich muss sie sich in völlig neuen Lebensverhältnissen zurechtfinden. Das vergleichsweise bescheidene, aber dennoch nicht unbeträchtliche Vermögen von Arthur Löwenstein beträgt 140.000 Mark, wovon 10.000 Mark für die Einrichtung des Hausstandes inklusive eines Ibach-Flügels verwendet werden. Bis auf den eigenen Schreibtisch enthält sich Thea persönlicher Wünsche, so dass die Möblierung nach den Maßstäben der Jahrhundertwende relativ spärlich aussieht. Vom Schreibtisch aus bietet der Blick auf den Rhein die weite Aussicht, die Thea an Arthurs Seite zunehmend vermisst.
Ihr Mann verlässt morgens um 9 Uhr das Haus, kommt zum Mittagessen um 13 Uhr nach Hause und geht dann wieder in die Kanzlei, aus der er erst abends gegen 20 Uhr zurückkehrt. In der Zwischenzeit hat Thea den Haushalt zu versehen, nutzt aber jede freie Minute zum Lesen der durch Tolstoi entdeckten russischen Literatur. Statt sich darüber auszutauschen, darf Thea nach dem Abendessen ihrem Mann beim Geigenspiel zuhören. Bei allem Elan, Stolz und Trotz, mit dem sie ihre Entscheidung verteidigt und sich in ihrem Eheleben einrichtet, kann sie sich nicht über den Mangel an gemeinsamen Interessen hinwegtäuschen. Umso mehr freut sich Thea über den ersten Besuch ihrer Mutter, die ihre Tochter ohne Umschweife nach der kirchlichen Trauung fragt. Da sich Thea und Arthur dem väterlichen Wunsch nach einer katholischen Trauung problemlos fügen, steht einer Aussöhnung nichts mehr im Weg. Erleichtert über dieses Zugeständnis lässt Theas Mutter gleich eine ganze Reihe neuer Möbel und Perserteppiche von Köln nach Düsseldorf liefern, die für mehr Wohnlichkeit und Komfort sorgen sollen.
Auch wenn in großen Teilen des Rheinlandes und speziell in Köln relativ gute katholisch-jüdische Beziehungen herrschen, so richten sich die Vorbehalte von Theas Eltern vermutlich genauso gegen eine interreligiöse wie gegen eine interkonfessionelle Ehe. Ein protestantischer Schwiegersohn wäre wohl nicht viel willkommener gewesen als ein jüdischer, zumal es aus Elternsicht im Zweifelsfall beide gleichermaßen auf die Mitgift ihrer Tochter abgesehen haben. Um 1900 ist das Thema der katholisch-protestantischen Mischehe noch keineswegs erledigt.[46] Zwar hat deren Zahl im Zuge der Urbanisierung des 19. Jahrhunderts beständig zugenommen, jedoch beläuft sich der Anteil in Preußen um 1900 immer noch erst auf 8,5 %.[47] Im Dauerkonflikt zwischen protestantischem Preußen und katholischem Rheinland spielt das Problem der Mischehe eine Schlüsselrolle, die vom sogenannten Mischehen-Streit der 1830er Jahre über den Kulturkampf der 1870er Jahre bis weit ins 20. Jahrhundert reicht. Die Frage der religiösen Kindererziehung bildet den Kern dieses Konflikts, auch für den fortschrittlichen Unternehmer Georg Bauer. Mit der Zustimmung der Brautleute, die gemeinsamen Kinder katholisch zu erziehen, ist das größte Hindernis für eine Aussöhnung beseitigt. So wird am 3. Mai 1902 die kirchliche Trauung in Deutz im Beisein von Theas Mutter, Tante Linchen und Kusine Olga vollzogen. Theas Vater kann sich noch nicht dazu durchringen, an der Hochzeit seiner einzigen Tochter teilzunehmen, doch schon wenig später folgt das rührende Wiedersehen im Elternhaus. Nach der tränenreichen Umarmung des Vaters wird die heimgekehrte Tochter des Hauses vom versammelten Personal in der Küche empfangen. Nun muss das Fräulein Thea von seiner abenteuerlichen Flucht berichten, hat doch ihr Aufbegehren gegen den Haushaltsvorstand ein ungläubiges Staunen verursacht. Noch größer ist allerdings das neugierige Staunen über den eigenen Hausstand, den die Frau Doktor dem Vernehmen nach eingerichtet hat und nun selbstständig führt. Es ist eine filmreife Küchenszene, die Thea Sternheim in ihren Erinnerungen schildert.
Die Versöhnung mit den Eltern zieht nicht nur deren erneute finanzielle Unterstützung nach sich, sondern gibt Thea auch neue Hoffnung für ihre Ehe. Wenn die Differenzen mit den Eltern zu überwinden waren, so sind es auch die atmosphärischen Störungen zwischen Arthur und ihr. Voll neuer Hoffnungen ist Thea bald schwanger. Doch weder die wirtschaftliche Freizügigkeit noch die Schwangerschaft können die Entfremdung zwischen den Eheleuten aufhalten, so dass sich Thea zunehmend in sich zurückzieht. Der besorgte Ehemann reagiert darauf mit dem Geschenk eines Foxterriers, dem Thea vielleicht als Kompensation für ihr eigenes Abhängigkeitsgefühl den Namen »Frei« gibt. In dieser Situation ist Thea nicht unglücklich, dass Arthur im Sommer als Reserveleutnant zu einem Manöver nach Würzburg reisen muss. Während seiner Abwesenheit zieht sie zu ihren Eltern nach Köln, wo sich Tochter und Mutter angesichts der Schwangerschaft einander weiter annähern.
Am 3. Dezember 1902 bringt Thea ihr erstes Kind durch eine schwere Zangengeburt zur Welt, das nach seiner Großmutter Agnes benannt, doch bald schon Nucki gerufen wird. Durch diese einschneidende Erfahrung wächst die Verbundenheit zwischen Thea und ihrer Mutter, die nun täglich zu Besuch kommt und ganz vernarrt in das nach ihr benannte erste Enkelkind ist. Doch zwischen den Eltern vermag selbst das gemeinsame Kind keine Nähe mehr herzustellen. Trotz aller Fürsorge und Freundschaft vermisst Thea in Arthur den Gesprächspartner. Sosehr sie tagsüber in ihrer neuen Mutterrolle aufgeht, so sehr beginnt sie sich abends in seiner Gegenwart zu langweilen. Umso mehr freut sie sich auf den angekündigten Besuch ihrer Bonner Internatsfreundin Eugenie, aber auch auf deren Ehemann, den Schriftsteller Carl Sternheim.
Es ist Frühjahr 1903, als die neunzehnjährige Thea ihre alte Schulfreundin erwartet. Vielleicht sitzt sie wie so oft an ihrem Schreibtisch und lässt den Blick erwartungsvoll über die Uferpromenade oberhalb der Rheinwiesen wandern. Von ihrem Lieblingsplatz am Erkerfenster kann das Auge dem breiten Flusslauf ein gutes Stück weit folgen. Jede freie Minute verbringt sie hier, sobald sich ihr Mann in seine Anwaltskanzlei begeben hat, die Haushaltspflichten erledigt oder delegiert sind und ihre kleine Tochter Agnes im Kinderzimmer nebenan von der Amme gestillt in der Wiege schläft. Ständig sind Briefe zu schreiben an die Eltern in Köln, die Internatsfreundinnen aus Bonn und Brüssel und den wachsenden Bekannten- und Freundeskreis in Düsseldorf. Täglich kommen und gehen die Briefe, deren Besorgung für sie mehr als nur selbstverständliche Pflicht ist. Neben der Korrespondenz versucht sich Thea auch an eigenen Gedichten, die sie in der Schublade ihres verschließbaren Rollladen-Schreibtisches verwahrt. Es ist das einzige Möbelstück, das sie sich für ihren neuen Hausstand ausgesucht hat, kein zierliches Damenmöbel, sondern ein massiver Eichenholzsekretär der Firma Soennecken, mit dem sie ihren Anspruch auf einen eigenen Schreibplatz und privaten Rückzugsort in den Erker des Musikzimmers gestellt hat, das von Arthurs Ibach-Flügel dominiert wird.
Was die junge Ehefrau und Mutter mit ihren dichterischen Ambitionen nur vage in Worte zu fassen weiß, das kann sie beim Blick aus dem Fenster dem Schicksalsfluss der Deutschen anvertrauen. Denn wer als Thea Bauer in Neuss geboren, in Kölns nördlicher Altstadt aufgewachsen und als frisch verheiratete Frau Löwenstein nach Oberkassel gezogen ist, dessen Herz schlägt linksrheinisch. Linksrheinisch für die römisch-katholischen Wurzeln ihrer Herkunft, linksrheinisch für die französische Ausrichtung ihrer Erziehung und linksrheinisch für das sinnenfreudige Temperament ihres Wesens. Aber wie schon für den verehrten Heinrich Heine zieht sich der Rhein wie eine Scheidewand durch das Land und das Herz der Deutschen und lässt auch bei Thea Sternheim römische Rationalität und deutsche Mystik, preußische Disziplin und rheinische Lebensfreude aufeinanderstoßen.
Carl Sternheim ist Mitte zwanzig, als er mit seiner jungen Frau Eugenie über die Oberkasseler Brücke den Kaiser-Wilhelm-Ring mit seinen schmucken Neubauten entlangkommt. Auch wenn der junge Mann mit dem Wilhelminismus wenig gemein hat, ein nach ihm benannter Prachtboulevard wäre schon nach seinem Geschmack. Nach seinem Studium der Philosophie, Psychologie und Rechtswissenschaften in München, Göttingen und Leipzig hat er endlich zu seiner eigentlichen Berufung als freier Schriftsteller gefunden. Es kennt ihn kaum jemand, denn noch hat er bis auf ein Stück kaum etwas publiziert, aber bald soll sein Name in einer Reihe mit den ganz großen Dramatikern erscheinen: Shakespeare, Molière, Goethe, Kleist, Hauptmann – Carl Sternheim.
Mit diesem Ziel vor Augen, aber ohne Studienabschluss und eigenes Einkommen, hat er mit 22 Jahren Eugenie Hauth, die Tochter eines Weingutbesitzers aus Düsseldorf, geheiratet, die ihm schon bald einen Sohn schenkt. Dank ihrer Mitgift und der Unterstützung seines Vaters, der als jüdischer Bankier, Börsenmakler und Zeitungsverleger bereits in zweiter Generation ebenfalls vermögend ist, kann er es sich leisten, einen Brotberuf als Zumutung zu empfinden.
Liegt Vorfrühling in der Luft, sind die Rheinauen von Krokussen übersäht, und vorbeiziehende Schiffer winken den Spaziergängern zu. Würde Carl Sternheim den Gruß erwidernd seinen Hut ziehen, könnte man sehen, dass sich sein Haaransatz schon zu lichten beginnt. Die hohe Stirn und der Schnauzbart lassen den Fünfundzwanzigjährigen in seinem doppelreihigen Straßenanzug mit Vatermörder älter erscheinen, als er ist. Offensichtlich legt er größten Wert auf eine gepflegte Erscheinung, die von seiner relativ kleinen Körpergröße ablenkt. Hinter seiner Akkuratesse verbirgt sich jedoch nicht nur Eitelkeit, sondern auch ein »schönheitstrunkener« und unkonventioneller Geist.
Seit ihrer Kindheit bewundert Thea nichts so sehr wie den kreativen Menschen. Kunst und Literatur sind von Anfang an ihre große Leidenschaft, ihr eigentliches Lebensgefühl und nicht nur gehobene Unterhaltung und kultivierter Gesprächsstoff wie für Arthur. Sie lebt vielmehr in ihren Büchern und Bildern, weil sie darin etwas von der unbegrenzten, schöpferischen Freiheit spürt, die ihr im Leben so unerreichbar erscheint. Sie träumt von einer höheren Lebenskunst und nicht von diesem durchschnittlichen Kunstleben. Dabei ist sie keine Träumerin, sondern ein Willensmensch durch und durch. Jede falsche Autorität, die ihr einen fremden Willen aufzwingen will, ist ihr suspekt. Allein der Schöpfergott ist die einzige Autorität, an die sie bedingungslos, wenn auch nicht ohne Zweifel, glaubt, ist er doch der Schöpfer par excellence. Am liebsten würde sie selber schreiben, so unbefangen und glühend wie in ihrer Jugend, doch mit Goethe, Heine und Tolstoi als Maßstab sinkt der Mut und wächst der Selbstzweifel, noch dazu als Mädchen ohne höhere Bildung.
Aber Theas erster Eindruck vom Dichter fällt zwiespältig aus, zumindest im Rückblick: »Er ist mittelgroß, schlank, excentrisch und überangezogen«.[48] Inwiefern Thea schon bei diesem ersten Besuch Sternheims Aufmerksamkeit weckt, wissen wir nicht. Sie ist keine Schönheit, aber eine brünette und lebensvolle junge Frau mit welligen Haaren, warmen braunen Augen und sinnlichen Lippen. Die dunklen Augenbrauen geben ihrem Gesicht einen markanten, fast männlichen Zug, der auf einen starken Willen und ein leidenschaftliches Temperament hindeutet.
Schon bald besucht Carl Sternheim auch ohne seine Frau das Ehepaar Löwenstein. Auch wenn Theas Eindruck weiterhin höchst ambivalent bleibt, kann sie sich einer gewissen Faszination nicht entziehen:
»Inzwischen gefällt mir Sternheim bereits weniger als beim ersten Besuch. Die Art und Weise, mit der er seine Erfolge bei Frauen herausstreicht, die Verführten bei Namen nennt, berührt mich peinlich. Andererseits scheint er nicht im geringsten beleidigt, mache ich mich über seine Indiskretionen lustig. […] Er stößt mich ab und zieht mich gleichzeitig an. Beim Abschied empfiehlt er mir die Anschaffung seines Judas Ischarioth.«[49]
Die Tragödie vom Verrat, wie Sternheim sein pathetisches Frühwerk über das Leben Jesu im Untertitel nennt, kündigt sich wie ein Menetekel an und zieht Thea in ihren Bann. Hat Judas den Messias freiwillig verraten oder hat er ihn nur dem göttlichen Heilsplan übergeben? Spielt er die selbstgewählte Rolle des Verräters oder die schicksalhafte Rolle des Erfüllungsgehilfen? Die personifizierte Frage, ob menschliches Handeln von göttlicher Vorsehung oder vom freien Willen bestimmt wird, fasziniert Thea ebenso sehr wie den Autor des Judas Ischarioth. Es wird ihr Lebensthema und die Tragödie ihres Lebens, ihre »weibliche« Anpassungsbereitschaft und Schicksalsergebenheit mit ihrem »männlichen« Gestaltungswillen und Geltungsbedürfnis verbinden zu wollen.