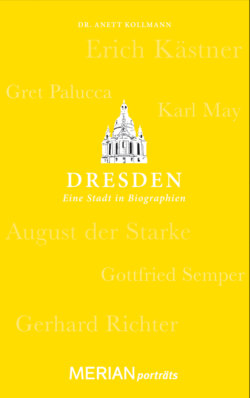Читать книгу Berlin. Eine Stadt in Biographien - Dorothee Fleischmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[zurück]
KARL FRIEDRICH SCHINKEL
1781–1841
Er war Grafiker, Maler, Bühnenbildner, Stadtplaner – und der bedeutendste Baumeister Berlins. Ohne seine berühmte klassizistische Architektur wäre die deutsche Hauptstadt um vieles ärmer.
Den Kopf gehoben, in die Weite blickend, den Zeichenblock in der Hand: So steht er mitten in Berlin – der große Baumeister Karl Friedrich Schinkel. Einen besseren Platz hätte die Bronzefigur nicht bekommen können 29 ( ▶ H 4): Hier hat Schinkel gewirkt und gewohnt. Von hier aus hat er das Bild der Stadt Berlin mitgestaltet und viele der Gebäude in der Umgebung entworfen. Hier, vor dem Gerippe der einstigen Bauakademie, steht er zwischen seinen beiden ehemaligen Kollegen Peter Christian Beuth, dem früheren Direktor der Technischen Deputation und Chef des Gewerbeinstituts, und dem Agrarwissenschaftler Albrecht Thaer. Im Zentrum des alten und des neuen Berlins und im Zentrum seines Schaffens. Der Bildhauer Friedrich Drake hat ihn zeichnend dargestellt.
Schinkel vereinte viele Talente in sich: Er war Anfang des 19. Jh. nicht nur der wichtigste Berliner Architekt und Stadtplaner. Seine Bilder wurden auf Kunstausstellungen gezeigt, für das Berliner Theater oder das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 28 ( ▶ H 5) entwarf er Bühnenbilder, für die königlichen Schlösser und Landsitze plante Schinkel die Innenarchitektur und Möbel, die heute noch im Schloss Charlottenhof und Charlottenburg zu sehen sind. Selbst Gartenmöbel aus Gusseisen entwarf er. Bei der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) Berlin kann man immer noch die Vasen »Fidibus« und »Trompetenform«, den zweiteiligen »Zuckerkorb« und den »Schinkelkorb« kaufen, die auf seine Entwürfe zurückgehen. Bis zu seinem Tod arbeitete er an einem Wandbild für das Alte Museum ( ▶ J 4/5). Karl Friedrich Schinkel war ein Allroundgenie, und Berlin verdankt ihm zahlreiche prägnante Gebäude.
Der 1781 in Neuruppin geborene Schinkel, Sohn des Theologen Johann Christoph Schinkel, kommt mit 13 nach Berlin und geht auf das Gymnasium zum Grauen Kloster. Er ist ein schlechter Schüler, doch an Kunst interessiert, sehr musikalisch und im Zeichnen begabt. Als er eine Ausstellung mit Architekturzeichnungen von Friedrich Gilly sieht, steht für ihn fest, dass er Baumeister werden will.
Mit 18 Jahren geht er auf die private Bauschule, schreibt sich ein Jahr später als Student an der neu gegründeten Berliner Bauakademie ein und besucht Vorlesungen an der Akademie der Künste. Nach dem Studium bereist er Europa. In Berlin beginnt er seine Karriere mit der Malerei, da in Preußen nach der Niederlage gegen Napoleon noch nicht an Bauprojekte zu denken ist. In seinen Bildern entwickelt er jene architektonischen Ideen, die er später in seinen Bauten verwirklichen will.
Als im Jahr seiner Heirat Preußens Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. aus Ostpreußen nach Berlin zurückkehren, ist Schinkel bereits stadtbekannt. Das geistige Leben Berlins ist nach dem Ende der französische Besatzungszeit neu erwacht, die Stadt soll eine eigene Universität bekommen und endlich neue Prachtbauten. Schinkel ist begeistert von der Aufbruchsstimmung: »Phlegma, sei es körperlich oder geistig, ist ein sündhafter Zustand für den, der in Zeiten der Bildung lebt.«
Er ist humanistisch gebildet, ein fortschrittlicher Denker und kennt Dichter wie Brentano oder Goethe persönlich. Als Beamter gilt er zwar als äußerst gewissenhaft, doch gleichzeitig ist er ein moderner, geistreicher Intellektueller. Er ist Gutachter und arbeitet als Bühnenbildner, Mozarts Zauberflöte wird 1816 mit seinen Bühnenbildern aufgeführt. Auf Vorschlag Wilhelm von Humboldts bekommt Schinkel eine Stelle bei der Oberbaudeputation im Ressort »Öffentliche Prachtbauten«. Ab 1815 werden dann endlich Staatsbauten wie die Neue Wache 25 ( ▶ G 4), das Schauspielhaus 28 ( ▶ H 5) und das Alte Museum nach seinen Plänen verwirklicht.
Er reist mehrmals nach Weimar und zeigt Goethe 1820 die Pläne seines neuen Berliner Schauspielhauses am Gendarmenmarkt, das alte war 1817 fast vollständig abgebrannt. Der Dichter ist sehr beeindruckt: »Herr Geheimer Rath Schinkel machte mich mit den Absichten seines neuen Theaterbaues bekannt und wies zugleich unschätzbare landschaftliche Federzeichnungen vor, die er auf einer Reise in Tyrol gewonnen hatte … Eine lebhafte, ja leidenschaftliche Kunstunterhaltung ergab sich dabei, und ich durfte diese Tage unter die schönsten des Jahres rechnen.«
Beispielhaft für diese Zeit ist die Entstehung des Alten Museums. Die bisher vor der Öffentlichkeit verschlossenen Kunstsammlungen sollen nun allen Bürgern zugänglich gemacht werden, um ihnen eine umfassende Bildung zu ermöglichen. König Friedrich Wilhelm III. teilt dieses Bildungsideal mit dem Reformer Wilhelm von Humboldt und beauftragt Schinkel mit der Planung des Museums. Dem Regenten schwebt »eine Freistätte für Kunst und Wissenschaft« mit einer antiken Bebauung auf der nördlichen Spreeinsel vor. Schinkel integriert das Königliche Museum in ein Ensemble rund um den Lustgarten: das Stadtschloss im Süden als Symbol der weltlichen Macht, das Zeughaus ( ▶ H 4) im Westen, um das Militär zu repräsentieren, und der Berliner Dom im Osten, der die göttliche Macht verkörpert.
Der Lustgarten wird nach den Vorstellungen Schinkels durch Peter Joseph Lenné neu gestaltet. An der Frontseite des Gebäudes steht der Stiftungsgedanke: »Friedrich Wilhelm III. hat zum Studium der Altertümer jeder Art, sowie der freien Künste 1828 dieses Museum gestiftet.« Das Alte Museum wird das erste öffentliche Museum Berlins, Schinkel arbeitet die ganze Zeit eng mit Wilhelm von Humboldt zusammen.
ER HOLT ITALIENISCHES FLAIR NACH BERLIN
In der folgenden Zeit verwirklicht der Architekt zahlreiche Berliner Bauten, die bis heute erhalten sind: die Schlossbrücke ( ▶ H 4) in Mitte, die Umgestaltung des Schlosses in Tegel (Humboldt-Schloss), die Luisenkirche in Charlottenburg, die Friedrichswerdersche Kirche 16 ( ▶ J 3) in der Werderstraße in Mitte, Schloss Glienicke in Wannsee, Schloss Charlottenhof und die Nikolaikirche in Potsdam. Die Neue Wache 25 ( ▶ G 4), Unter den Linden, wird von 1816 bis 1818 nach Plänen Schinkels erbaut und gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke des Klassizismus. An dem schlichten Gebäude werden antike Formen aufgegriffen und in ein militärisch-funktionales Bauwerk integriert.
Mit Schloss Glienicke holt Schinkel italienisches Flair nach Berlin. Das Anwesen, einst Sommerschloss des Prinzen Carl von Preußen, liegt im Südwesten Berlins, im Ortsteil Wannsee an der Glienicker Brücke. Carl ist begeistert von der Kultur der Antike und will sich seinen »Traum von Italien« im heimatlichen Berlin verwirklichen. Einige Skizzen und Details erhält Schinkel von Carls künstlerisch begabtem Bruder und integriert diese in seine Entwürfe. Erneut in Zusammenarbeit mit Lenné entsteht eine südlich anmutende Architektur- und Gartenlandschaft, die mit Antiken aus der Sammlung Prinz Carls verziert wird. Mit dem Tod des Prinzen endet die Glanzzeit der Glienicker Anlage.
Das Anwesen erbt später sein Enkel Friedrich Leopold, der wenig Interesse am Glienicker Sommerschloss zeigt. Das Gebäude verfällt, viele antike und mittelalterliche Sammlerstücke verkauft er, und bereits in den 1920er-Jahren sind die antiken Gegenstände, die Prinz Carl über Jahrzehnte zusammengetragen hat, weltweit verstreut. Im Zweiten Weltkrieg wird das Schloss in ein Lazarett umfunktioniert, nach dem Krieg kurzzeitig als Offizierskasino der Roten Armee genutzt. In den 50er-Jahren zieht ein Sporthotel ein und dann eine Heimvolkshochschule. Erst seit Ende der 80er-Jahre wird das Schloss als Museum genutzt, das Schinkel-Möbel und Kunstgegenstände ausstellt, die zum großen Teil aus dem Besitz des Prinzen Carl stammen.
Durch viele öffentliche Aufträge wird Schinkel 1830 Direktor der Bauakademie, ein Jahr später Oberbaudirektor und damit für die gesamte Bautätigkeit in Preußen verantwortlich. Alle staatlichen Bauvorhaben für das Königreich Preußen, deren Kosten 500 Taler übersteigen, müssen fortan von ihm und seinen Kollegen in ökonomischer, funktionaler und ästhetischer Hinsicht begutachtet werden.
Der arbeitseifrige Schinkel überarbeitet alle Entwürfe selbst, um so die öffentlichen Bauten in ganz Preußen stilistisch zu optimieren. Sein klassizistischer Stil gerät zur Mode. Als Schinkel 1838 Oberlandesbaudirektor und damit der Architekt des Königs wird, ist der Höhepunkt seiner Baumeisterkarriere erreicht.
In der Friedrichswerderschen Kirche, die nach Schinkels Plänen und in dem von ihm entwickelten neogotischen Stil erbaut wurde, steht ein Denkmal des Baumeisters. Der König hatte befohlen, Schinkel und andere Künstler zu ehren, »die sich um die Wiederbelebung der Kunst … verdient gemacht haben«.
BITTERES ZERWÜRFNIS MIT DEM NEUEN KÖNIG
Seine angeschlagene Gesundheit zwingt ihn allerdings immer häufiger zu Pausen und zu Kuraufenthalten. Auf einer Bahnfahrt nach Potsdam befällt eine Lähmung den rechten Arm, außerdem verliert er seinen Geruchssinn. Trotzdem reduziert Schinkel sein gewaltiges Arbeitspensum keineswegs. Überdies stirbt am 7. Juni 1840 sein großer Förderer König Friedrich Wilhelm III.Der Inthronisierung seines Nachfolgers Friedrich Wilhelm IV.bleibt Schinkel aus Krankheitsgründen fern, was den neuen Monarchen offensichtlich schwer kränkt. Es kommt zu einem letzten Zusammentreffen, bei dem Friedrich Wilhelm IV. einige sarkastische Worte sagt und dann Schinkel einfach stehen lässt. Das königliche Verhältnis zum Baumeister ist irreparabel zerrüttet.
Mit 59 Jahren erleidet er mehrere schwere Schlaganfälle und bleibt halbseitig gelähmt. Friedrich Schinkel stirbt nach einem Jahr Siechtum am 9. Oktober 1841 in Berlin. Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof 30 ( ▶ G 1) in Mitte. Es trägt als Schmuck ein Medaillon mit dem Porträt Schinkels von August Kiß. Den künstlerischen Nachlass Schinkels kaufte König Friedrich Wilhelm IV. für ein Museum auf. Bald darauf wurde in Schinkels ehemaliger Wohnung im zweiten Obergeschoss der Berliner Bauakademie das erste Schinkelmuseum eingerichtet.
Schinkels Stil und seine Leistungen im Bauwesen führten in Preußen schließlich zur Schinkelschule, einer reduzierten, zweckmäßigen Architektur; sie war ein Wegbereiter der frühen Moderne. Das ist das unsterbliche Erbe von Friedrich Schinkel.
FRIEDRICHSWERDERSCHE KIRCHE 16 ▶ J 3
Werderscher Markt, Mitte
▶ S-Bahn: Hackescher Markt
SCHAUSPIELHAUS AM GENDARMENMARKT 28 ▶ H 5
Mitte
▶ U-Bahn: Stadtmitte
SCHINKEL-DENKMAL 29 ▶ H 4
Schinkelplatz, Mitte
▶ S-Bahn: Hackescher Markt, Alexanderplatz
SCHINKEL-GRAB 30 ▶ G 1
Dorotheenstädtischer Friedhof
Chausseestraße, Mitte
▶ U-Bahn: Oranienburger Tor