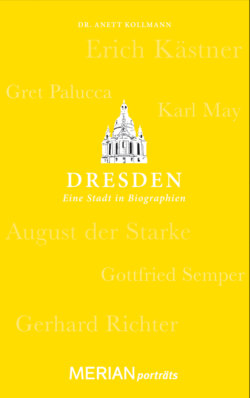Читать книгу Berlin. Eine Stadt in Biographien - Dorothee Fleischmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWILHELM VON HUMBOLDT
1767–1835
ALEXANDER VON HUMBOLDT
1769–1859
Forscher, Entdecker, Philologe, Universitätsgründer, Humanist – nie wieder hat es in Deutschland so ein Bruderpaar gegeben. Berlin verdankt ihm eine geistige Aura, die seit über 200 Jahren strahlt.
Schloss »Langweil« nannten sie den Familiensitz in Tegel. Das mutet schon etwas komisch an, denn die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt sind – auch oder gerade heute – ein Symbol für Weltoffenheit und gleichzeitig der Inbegriff geistigen Lebens in Berlin. Vielleicht war die Ruhe und Einsamkeit des Schlosses ja der Grund, dass es sie zeitlebens in die Ferne zog. Den einen nicht über die Grenzen Europas hinaus, den anderen dafür am liebsten um die ganze Welt. Obwohl beide gar nicht so gern in ihre Heimatstadt zurückkehrten, sondern viel lieber weiter geforscht hätten, ist Berlin besonders stolz auf diese bemerkenswerten Söhne.
So trifft man auf den Namen Humboldt an den unterschiedlichsten Stellen: Humboldt-Schloss, Humboldtforum, Humboldtinsel, Humboldt-Universität 18 ( ▶ H 3/4), Humboldt-Hafen, Humboldt-Bibliothek, Humboldthain und Humboldt-Denkmal, Humboldt-Gesellschaft oder Little Humboldt – dieser Name ist auch nach mehr als 200 Jahren präsenter denn je und steht für fortschrittliches Denken und Wissen. Er verleiht dieser Stadt jenen einzigartigen Glanz, den zeitgenössische Berliner Persönlichkeiten nur noch sehr selten verbreiten.
Alexander von Humboldt hatte sich »Schloss Langweil« als Namen für sein Zuhause ausgedacht. Der Ortsteil Tegel lag im 18. Jh. weitab vom geistigen Zentrum Berlins, wo die Familie nur in den Wintermonaten lebte. Die Brüder erhielten eine umfassende Erziehung durch Hauslehrer, die dem aufklärerischen Denken nahestanden und den Jungen ein breites Wissen vermittelten. Alexander, der mit sechs Jahren lesen und schreiben konnte, aber als der lernunwilligere galt, zeigte schon früh sein Interesse für die Natur und hieß bald in seiner Familie »der kleine Apotheker«. Sein zwei Jahre älterer Bruder Wilhelm konnte schon mit drei Jahren lesen und schreiben und offenbarte früh sein sprachliches Talent. Auf Wunsch der Mutter sollte Wilhelm Jura, Alexander Staatswirtschaftslehre studieren. Doch sie hatten ihre eigenen Vorstellungen und gingen bald eigenen Interessen nach.
An der Universität in Göttingen, dem damaligen Zentrum der aufgeklärten Wissenschaften, studierte Wilhelm Sprachen, Philosophie, Staats- und Naturwissenschaften. Alexander besuchte Vorlesungen der Physik, Anatomie, Zoologie und Biologie. Am meisten interessierte ihn jedoch Georg Forster, der als Naturforscher die Welt umsegelt hatte. Das war auch sein großer Traum, den er alsbald realisieren sollte.
Von Göttingen ging Alexander an die Bergakademie in Freiberg, um das Innere der Erde zu erforschen. Nach dem Tod seiner Mutter verabschiedete er sich sofort vom Staatsdienst, um nun – durch das Erbe ermöglicht – als Wissenschaftler die Welt zu entdecken. Am 5. Juni 1799 brach er Richtung Südamerika auf. Fünf Jahre später betrat er wieder europäischen Boden. Sein Ziel war eine Gesamtdarstellung des physisch-geografischen Wissens der Zeit. Erst 1829 machte er sich auf eine weitere Forschungsreise zum Ural. Dann kehrte er endgültig und auf Wunsch des preußischen Königshauses nach Berlin zurück.
Er war ein beliebter Gast bei Hof, ein Vorzeigewissenschaftler, dessen Anekdoten und Reisebeschreibungen gern gehört wurden. Alexander galt als äußerst unterhaltsam, obwohl er in offiziellen Gesellschaften häufig politisch und religiös aneckte. Seine Zeitgenossen schätzten und fürchteten seinen Witz und seine Ironie. Doch fiel ihm das Leben in seiner Heimatstadt nicht besonders leicht; er hätte lieber die Welt entdeckt.
EINE GROSSE LIEBE TRITT IN WILHELMS LEBEN
Wilhelm von Humboldt zählt bis heute zu den großen Gelehrten der deutschen Kulturgeschichte, er ist einer der Urväter der Konzeption der Universität zu Berlin. Schon als 13-Jähriger spricht er fließend Griechisch, Latein und Französisch. Anfang 1790 tritt er nach dem Abschluss seiner Studien in den preußischen Staatsdienst in Berlin ein. Bereits ein Jahr später verlässt er auf eigenen Wunsch die sichere Anstellung und heiratet im Juni 1791 Caroline von Dacheröden.
Friedrich Schiller nennt sie »ein unvergleichliches Geschöpf«, für Goethe ist sie die bedeutendste Frau ihrer Zeit. Caroline ist nicht nur klug, gebildet und abenteuerlustig, sondern ebenso leidenschaftlich musisch interessiert. Zusammen bereisen sie Europa, fördern deutsche Künstler, sammeln Kunst. Sie führen eine moderne Ehe mit Verhältnissen und Affären, lieben sich dennoch sehr. »Ich glaube nicht, dass es noch einmal zwei Menschen auf Erden gibt, auf die das verehelichte Leben so tief und wechselseitig gewirkt hat wie bei uns«, schreibt Wilhelm von Humboldt.
Zunächst leben sie auf den Familiengütern Carolines. Wilhelm wird kritischer Berater und Mitarbeiter Schillers in Jena, später auch der von Goethe. Ende 1797 ziehen sie nach Paris um, 1803 bis 1808 folgt Rom. Das Domizil der Humboldts wird zum Treffpunkt für Künstler und Wissenschaftler. Anschließend übernimmt Wilhelm die Sektion für Kultus und Unterricht im Preußischen Innenministerium und leitet grundlegende Reformen im Erziehungssystem ein. 1819 wird er seiner Ämter enthoben, da er sich den Karlsbader Beschlüssen widersetzt und eine liberale Verfassung für Preußen erreichen will.
Wilhelm und Caroline ziehen sich auf den Familiensitz nach Tegel zurück. Hier setzt er seine sprachwissenschaftlichen Forschungen fort, das Paar bildet bald wieder das Zentrum für die geistige Elite der Stadt. Als Caroline am 26. März 1829 stirbt, wird sie auf ihren Wunsch im Tegeler Park bestattet.
Wilhelm, der »Philosoph von Tegel«, besucht jeden Abend das Grab seiner Frau, bis er selbst am 8. April 1835 neben ihr begraben wird. Die Schriftstellerin und Salonière Rahel Varnhagen von Ense, eine Freundin von Caroline, äußert sich über das Paar: »Mit größerer Grazie war noch niemand verheiratet, völlige Freiheit gebend und nehmend.«
Alexander von Humboldt überlebt seinen älteren Bruder um über 20 Jahre. Die unübersehbare Menschenmenge, die seinem Sarg im Mai 1859 zum Dom folgt, ist nach zeitgenössischen Berichten nur mit der zu vergleichen, die die 270 Berliner Märzgefallenen der Revolution von 1848 begleitete. Alexander wird neben seinem Bruder im Familiengrab beigesetzt. »Es ist ein glänzendes Gestirn im Reich des Geistes für diese Welt erloschen«, schreibt der Philologe August Böckh.
Die enorme Popularität Alexanders lag nicht zuletzt an seinem Lebenswerk »Kosmos«, einer Gesamtschau der wissenschaftlichen Welterforschung.
An Rahel Varnhagen von Ense, die ihn bei der sprachlichen Gestaltung beraten sollte, schrieb er 1834: »Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen wissen, alles in einem Werke darzustellen, und in einem Werke, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt.« Schloss Humboldt liegt in einer wundervoll ruhigen und friedvollen Atmosphäre; es ist bis heute bewohnt. Ein langer Weg führt auf das weiße Bauwerk zu. 1766 gelangte es in den Besitz der Familie von Humboldt. Wilhelm von Humboldt gestaltete das Anwesen nach Plänen Karl Friedrich Schinkels im Stil des Klassizismus um. Die Innengestaltung wurde auf die hier untergebrachte Antikensammlung abgestimmt, die das Paar während ihres Italienaufenthaltes angelegt hatte. So entstand hier das erste preußische Antikenmuseum. Eine Lindenallee, an der auch die rund 400 Jahre alte Wilhelm-von-Humboldt-Eiche steht, führt zu der Familiengrabstätte der Humboldts.
DIE HÜTER VON FREIHEIT UND HUMANITÄT
Ganz in der Nähe des Schlosses, direkt am Tegeler See, liegt die Humboldtinsel. Hier entstehen »Floating Houses« – unsinkbare schwimmende Häuser für Wassersportbegeisterte mit direktem Wasserzugang. Wenige Schritte weiter, am Tegeler Hafen, steht ein Denkmal der Humboldt-Brüder. Alexander hantiert mit einem Sextanten, Wilhelm hält ein aufgeschlagenes Buch in der Hand, worin steht: »Verweile in der Menschlichkeit, gründe dich auf Gerechtigkeit.« Das Denkmal, auf dem die Brüder zum ersten Mal gemeinsam abgebildet sind, wurde erst 1997 aufgestellt.
Und vor der Humboldt-Universität 18 ( ▶ H 3/4) sitzen die Humboldt-Brüder in Stein rechts und links neben dem Eingangstor. Jahrelang hatte sich ein Komitee bemüht, Alexander von Humboldt zum 100. Geburtstag mit einem Nationaldenkmal zu ehren. Doch 1869 hatte man eher kriegerische Pläne, ein Waffengang mit Frankreich zeichnete sich ab. Der Akademische Senat erklärte sich schließlich unter der Bedingung bereit, dass gleichzeitig eines für Wilhelm von Humboldt errichtet würde. 1883 wurden die Denkmäler am Eingang zum Ehrenhof der Universität aufgestellt. »Wo Wilhelm und Alexander von Humboldt Wache halten, da wird immerdar sein eine Stätte edelsten, menschlichen Strebens, freier Forschung und freier Lehre«, sagte der damalige Rektor der Berliner Universität in seiner Festrede.
So sitzen sie beide einträchtig vor der Hochschule, die auf Initiative Wilhelm von Humboldts gegründet wurde. Zuerst hieß sie Friedrich-Wilhelms-Universität, benannt nach dem preußischen König, dann Berliner Universität, schließlich Universität Unter den Linden. Erst 1949 erhielt sie den Namen ihres Gründers. Bedeutende Wissenschaftler wie der Philosoph Johann Gottlieb Fichte erarbeiteten mit Humboldt das Universitätskonzept, das bis heute besteht: Forschung und Lehre, freie Wissenschaft und Persönlichkeitsformung sollen miteinander verbunden werden. Ein Prinzip, das im Dritten Reich mit der Diffamierung und teilweisen Ermordung der jüdischen Lehrkräfte sowie mit der ideologischen Ausrichtung während der DDR-Zeit schwerste Krisen zu durchstehen hatte.
Letztendlich hat das Humboldt’sche Ideal über alle politischen Perversionen und Verirrungen gesiegt. Es sind nur drei Worte: Veritas – Iustitia – Libertas. Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit.
HUMBOLDT-DENKMAL
Eichborndamm 215–239, Tegel
▶ U-Bahn: Alt-Tegel
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT 18 ▶ H 3/4
Unter den Linden, Mitte
▶ S-Bahn: Hackescher Markt, Alexanderplatz
SCHLOSS TEGEL MIT GRAB DER HUMBOLDTS
Adelheidallee 19, Tegel
▶ U-Bahn: Alt-Tegel