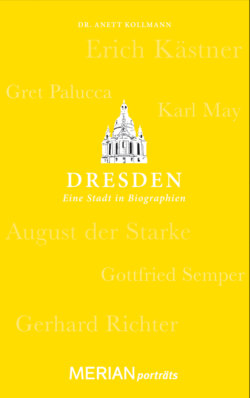Читать книгу Berlin. Eine Stadt in Biographien - Dorothee Fleischmann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[zurück]
KÖNIG FRIEDRICH II. VON PREUSSEN
1712–1786
Der »Alte Fritz« ist die berühmteste Persönlichkeit Berlins. Der Philosoph, Musiker und Feldherr auf dem Preußenthron schuf eine europäische Großmacht und verewigte sich in ihrer Metropole Berlin.
Die Berliner werden ihn immer lieben, ihren »Alten Fritz«. Doch auf seinem Grabstein liegen keine Blumen, sondern Kartoffeln. König Friedrich II. von Preußen wurde auf eigenen Wunsch auf der Terrasse seines geliebten Schlosses Sanssouci in Potsdatm beigesetzt. Er hat einst die Kartoffel als Nahrungsmittel in Preußen durchgesetzt und so entscheidend den Hunger bekämpft. Mit dem Kartoffelbefehl von 1756 hat er mutmaßlich viele Menschenleben gerettet. Soldaten, Feldwächter und Ratsdiener mussten den Anbau so lange überwachen, bis schließlich alle die Segnungen dieser Pflanze begriffen. Die Dankbarkeit der Berliner und Brandenburger währt bis heute; deshalb legen sie ihrem »Alten Fritz« Kartoffeln aufs Grab.
Friedrich II. wurde am 24. Januar 1712 im Berliner Stadtschloss ( ▶ J 4) geboren und starb am 17. August 1786 in Potsdam. Die Freude in Berlin war groß, als er das Licht der Welt erblickte, denn die Eltern, König Friedrich Wilhelm I. und seine Gattin Sophie Dorothea von Hannover, hatten bereits zwei Söhne verloren. Es krachten Kanonenschüsse, sie verkündeten die Geburt des Königssohns. Zeitlebens schlugen zwei Seelen in seiner Brust, die des Philosophen und die des mächtigen Herrschers.
Der junge Friedrich wurde sehr streng und religiös erzogen. Sein Tagesablauf war genau vorgeschrieben, vom Frühstück in sieben Minuten bis zur Freizeit nach 17 Uhr, in der Friedrich alles tun konnte, was er wollte, »wenn es nur nicht gegen Gott ist«. Schon früh entstanden Konflikte mit dem strengen Vater. Als er heimlich mit dem Flötenunterricht begann, kam es immer häufiger zu schweren Auseinandersetzungen. Die Interessen des Vaters, des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., galten dem Militär und der Wirtschaft, nicht aber den schöngeistigen Liebeleien seines Sohnes. Und der junge Friedrich provozierte den Streit durch sein aufsässiges Verhalten. Mit Stockschlägen soll der Vater versucht haben, seinem Sohn die philosophischen Ideen auszuprügeln. Erfolglos.
Als Friedrich II. sich mit dem musisch gebildeten und acht Jahre älteren Leutnant Hans Hermann von Katte anfreundete, dessen Weltgewandtheit ihn begeisterte, wurden die Auseinandersetzungen besonders heftig. Im Frühjahr 1730 wollte der Prinz nach England fliehen und weihte seinen Freund in den Plan ein. Der Fluchtversuch in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1730 scheiterte. Von Katte wurde durch einen kompromittierenden Brief als Mitwisser entlarvt und von einem Kriegsgericht wegen Desertion zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Auf Druck des Königs wurde die Strafe in ein Todesurteil umgewandelt. Der Herrscher zwang seinen Thronfolger, die Hinrichtung mitanzusehen; jedoch soll Friedrich vorher in Ohnmacht gefallen sein.
Ursprünglich wollte der Soldatenkönig auch seinen Sohn wegen Verrats hinrichten lassen und sah erst nach massiven europäischen Interventionen von Kaiser Karl VI. und Prinz Eugen davon ab; schließlich verurteilte er ihn »nur« zu einer Festungshaft, sein Status als Prinz wurde ihm zeitweilig aberkannt. Über die Gründe für die drakonische Härte der Bestrafung wird noch heute spekuliert: Der Soldatenkönig habe von Katte als »Verführer« seines Sohnes gesehen; manche Quellen mutmaßen sogar eine homosexuelle Beziehung zwischen den beiden Freunden.
EINE EHE, DIE KEINE IST …
Erst durch seine Heirat mit der ungeliebten Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern – auch auf Druck des Königs – im Jahr 1732 sowie durch militärische Leistungen konnte Friedrich II. sich von seinem strengen Vater befreien. Die jungen Eheleute zogen nach Schloss Rheinsberg am Grienericksee, die Ehe blieb jedoch distanziert und kinderlos.
Schon vor der Verlobung hatte Friedrich seinen beiden Schwestern, die er achtete und denen er vertraute, von der Abneigung gegen seine künftige Gattin erzählt: Sie sei »schlecht erzogen, ist blöde und weiß sich nicht zu benehmen«. Lieber als seiner Ehefrau widmete sich der Kronprinz dem Studium der Philosophie, der Geschichte und Poesie. Auf Rheinsberg komponierte er 1738 seine erste Sinfonie und verfasste verschiedene Schriften, in denen er sich mit dem aufgeklärten Absolutismus auseinandersetzte.
Als sein Vater 1740 starb, trennte sich Friedrich von seiner Frau und wies ihr als Wohnsitz Schloss Schönhausen zu, wo sie über fünf Jahrzehnte einsam verbrachte. Nunmehr König, begann Friedrich mit der Umsetzung politischer Reformen, darunter die Abschaffung der Folter. Toleranz und Offenheit gehörten zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften. Das zeigte sich in vielerlei Hinsicht in Berlin: Einwanderer kamen in die Stadt, religiöse Minderheiten wie Hugenotten und Katholiken wurden geduldet, eine französische Zeitung für Politik und Kultur gegründet und eine eingeschränkte Pressefreiheit – für den Literaturteil – eingeführt. Alle Religionen waren aus Friedrichs Sicht gleich zu bewerten, »jeder soll nach seiner Façon selig werden«.
In Friedrichshagen, einem Stadtteil von Berlin-Köpenick, steht ein Standbild des Preußenkönigs. Er blickt kühn und selbstbewusst in die Ferne. So stellt man sich den König zu Beginn seiner erfolgreichen Karriere vor. Das Denkmal wurde zur 250-Jahr-Feier Friedrichshagens im Jahre 2003 aufgestellt und stammt von dem armenischen Bildhauer Spartak Babajan. Das Standbild stellt Friedrich II. als jungen Herrscher dar, der durch die Trockenlegung von Landstrichen, Neugründung von Dörfern und Ansiedlung von Kolonisten Friedrichshagen friedlich eroberte.
Ganz anders sieht die Bronzeplastik vor dem Neuen Flügel des Charlottenburger Schlosses aus, wo Friedrich II. gemeinsam mit seinem Großvater, Friedrich I., steht. Links König Friedrich I., der Bauherr des Schlosses, rechts von ihm Friedrich der Große, der Landesherr und Schlachtenlenker. Mit seinem Feldmarschallstab stützt er sich auf Gesetzbücher, ein Zeichen für seinen Gerechtigkeitssinn. Weil er es abgelehnt hatte, schon zu Lebzeiten als Denkmal verewigt zu werden, ist die Arbeit von Johann Gottfried Schadow das erste Monument von ihm. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet und steht für die Weltoffenheit des Monarchen. Friedrich korrespondierte mit Voltaire, interessierte sich für Kunst, sammelte Bilder und war ein Förderer der zeitgenössischen Kunst. Er spielte hervorragend Querflöte und komponierte eigene Stücke.
Unter Friedrich dem Großen entwickelte sich Berlin im 18. Jh. allmählich zur Metropole und Preußen zur politischen und militärischen Großmacht. Berlin wurde zu einem Zentrum der Aufklärung. Seine Freundschaft mit Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff führte zum Bau eines neuen Stadtzentrums, dessen Gebäude bis heute das Stadtbild in Mitte prägen. Repräsentationsbauten entstanden, die Allee Unter den Linden ( ▶ F 4–H 4) entwickelte sich zur Prachtstraße: Das Zeughaus, das Kronprinzenpalais 19 ( ▶ H 4) und das Opernpalais, die Staatsoper und das Prinz-Heinrich-Palais (heute Humboldt-Universität 18 ( ▶ H 3/4)), die St. Hedwigs-Kathedrale und die Alte Bibliothek wurden gebaut. Auch die Königliche Porzellan-Manufaktur wurde auf Initiative Friedrichs eröffnet.
Als Feldherr galt Friedrich der Große lange Zeit als unbesiegbar. Im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 konnte er sich gegen drei europäische Großmächte (Frankreich, Österreich und Russland) behaupten. Der Monarch schonte sich wenig, die zahlreichen Kriegszüge, an denen er persönlich teilnahm, zehrten körperlich und seelisch an ihm. Nach einer der wenigen Niederlagen (bei Kunersdorf 1759) schrieb er: »Meine Kleidung ist von Kugeln durchlöchert, zwei Pferde wurden mir unter dem Leib erschossen, mein Unglück ist, dass ich noch am Leben bin.« Seine eiserne Konsequenz im Siebenjährigen Krieg verdeutlicht folgendes Zitat: »Es ist nicht nötig, dass ich lebe, wohl aber, dass ich meine Pflicht tue und für das Vaterland kämpfe, um es zu retten, wenn es noch zu retten ist.« Trotz des Sieges und des endgültigen Gewinns der Provinz Schlesien ließ er sich ungern feiern.
FRIEDRICH II. SCHEUTE DEN TOD NICHT
Auf dem wuchtigen, 36 Tonnen schweren Reiterdenkmal »Der Alte Fritz« 14 ( ▶ H 4) auf dem Mittelstreifen Unter den Linden sitzt Friedrich der Große hoch zu Ross. Es wurde 111 Jahre nach seiner Thronbesteigung am 31. Mai 1851 enthüllt. 1840 wurde nach vielen Diskussionen der Grundstein gelegt. König Friedrich Wilhelm IV.nahm sich des Projektes an, was ihm nicht nur Lob einbrachte. Vielmehr kursierte der Spruch: »Alter Fritz, steig du hernieder, und regier die Preußen wieder. Lass in diesen schlechten Zeiten, Friedrich Wilhelm weiterreiten.«
Das Denkmal überstand mit einigen Blessuren beide Weltkriege, wäre aber in den 50er-Jahren beinahe – wie andere Denkmäler, die nicht der kommunistischen Ideologie entsprachen – im Schmelztiegel gelandet. Es überlebte schließlich im Park von Sanssouci und wurde 1980 auf Veranlassung von Erich Honecker wieder an seinem ursprünglichen Platz Unter den Linden aufgestellt.
Im Alter zog sich der charismatische Preußenkönig, der schwer von der Gicht geplagt wurde, auf sein Schloss nach Sanssouci zurück. Kein anderes Schloss ist so mit seiner Persönlichkeit verbunden wie dieses. Der Name – ohne Sorge – war Wunsch und Idee des Königs. Sein einstiger Sommersitz wurde ihm zum Lieblings- und Zufluchtsort in schwierigen Zeiten. Hier streifte er mit seinen Hunden durch den Schlosspark.
Friedrich der Große wurde zum Inbegriff für deutsche Disziplin. Er war ein autoritärer Reformer und aufgeklärter Patriarch, ein sensibler Schöngeist und als strategischer Feldherr ein Genie. Toleranz, Wissenschaft und Aufklärung waren für ihn die Mittel, um Berlin und Brandenburg entscheidend aufzuwerten. Darüber hinaus war ihm das Wohlergehen der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen: »Jedem Bürger sein Besitztum sichern und alle so glücklich zu machen, wie es die menschliche Natur zulässt, ist Pflicht derer, die an der Spitze der Gesellschaft stehen«, lautete sein Wahlspruch.
DENKMAL IN KÖPENICK-FRIEDRICHSHAGEN
Marktplatz, Treptow-Köpenick
▶ S-Bahn: Friedrichshagen
DENKMAL VOR DEM SCHLOSS CHARLOTTENBURG
Charlottenburg
▶ U-Bahn: Mierendorffplatz, Richard-Wagner-Platz
FRIEDRICH-II.-REITERDENKMAL 14 ▶ H 4
Unter den Linden, Mitte
▶ S-Bahn: Friedrichstraße, Alexanderplatz
SCHLOSS SANSSOUCI MIT GRABPLATTE
Potsdam
www.sanssouci-sightseeing.de
▶ Bus ab Potsdam Hbf.: Schloss Sanssouci, Luisenplatz, Fahrzeit ab Berlin Hbf. ca. 70 Min.