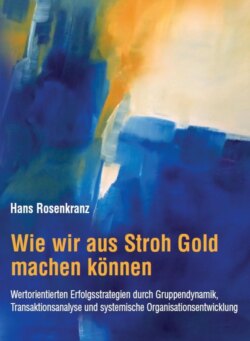Читать книгу Wie wir aus Stroh Gold machen können - Dr. Hans Rosenkranz - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Führung in einer werteunsicheren Gesellschaft „Wer jetzig Zeiten leben will, muss haben ein tapferes Herze…“
ОглавлениеSo beginnt ein Volkslied aus dem 17. Jahrhundert, das die gegenwärtige Krise unseres Werteverständnisses in Wirtschaft und Gesellschaft trefflich beschreibt.
Glaubenskriege, Völkerflucht, Terrorismus, Wirtschafts- und Unternehmenskrisen sind zu den beherrschenden Themen unserer Medien geworden. Hoch angesehene Unternehmen betrügen bewusst und unbewusst ihre Kunden und nehmen Umweltverschmutzung mit verheerenden Folgen für die eigene und die Gesundheit von anderen aus Gewinn- und Machtsucht billigend in Kauf. Korruption, Bestechung und Steuerhinterziehung sind zur Regel geworden, um Fußballweltmeisterschaften oder Olympische Machtspiele für die eigene Nation zu gewinnen. Die hohe Idee des Seins – der Vervollkommnung von Körper, Verstand, Herz und Emotion ist der Sucht des Habens zum Opfer gefallen. Die Schreckensvision des „Homo homini lupus“ – der Mensch ist der Wolf des Menschen, wie vor Jahrhunderten von Hobbes konstatiert – droht, schreckliche Realität zu werden. Das Werteverhältnis nicht nur zwischen Nationen auch zwischen Menschen ist aus den Fugen geraten und hinterlässt Ängste und Verunsicherung. Philosophen und auch der Papst und andere Autoritäten geben Parolen aus: Du musst dein Leben ändern (Sloterdijk 2009). Welchen Autoritäten sind verunsicherte Menschen noch bereit zu trauen, dass sie es wirklich schaffen können.
Was ist für dich Wertvoll? Zu welchen Werten bekennst du dich und für welche bist du bereit, durch dein Sagen und Tun einzustehen? Täglich sind wir direkt oder indirekt vor diese Frage gestellt. So geraten insbesondere Politiker und Führungskräfte in den Konflikt, sich an die in unserem Rechtssystem festgeschriebenen Werte zu halten oder auf Milliardengewinne mit anderen Nationen und Großkonzernen zu verzichten, denen menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Fairness, Freiheit und Frieden für die Menschheit nichts wert ist.
Eine der Entscheidungen, die vor einiger Zeit die deutsche Regierung zu treffen hatte, ist, ob auf ein Treffen mit dem Dalai Lama verzichtet werden solle, um die guten Geschäftsbeziehungen mit China nicht zu stören. Die Verlockung das Gesetz zu brechen ist groß, da Aufträge in noch vielen Ländern dieser Erde nur durch Bestechung zu erhalten sind. Wir werden täglich an Fernsehabenden mit Leben und Tod, Reichtum und Armut, Entwicklung und Verderben, mit Diktatur, Gewalt und Ungerechtigkeit, aber auch mit herzbewegenden Hilfsaktionen konfrontiert. Durch die Informationsflut der Medien werden wir stimuliert, zu allen möglichen Fragen – die uns mehr oder weniger betreffen – wie bei einem Scherbengericht mit Ja oder Nein Stellung zu nehmen. Das individuelle Wertesystem ist permanent gefordert: Ist das, was ich sehe, lese, höre mit meinen Überzeugungen konform oder dazu konträr? Und natürlich schließt sich hier unmittelbar die Frage der Zuständigkeit an: Was geht es mich an, wenn in Zimbabwe und Afghanistan aus Macht und Habgier Menschen umgebracht werden? Wo und wann fängt meine und unsere Verantwortung oder mein und unser Problembesitz an? Daraus ergibt sich die Frage:
Gibt es Werte, die grenz- und religionsüberschreitend für alle gültig sind? Und wie könnten wir uns selbst und andere dazu führen, uns über solche Werte zu verständigen?
Auch in Zeiten, in denen wir noch nicht täglich über Katastrophen am anderen Ende der Welt fast zeitgleich informiert wurden, gab es schon diesen Kampf und Krieg der Bedürfnisse und Emotionen, die letztlich all unseren Weltanschauungen und Überlebensstrategien zugrunde liegen.
In Notzeiten war einst der höchste Wert: Überleben. Aber im Spannungsfeld fanatischer Ideologien gilt er nicht mehr, wie fast tägliche Selbstmordattentate bei Terroranschlägen zeigen. In Zeiten der Fülle und des Reichtums differenzieren sich die individuellen Ziele und Wertvorstellungen noch weiter.
Unser Werteverständnis wird täglich konfrontiert. Welcher Person, welchem Glauben, welchem Gott wollen wir trauen?
Führungskräfte spielen, wie schon der Name sagt, in der Wirtschaft und Gesellschaft eine führende Rolle, da sie durch Ausstrahlung, Charisma und starke überzeugende Argumente Vorbild und Modell stehen für die Mehrzahl ihrer Mitarbeiter sowohl in positiver als auch negativer Weise. Sie gewinnen ihre Legitimation und ihren Einfluss, weil sich die Mitarbeiter mit ihnen identifizieren. Erinnerungen und ungelöste Probleme mit den eigenen Eltern kommen hier häufig auf einer unbewussten Ebene mit ins Spiel. Identifikation geschieht auch wenn die Identifikationssubjekte das nicht wünschen. Das verstärkt die Verantwortung, die immer mit Führung verbunden ist. Sich führen zu lassen bedeutet den zeitweisen Verzicht auf Selbstbestimmung für eine übergeordnete Aufgabe im Vertrauen darauf, dass dadurch ein Mehrwert erreicht wird. Die Adressaten geben einen Vertrauensvorschuss an den Führenden und rächen sich, wenn er das Vertrauen missbraucht. Bei einigen Naturvölkern war die Wahl zum Führer mit übernatürlichen Projektionen und Allmachtsfantasien verbunden, was sie nicht daran hinderte, Führungskräfte bei Erfolgslosigkeit zu töten. (Slater, 1970)
Führungskräfte sind nun inmitten einer globalen, zersplitterten Wertewelt besonders gefordert und stehen vor einem permanenten Entscheidungsdilemma. Sie müssen Antworten zu Fragen finden wie: Was legitimiert mich eigentlich dazu, andere zu führen, das heißt, ihnen mein Werteverständnis anzubieten und ihre Interessen in diesem Verständnis zu vertreten? Stimmen meine eigenen Überzeugungen mehr mit den Überzeugungen des Unternehmens, des unmittelbar Vorgesetzten oder mehr mit den Überzeugungen der Mitarbeiter und der Gewerkschaften überein? Wie weit kann ich noch die Philosophie meines Dienstherrn vertreten, ohne mein Gesicht zu verlieren? Ist Gewinnmaximierung, Gewinnoptimierung oder ein soziales Anliegen, wie der Erhalt von Arbeitsplätzen mit einem geringeren Gewinn, das Werte- und Zielsystem, das mein Unternehmen anstrebt und das ich vertreten kann? Wie viel darf ich von meinen ehrlichen Überzeugungen zeigen, um nicht allen Einfluss zu verlieren und entlassen zu werden – und wie viel muss ich zeigen, um nicht mein Gesicht und meine Selbstachtung zu verlieren?
All diese Fragen schwingen in der Routine des Alltagsgeschäfts mit, wenn Führungskräfte ihrer Aufgabe nachgehen. Energetisch stehen sie im Zentrum von unterschiedlichen Wertesystemen und Interessen. Es liegt nahe, dass Topmanager und Investmentbanker aktuell häufig mit einem unangemessen hohen Geldzufluss und einem negativen, ungerechten Wirtschaftssystem assoziiert werden. Dies beschreibt der ehemalige Vorstandsvorsitzende der BASF (Hambrecht, 2010): „Die Veränderungen, die sich jetzt auf der Erde zeigen, sind hoch komplex und es ist manchmal schwer, dies jedem zu erklären. Führungskräfte und Unternehmen können nicht mehr ihr Geschäft losgelöst von der Gesellschaft betreiben, sondern müssen die Menschen, besonders ihre Mitarbeiter, mitnehmen. Aber in der Öffentlichkeit wird ausschließlich von ihren Fehlern und dem Versagen geredet.“ Hambrecht antwortet auf die Frage: „Sind wir zu negativ?“ – „Die Kultur des Positiven ist nach 60 Jahren sozialer Marktwirtschaft verloren gegangen. So haben die Menschen das Gefühl, auf der Seite zu stehen, auf der es schlechter ist und dieses Gefühl wird dann transportiert.“
Diese Haltung zeigt sich in Selbst- und Fremdabwertung, in der Nichtbeachtung der eigenen Werte und der Werte des Anderen. Die natürlich gegebene Unterschiedlichkeit in den Wertesystemen wird nicht bewusst zum Anlass der Begegnung und konstruktiven Auseinandersetzung genutzt, sondern sie schwingt unterschwellig als Bedrohung bei den Interaktionen zwischen Personen, Gruppen, Unternehmen und ganzen Nationen mit. Abwertungsspiralen entstehen und führen zu Krisen, Krankheiten und Konflikten mit oft verheerenden Folgen (Simon, 2004).
Ein Beispiel für eine misstrauensbedingte Abwärtsentwicklung liefert uns die sich schon über viele Jahre hinziehende Finanzkrise.
Ein globales Wirtschaftssystem gerät ins Wanken, da seine tragende Säule, sein Wertesystem, eingebrochen ist. Das Geschäftsmodell der Kreditvergabe ist angewiesen auf die Kultur des Positiven – auf das überprüfte Vertrauen in den Geschäftspartner und seine Glaubwürdigkeit. Der internationale Finanzmarkt ist global umspannt von einem fein gewobenen Netz an persönlichen Kontakten, zwischen denen das wertvolle Gut „Vertrauen“ gehandelt wird. Wie sensitiv dieses Handelsnetz ist, zeigt sich an dem fatalen Dominoeffekt, der sich einstellt, wenn Negativität und Misstrauen die Handelsbeziehungen vergiften. Daher mag es auch wenig verwundern, dass die hastig zusammengeschnürten Unterstützungsangebote der europäischen Regierungen, wenn überhaupt, nur sehr schleppend die gewünschte Wirkung erzielen.
Vertrauen lässt sich nicht in Milliarden aufwiegen, sondern bedarf einer gezielten, Wert „schätzenden“ Auseinandersetzung mit der dahinterliegenden Wertestruktur aller Beteiligten. Und dies bedarf des Muts, das eigene Sagen, die eigene Theorie mit dem eigenen Verhalten und den schon selbsterworbenen Fähigkeiten abzustimmen.