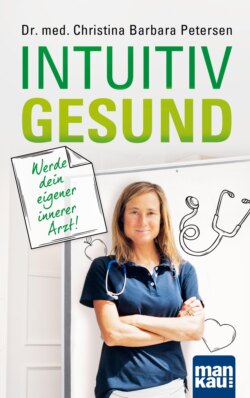Читать книгу Intuitiv gesund. Werde dein eigener innerer Arzt! - Dr. med. Christina Barbara Petersen - Страница 10
Der Burn-out-Prozess im Klinikalltag
ОглавлениеIn letzter Zeit gibt es viele Berichte darüber, wie es heutzutage in einigen Krankenhäusern läuft. Ich habe es selbst miterlebt, und da ich nicht den Eindruck habe, dass sich die Zustände in den Klinken verbessern, möchte ich gern mal genauer auf die Situation eingehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Spiegel-Artikel gelesen, der mich bis heute sehr bewegt. Es geht darin um eine junge Ärztin, die gerade in der Inneren Medizin auf der Notaufnahme angefangen hatte und von ihrem Klinikalltag berichtete. Insgesamt kommt rüber, dass sie überhaupt nicht zufrieden ist, schon der Titel sagt alles: »Was für eine Ärztin bin ich bloß geworden?«4
Aus meiner Sicht liest sich der Artikel auszugsweise wie einzelne Phasen eines Burn-out-Prozesses. Dieser ist in verschiedene Phasen gegliedert:
Phase 1: Freundlichkeit/(Über-)Idealismus
Phase 2: Überforderung (die meist nicht wahrgenommen wird)
Phase 3: Geringer werdende Freundlichkeit
Phase 4: Schuldgefühle
Phase 5: Vermehrte Anstrengung
Phase 6: Erfolglosigkeit
Phase 7: Hilflosigkeit
Phase 8: Hoffnungslosigkeit
Phase 9: Erschöpfung, Abneigung gegen Patienten, Mitarbeiter
Phase 10: Burn-out-Syndrom mit Selbstbeschuldigung, psychosomatischen Reaktionen und Fehlzeiten
Ich möchte diesen Prozess anhand des Artikels exemplarisch nachzeichnen. Der Name der Ärztin wird in dem Artikel übrigens nicht genannt, was dafür sprechen könnte, dass es ihr peinlich ist und/oder dass sie berufliche Nachteile fürchtet. Ich glaube, vielen Ärzten ist es unangenehm, Schwäche zuzugeben. Das kann ich vollkommen verstehen. Mir ging es ja auch jahrelang so. Ich freue mich einfach nur, dass sie sich überhaupt getraut hat, diesen Artikel zu veröffentlichen.
Als Erstes haben wir die Freundlichkeit (Phase 1): Es ist die Rede von einer jungen, optimistischen, enthusiastischen Ärztin, die frisch vom Studium kommt und eine gute Internistin werden will. Weiterhin schildert sie, dass sie nach einem Jahr Klinikalltag schon völlig desillusioniert ist.
Nach dem ersten Jahr geht es schon über in Phase 2, die Überforderung, die dann meist nicht wahrgenommen wird. Die junge Frau spricht von ihrem 24-Stunden-Dienst, der eigentlich ein Bereitschaftsdienst ist, in dem sie voll zu tun hat. Es ist nämlich so, dass sie nach dem regulären Arbeitstag als Stationsärztin noch bis zum nächsten Tag bleibt. Sie hat in dieser Zeit in der Notaufnahme sieben Patienten aufzunehmen, und gleichzeitig ist sie zuständig für mehrere Normalstationen mit über Hundert Patienten – und das wohlgemerkt als Berufsanfängerin. Da kann, glaube ich, jeder verstehen, dass sie damit überfordert ist. Diese Überforderung wird meistens auch zu spät wahrgenommen, denn erstens gibt es aufgrund des Personalmangels ja niemanden, der ihr helfen könnte, und zweitens könnte ich mir vorstellen, dass da ein Gefühl mitspielt von: Es muss doch gehen! Die Kollegen schaffen es doch auch! Stell dich nicht so an! Weiter spricht sie dann von einem ganz normalen Arbeitstag, an dem sie eine Notiz erhält, dass der Kollege krank sei. Sie hat also für 24 Patienten eine Stunde Zeit für die Visite.
Die junge Ärztin benutzt Worte wie »kämpft sich allein durch« und »hechelt sich durch die Visite«, was auch auf absolute Überforderung hinweist. Gleichzeitig entsteht Frust, denn für ein nettes Wort oder den Kontakt zu den Patienten bleibt kaum Zeit. Und bei einem Notfall auf Station (EKG-Veränderungen im Sinne eines Herzinfarktes) bekommt sie keinen Oberarzt zu fassen, weil gerade keiner Zeit hat. Hier hört man die Hilflosigkeit heraus: »Irgendwer muss mir doch helfen können?«
Nicht einmal die Schwestern kann die Frau fragen, denn die sind auch knapp besetzt und noch beim Waschen der Patienten.
Die Betroffene ergreift die Initiative und bringt den Patienten allein auf die Überwachungsstation. Sie benutzt Begriffe wie »abschieben«, das zeigt, dass sie Schuldgefühle entwickelt hat, also dass sie gern geholfen hätte, aber es in dem Moment als Anfängerin nicht allein konnte.
Nun kommen wir auch schon in Phase 3 der geringer werdenden Freundlichkeit. Die Ärztin schreibt, dass auf der Station Angehörige auf sie warten, weinen und mit ihr über Patienten sprechen wollen – an und für sich sehr wichtige Gespräche, wofür sie aber überhaupt keine Zeit hat, denn Visite und Notfälle haben Priorität.
Und nun zu Phase 4, den Schuldgefühlen: Die junge Frau schließt sich im Arztzimmer ein und weint. »Was für eine Ärztin bin ich geworden?« Keine Zeit mehr für Arzt-Patienten-Kontakt. Keine Zeit für Angehörige. Keine Zeit mehr für zwischenmenschliche Beziehungen. All das, was wesentlich zur Gesundung beiträgt, bleibt auf der Strecke. Weiter schreibt sie, dass sie die fleißig mithelfende Studentin, die noch im Lernprozess ist, bei Fragen immer wieder auf morgen vertröstet. Somit wird auch die Weiterbildung vernachlässigt. Und auch hier merkt man wieder die Schuldgefühle.
Jetzt kommen wir zu Phase 5 und 6, also vermehrter Anstrengung und Erfolglosigkeit. Bei der Visite fragt der Chef, warum ein 94-jähriger Patient noch nicht entlassen sei (dieser Patient hatte Schmerzen und konnte noch nicht allein nach Hause zurück).
Die Ärztin schreibt: Es geht nicht darum, gute Medizin zu machen, sondern viele Patienten durchzuschleusen und gute Zahlen zu bringen. Hier entsteht das Gefühl der Sinnlosigkeit und die Einschätzung, dass ihre Anstrengungen und Bemühungen umsonst sind.
Und es kommt zur 7. und 8. Phase der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sie schreibt: »Irgendwer muss mir doch helfen?«
Ein Kollege gibt ihr den Tipp, ihren Idealismus aufzugeben und sich ein dickes Fell zuzulegen. Das entspricht aber nicht ihrer Persönlichkeit, denn sie schreibt, dass sie es schrecklich findet, wenn sie bei den Aufnahmeuntersuchungen einfach die Fußpulse nicht tastet, weil für An- und Ausziehen keine Zeit da ist. In dieser Phase der Hilf- und Hoffnungslosigkeit befindet sich unsere junge Kollegin und überlegt, was sie tun soll. »Ist es das wert?« Sie suche einen Kompromiss, bei dem sie ihre Ideale nicht aufgeben muss. Sie liebe ihren Beruf, will aber weder Gesundheit noch Privatleben opfern.
Dieser Artikel spiegelt auch aus meiner Erfahrung und den Schilderungen anderer Kollegen und Kolleginnen sehr gut die Situation wider, wie es heutzutage in einigen Kliniken abläuft.