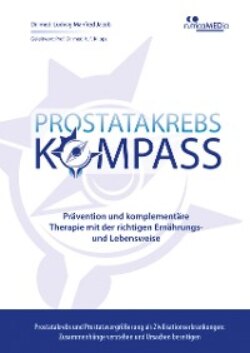Читать книгу Prostatakrebs-Kompass - Dr. med. Ludwig Manfred Jacob - Страница 44
3.8.4 Reduktion des Membranpotentials fördert die Krebsentstehung
ОглавлениеDas Membranpotential ist eine wichtige nicht-genetische, biophysikalische Eigenschaft des Tumormilieus (microenvironment), welche die Balance zwischen normalem Wachstum und Krebsentstehung reguliert. Bereits vor langer Zeit wurde ein Zusammenhang zwischen den bioelektrischen Eigenschaften eines Gewebes und der Entwicklung von Krebs vermutet (Burr et al., 1938; Burr, 1940). Clarence D. Cone Jr. unternahm in den 1960er Jahren eine Reihe bahnbrechender Experimente und entdeckte als Erster, dass sich das Membranpotential im Verlauf des Zellzyklus verändert. Er postulierte daraufhin, dass die Abweichungen in proliferierenden Zellen mit dem Fortschreiten des Zellzyklus von der G1- in die S-Phase und von der G2- in die M-Phase verbunden waren. In reifen Neuronen des zentralen Nervensystems wird durch eine verlängerte Depolarisierung der Zellmembran die Synthese von DNA ausgelöst und die Zellen treten erneut in die Mitose ein (Cone, 1971; Cone und Tongier, 1971). Außerdem wird auf diese Weise eine Überproliferation von Fibroblasten verursacht (Sundelacruz et al., 2008). Cone formulierte auf Basis dieser Beobachtungen seine Theorie über die Kontrolle von Mitose und Onkogenese (Cone, 1971).
Bekanntlich sind die meisten Krebsarten epithelialen Ursprungs, sie gehen also von Zellen aus, die ein konstantes Ruhepotential haben und keine Aktionspotentiale bilden wie Nerven- oder Muskelzellen. Durch das Ruhepotential nicht-erregbarer Zellen werden zelluläre Eigenschaften wie Proliferation, Migration und Form reguliert (Blackiston et al., 2009; Sundelacruz et al., 2009). Zudem wird durch endogene bioelektrische Signale gewährleistet, dass Vorgänge wie Regeneration (Levin, 2007 und 2009), Entwicklung (Adams, 2008; Levin, 2012a) und Wundheilung (Nuccitelli, 2003; McCaig et al., 2005 und 2009) koordiniert ablaufen. All dies sind Hinweise darauf, dass es sich bei Krebs um eine Entwicklungsstörung handelt, bei der Ionenflüsse und die sich daraus ergebenden Spannungsgradienten eine wichtige Rolle spielen. Diese beiden Parameter machen es möglich, das neoplastische Verhalten von Zellen vorherzusagen und zu kontrollieren (Huang et al., 2009; Levin, 2012b; Rubin, 1985).
Die proliferativen Fähigkeiten einer Zelle stehen mit der jeweiligen Membranspannung im Zusammenhang: Ruhende Zellen sind normalerweise hyperpolarisiert, stark proliferierende Zellen wie Embryonalzellen, Stammzellen und Krebszellen sind depolarisiert (Binggeli und Weinstein, 1986; Levin, 2007). Das Membranpotential ist dabei kein Korrelat, sondern ein ursächlicher Faktor in der Kontrolle von Wachstum oder Zelldifferenzierung.
Viele Studienergebnisse weisen mittlerweile darauf hin, dass Ionenkanäle und -pumpen in den Prozess der Krebsentwicklung involviert sind. Ein Beispiel dafür ist der Kaliumkanal EAG (ether à go-go), der häufig in Tumorzellen zu finden ist (Becchetti, 2011; Brackenbury et al., 2008; Kunzelmann, 2005; Pardo et al., 1999; Pei et al., 2003; Saito et al., 1998; Stühmer et al., 2006). Die Hemmung von Ionenkanälen stellt somit einen interessanten Ansatz für die Krebstherapie dar (Arcangeli et al., 2009 und 2012). Immer mehr Studien weisen darauf hin, dass für Ionenkanäle codierende Gene Onkogene sind (House et al., 2010; Onkal und Djamgoz, 2009; Pei et al., 2003; Roepke et al., 2010) und dass die Expression bestimmter Ionenkanäle in Tumoren verändert ist (Fiske et al., 2006; Schönherr, 2005).
Im Anfangsstadium der Tumorentwicklung reguliert das Membranpotential den Zellzyklus und bestimmt das Ausmaß der Zellproliferation (Blackiston et al., 2009). In der Xenopus-Kaulquappe wurde gezeigt, dass die Depolarisierung einer Zellpopulation zu einem Phänotyp führt, der einem metastasierten Melanom ähnlich ist. Dabei spielte es keine Rolle, welche Art von Ionenkanälen zur Depolarisierung der Zellen benutzt wurden – der Effekt war derselbe, wenn verschiedene Kanäle (Chlorid-, Kalium-, Natrium-, Protonenkanäle) in geeigneter Weise miteinander kombiniert wurden (Blackiston et al., 2011; Morokuma et al., 2008).
Auch neuere Daten zeigen, dass die Depolarisierung von Zellen Phänotypen auslöst, die Krebszellen ähneln (Blackiston et al., 2011; Morokuma et al., 2008). Lobikin et al. (2012) zeigten, dass im Krallenfroschmodell das Spannungspotential der Zellmembran der entscheidende Faktor in der Krebsentstehung und im Metastasierungsverhalten war. Durch die Depolarisierung von sogenannten „Instructor“-Zellen wurde in Melanozyten ein metastasenbildender Phänotyp induziert und die geordnete Bildung von Blutgefäßen gestört. Nur sehr wenige dieser „Instructor”-Zellen müssen für diesen Effekt depolarisiert werden (Lobikin et al., 2012).
Durch den Einsatz einer karzinogenen Substanz (4-Nitroquinolin-1-oxid) wurden lokalisierte Tumoren erzeugt. Gleichzeitig hatte die Substanz aber auch einen Effekt auf die bioelektrischen Eigenschaften des ganzen Körpers. Dieser Effekt äußerte sich in dem ungewöhnlich hohen Natriumgehalt von Onkogen-induzierten Tumoren, der zur nicht-invasiven Diagnostik herangezogen werden kann. Durch die Expression hyperpolarisierender Ionenkanäle konnte die Tumorentstehung signifikant reduziert werden (Lobikin et al., 2012).
Es konnte auch gezeigt werden, wie klassische Onkogene über eine Veränderung des Zellmembranpotentials die Tumorentwicklung anstoßen. Depolarisierte Zellmembranen waren für das induzierte Tumorwachstum typisch und weisen darauf hin, dass das Spannungspotential der Zellmembran eine funktionelle Rolle in der Wirkung von Onkogenen auf die maligne Transformation von Zellen hat (Chernet und Levin, 2013).
Die Behandlung mit Butyrat führt bei Krallenfrosch-Kaulquappen, denen ein Onkogen injiziert wurde, zu einer reduzierten Inzidenz tumorähnlicher Strukturen. In einer Studie wurde gezeigt, dass durch eine Hyperpolarisierung höhere intrazelluläre Butyrat-Konzentrationen erreicht werden. D. h., dass der Einstrom von Butyrat in die Zelle an das Membranpotential gekoppelt ist (Chernet und Levin, 2013). Eine weitere Studie zeigt, dass der vom Membranpotential abhängige Transport von Butyrat über den sogenannten SLC5A8-Transporter erfolgt (Gopal et al., 2004).
Butyrat ist ein potenter Entzündungsmodulator und schützt vor Dickdarmkrebs, weil es unter anderem die Histondeacetylase (HDAC) hemmt. Es kann damit auch wirkungsvoll synergistisch mit Chemotherapien wirken. In Dickdarmkrebszellen wurde eine verminderte Expression des SLC5A8-Transporters festgestellt, was mit einer reduzierten Aufnahme von Butyrat in die Zellen verbunden ist (Coady et al., 2004; Gupta et al., 2006; Miyauchi et al., 2004). Bei einer Fastenketose entsteht vermehrt Hydroxybutyrat, das möglicherweise ähnliche Wirkungen wie Butyrat hat.
Studien weisen zudem auf positive Effekte von Butyrat auf Prostatakrebszellen hin. In einer Studie von Mu und Kollegen (2013) führte die Behandlung von Prostatakrebszellen mit Butyrat zu einer Wachstumshemmung der Zellen. Gleichzeitig wurde die Apoptoserate der Zellen gesteigert. Einer weiteren Studie zufolge sind die Effekte von Butyrat auf die Expression und die Transkriptionsaktivität des Androgenrezeptors (AR) unterschiedlich, je nachdem ob es sich bei den behandelten Zellen um Prostatakrebszellen oder um normale Prostatazellen handelte. Auch Coregulatoren des AR wurden unterschiedlich reguliert: In Prostatakrebszellen hatte Butyrat einen Einfluss auf deren Expression, die transkriptionale Aktivität und die Acetylierung von Histonen, während dieser Effekt in normalen Zellen nur sehr klein war (Paskova et al., 2013). Damit wirkt Butyrat spezifisch gegen Krebszellen.