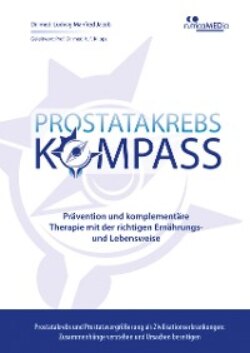Читать книгу Prostatakrebs-Kompass - Dr. med. Ludwig Manfred Jacob - Страница 45
3.8.5 Übersäuerung als Kausal- und Cofaktor des Krebsgeschehens
ОглавлениеNaturheilkundliche Ärzte behaupten seit Jahrzehnten, dass eine Azidose die Entstehung von Krebs fördert. Inzwischen ist die klinische Bedeutung der latenten Azidose wissenschaftlich gut belegt (z. B. Pizzorno et al., 2010). Wenig bekannt ist jedoch über die Interaktion von Übersäuerung und Krebs.
Eine Depolarisierung des Membranpotentials kann insbesondere durch eine Übersäuerung des Bindegewebes verursacht werden, da hierbei zunehmend intrazelluläre Kalium-Ionen gegen Protonen getauscht werden und es zu einer intrazellulären Natriumansammlung kommt. Ein saures Milieu schwächt normale Zellen, fördert aber aggressive Krebszellen. Aufgrund des Warburg-Effektes (aerobe Glykolyse) und der mangelnden Durchblutung entwickeln Zellen solider Tumoren eine extrazelluläre Azidose und eine Gewebshypoxie. Hierbei korreliert das Ausmaß der Milchsäureproduktion positiv mit der Malignität und der Radio-/Chemotherapieresistenz des Tumors sowie mit einer schlechten Prognose (Sattler et al., 2007; Walenta und Mueller-Klieser, 2004). Eine Ausleitung der Milchsäure, die den Tumor vor Immunabwehr, Radio- und Chemotherapie schützt und die Invasion fördert, ist ein zentraler Bestandteil der Krebstherapie.
Messungen bestätigen, dass eine Azidose für die interstitielle Gewebsflüssigkeit solider Tumoren charakteristisch ist. Die meisten Tumoren weisen pH-Werte in einem Bereich von 6,5 - 7,0 auf, es wurden aber auch schon niedrigere Werte von bis zu pH 5,8 gemessen (Tannock und Rotin, 1989).
Ein exzellentes Review von Glitsch (2011), einer deutschen Wissenschaftlerin an der Oxford University, untersucht die These, nach der extrazelluläre Protonen (extrazelluläre Übersäuerung) zur Krebsprogression beitragen. Demnach fördern erhöhte Säurekonzentrationen das Überleben unter den für normale Zellen zunehmend feindlichen Bedingungen der Krebsentwicklung. Die durch die Protonen ausgelöste Expression bestimmter Gene bewirkt eine Aktivierung und/oder Potenzierung von membranständigen Rezeptoren und Kanälen für Protonen. Auf diese Weise kann die Zelle das saure Milieu messen. Zudem wird eine Modulation intrazellulärer Calciumsignalwege ausgelöst (Glitsch, 2011). Die Erhöhung von intrazellulärem Calcium begünstigt die Zellproliferation. Eine Studie an Zellkulturen aus Prostatektomien zeigt, dass in calciumarmen Nährmedien keine Krebszellen, sondern normale Zellen heranwachsen (Dalrymple et al., 2005). Diese Beobachtung erklärt auch, warum viele Krebserkrankungen gerne im Knochen metastasieren: Der Krebs braucht Calcium.
In Studien an prostatischen Tumorzellen konnte gezeigt werden, dass eine metabolische Azidose auch unter normaler Sauerstoffversorgung und normalen Blutzuckerwerten die chemoresistenten Eigenschaften der Zellen erhöht (Sauvant et al., 2008; Thews et al., 2006). Sauvant und Kollegen (2008) stellten in ihrer Studie fest, dass durch die extrazelluläre Azidose eine Aktivierung der MAP-Kinase p38 ausgelöst wurde. Dies führte zu einer erhöhten Aktivität des Phosphoglykoproteins P-gp, einem Transporter, der zytotoxische Stoffe aus der Zelle transportiert.
Eine extrazelluläre Gewebsübersäuerung führt bei Prostatakrebszellen zu einer verstärkten Bildung von Sauerstoffradikalen in den Mitochondrien. Aber auch verschiedene Krebssignalwege werden nach oben reguliert, insbesondere durch Phosphorylierung und damit einhergehender Aktivierung der MAP-Kinasen p38 und ERK1/2. Durch die Azidose wird die Natrium-Kalium-Pumpe gehemmt. Dies kann durch eine veränderte Homöostase der Elektrolyte oder durch einen EGFR-Signalweg zur Aktivierung von MAP-Kinasen beitragen. Der Transkriptionsfaktor CREB bleibt auch nach Beendigung der Azidose dauerhaft aktiviert (Riemann et al., 2011).
Das saure Milieu begünstigt die Metastasierung
Der Phänotyp der Tumorzellen beruht nicht nur auf der genetischen Bestimmung, sondern auch auf dem umgebenden Milieu (microenvironment). In einem Tumormodell wurde das Maß der Übersäuerung als der entscheidende Schritt vom lokalisierten Tumor zur aggressiven Invasion ermittelt (Patel et al., 2001).
Im Laufe der Karzinogenese entwickeln Tumorzellen eine Resistenz gegenüber der säureinduzierten Toxizität. Auf diese Weise können sie in einem sauren Milieu überleben und proliferieren (Gatenby et al., 2006). Dafür besitzen sie verschiedene Transporter, die es ihnen ermöglichen, ihren intrazellulären pH-Wert in einem physiologischen Bereich zu halten: Monocarboxylat-Transporter für die Entfernung von Laktat sowie hochaktive Natrium-Protonen-Antiporter, Bikarbonat-Transporter und ATPasen vom V-Typ für die Entfernung von Protonen. Da sich Krebszellen dem sauren und sauerstoffarmen Milieu angepasst haben, können sie dort besser überleben als normale Zellen, die sterben, wenn sie diesen Bedingungen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind. So wird die Entwicklung und Metastasierung von Krebs durch ein azidotisches und sauerstoffarmes Milieu gefördert (Glitsch, 2011).
Normales Gewebe, das um einen Tumor herum lokalisiert ist, wird durch das ständige Einwirken eines sauren Milieus zerstört. Dies erfolgt einerseits dadurch, dass der Protonengradient über der Zellmembran zusammenbricht, was zum Zelltod durch Nekrose oder Apoptose führt. Andererseits werden im sauren Milieu verstärkt proteinabbauende Enzyme freigesetzt, die die extrazelluläre Matrix der Zellen zerstören. Die extrazelluläre Azidose fördert zudem die Angiogenese und schützt die Krebszellen vor dem Immunsystem (Gatenby et al., 2006).
In einer Studie wurde gezeigt, dass Melanomzellen in einem sauren Milieu eine veränderte Genexpression aufweisen und hochinvasive Tumorzellen bilden (Moellering et al., 2008). In einem Mausmodell von metastasierendem Brustkrebs konnte dagegen durch eine Alkalisierung (Erhöhung des pH-Wertes) des Tumors die Metastasenbildung reduziert werden (Robey et al., 2009).
In einem sauren Milieu setzt der Körper vermehrt entzündungsfördernde Substanzen wie NF-kappaB, TNF-alpha und COX-2 frei, was zu einem beschleunigten Knochenabbau beiträgt (Frick et al., 2005; Krieger et al., 2007) und ein insgesamt proentzündliches, tumorfreundliches Milieu schafft. Änderungen im pH-Wert können zur Aktivierung von MAP-Kinasen führen (z. B. PKA, PKB, PKC, c-Src oder EGFR) und dadurch Krebssignalwege nach oben regulieren (McCubrey et al., 2007).
Das moderne Prinzip der Tumornische erinnert an die Bedeutung des Grundsystems und der extrazellulären Matrix, wie von Pischinger und Heine (2004) beschrieben. Die extrazelluläre Matrix reguliert die Feldbedingungen, Entzündungsprozesse und das zelluläre Abwehrsystem, das für die Erkennung und Zerstörung von Tumorzellen verantwortlich ist. Die extrazelluläre Matrix dient mittels ihres PG/GAG-Hydrogels auch als Sammelbecken überschüssiger Säure, die während der physiologischen postprandialen Basenflut abtransportiert wird. Die extrazelluläre Matrix reguliert also genau die Faktoren, die für die Tumorentstehung wesentlich sind. Die Erstarrung von Grundsubstanz und Grundregulation ist laut Heine und Pischinger Voraussetzung für die Entstehung von Krebs und chronischen Krankheiten. Übersteigen freie Radikale, Säuren, Fette und Zucker die Pufferkapazität der Grundsubstanz, dient diese nicht mehr als physiologisches „Zwischenlager“, sondern als „Mülldeponie“. Gegenmaßnahmen sind insbesondere regulationstherapeutische Verfahren wie z. B. die Säure-Basen-Regulation, Leberentlastung und Bewegungstraining. Auch die Ganzkörper-Hyperthermie hat nicht nur direkte Antitumoreffekte, sondern dient auch der „Milieubereinigung“.
Indirekte Einflüsse der ernährungsbedingten Azidose
Ein Review von Robey (2012) thematisiert die indirekten Einflüsse der ernährungsinduzierten, niedriggradigen, metabolischen Azidose auf die Krebsentstehung, wozu erhöhtes Cortisol, IGF-1, Leptin sowie erniedrigtes Adiponektin und eine erhöhte Osteoklastenaktivierung (Knochenabbau) zählen (Robey, 2012). Doch die Effekte dürften noch weiter gehen, denn eine Azidose des Gewebes begünstigt die Krebsentstehung auch, indem sie Krebssignalwege nach oben reguliert und das Membranpotential der Zellen reduziert. Die Übersäuerung des Interstitiums fördert einen intrazellulären Kaliummangel und eine Überladung mit Natrium und Calcium. Diese Faktoren führen zu einer Reduktion des Membranpotentials, welches die Differenzierung und Proliferation von Zellen steuert (vgl. Kapitel 3.8.4, Seite 55).