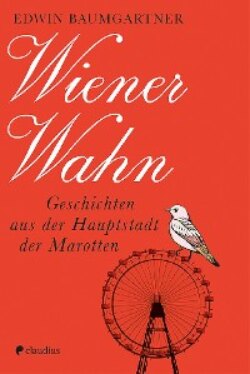Читать книгу Wiener Wahn - Edwin Baumgartner - Страница 8
DER PIWONKA
ОглавлениеJetzt muss ich Ihnen was erzählen, und zwar über den Piwonka.
Dabei weiß ich gar nicht viel über den Oskar Piwonka, aber das bisserl, das ich weiß, ist es wert, einen Zuhörer zu finden. Ich selber hab’ es von der Friedl Dallabona erfahren, die ich immer nur Tante Friedl genannt habe, obwohl sie keine Verwandte gewesen ist, sondern die Freundin meiner Großmutter mütterlicherseits.
Aber bevor ich Ihnen was über den Piwonka erzähle, muss ich Ihnen was über die Gemeindebauten erzählen, sonst haben Sie nichts davon, von der Geschichte über den Piwonka, meine ich.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist Wien eine kranke Stadt gewesen. Durch den Krieg sind ja die Kronländer verloren gegangen. In ihnen ist der Nationalismus erwacht. Entweder hat man die Alt-Österreicher vertrieben, oder sie sind von selber gegangen, weil sie gewusst haben, dass sie nicht mehr Fuß fassen können in Prag, in Brünn oder in Budapest. Natürlich sind sie in die Hauptstadt gezogen in der Hoffnung, dass sie sich dort durchschlagen können. Schließlich, haben sie gedacht, sind sie Landsleute, und Landsleuten werden die Wiener schon helfen.
Die Wiener haben aber nicht helfen können. Die Wiener haben nämlich selbst nichts gehabt. Die Nachwirkungen des Krieges haben einen Versorgungsengpass heraufbeschworen, eine richtige Hungersnot. Durch den Zuzug der Vertriebenen und der Auswanderer ist Wien aus allen Nähten geplatzt. Manche Historiker schätzen, dass mehr als zwei Millionen Menschen in der Stadt gewohnt haben, die damals gerade etwas mehr als eineinhalb Millionen verkraftet hätte. Dann ist die spanische Grippe ausgebrochen, und der Tod hat ein großes Fest gefeiert – aber das erzähle ich Ihnen später.
Jedenfalls haben die Sozialisten begriffen, dass es so nicht weitergehen kann in Wien, weil eine Stadt immer nur so gesund ist wie ihre Bevölkerung und umgekehrt. Bei den Wahlen im 1918er-Jahr haben die Sozialisten in Wien die absolute Mehrheit erreicht gehabt. Jetzt beginnen sie mit einem großen Experiment. Sie haben der Revolution abgeschworen – Revolutionen sind sowieso nie was gewesen für die Wiener, das sieht man schon an den lahmen Versuchen vom 1848er-Jahr. Die Wiener Sozialisten haben darauf gesetzt, dass sie die Wiener überzeugen können. Sie haben sich vorgenommen, Wohnungen für alle zu bauen und allen ärztliche Versorgung und Bildung zu ermöglichen.
Das Bauen ist an vorderster Stelle gestanden. Der Wiener Gemeindebau hat Schule gemacht. Aus der ganzen Welt sind Architekten und Stadtplaner nach Wien gekommen, um sich anzuschauen, was da entstanden ist und entsteht. Diese Gemeindebauten, Höfe genannt, sind irgendwie die Burgen und Schlösser des Sozialismus. Nach den damals neuesten Erkenntnissen sind sie gebaut worden mit hellen Wohnungen und großen Flächen in den Innenhöfen, viele davon begrünt oder mit Brunnen ausgestattet, was im Sommer die Temperaturen senkt.
Aber das Leben im Gemeindebau hat auch Schattenseiten gehabt. Eine davon ist gewesen, dass nur Frauen in die Waschküchen gedurft haben. Die Zeiten sind für jede Mieterpartei genau geregelt gewesen. Für eine Mutter hat das ziemlich unangenehm sein können, denn was soll sie in ihrer Waschzeit mit den Kindern machen? Da ist sie auf Fremdbetreuung angewiesen gewesen.
Ein anderes Kuriosum sind die Kontrollore gewesen. Ihnen hat man jederzeit die Tür öffnen müssen. Die Kontrollore sind immer unangemeldet gekommen. Sie haben nachgeschaut, ob die Wohnung sauber ist und zusammengeräumt und auch, ob die Möbel passen. Nicht jedes Möbelstück ist akzeptiert worden. Es hat so eine Art Ideal-Einrichtung gegeben, von der die Mieter nicht viel abweichen haben dürfen. Wenn die Kontrollore etwas gefunden haben, was zu beanstanden gewesen ist, dann haben sie die Mieter verwarnt, eine entsprechende Notiz gemacht, und wenn das Beanstandete bei der nächsten Kontrolle nicht behoben gewesen ist, hat das Folgen haben können. Zum Beispiel hat man Frauen, die nicht ordentlich aufgeräumt oder die Wohnung nicht genügend sauber gehalten haben, in Putzkurse geschickt.
Damit komme ich zum Oskar Piwonka, wie ihn mir die Tante Friedl geschildert hat.
Der Piwonka ist solch ein Kontrollor gewesen. Im Ersten Weltkrieg hat er an der französischen Front gekämpft und dabei ist er an der rechten Hand verletzt worden. Nach dem Krieg ist er Kontrollor in Sandleiten gewesen, dem größten und ehrgeizigsten Gemeindebau von Wien, in dem auch die Tante Friedl mit ihrem Mann gewohnt hat. Es hat ein paar Kontrollore gegeben. Für die Tante Friedl ist der Piwonka zuständig gewesen.
Was soll ich Ihnen über die Tante Friedl und ihren Mann, den Hans Dallabona, erzählen, den ich nie kennengelernt habe, weil er lange, bevor ich zur Welt gekommen bin, gestorben ist? Der Hans hat bei den Wiener Elektrizitätswerken gearbeitet, die Tante Friedl ist eine Hausfrau gewesen, wie es damals üblich gewesen ist. Beide waren sie aus gutbürgerlichen Familien, die aber im Ersten Weltkrieg fast alles verloren haben. Dennoch ist die Tante Friedl ihr Lebtag lang eine Kaisertreue geblieben. Kennengelernt haben die beiden einander in einer Aufführung von der „Lustigen Witwe“ vom Franz Lehár noch vor dem Krieg. Wie der Hans dann zurückgekommen ist, haben die beiden geheiratet. Und heilfroh sind sie gewesen, wie sie eine Gemeindewohnung bekommen haben.
Die Tante Friedl nun ist nicht schlampig gewesen, und der Hans auch nicht. Die beiden haben nur andere Interessen gehabt, als die Wohnung aufzuräumen. Die Tante Friedl ist narrisch nach Operette und Theater gewesen, der Hans auch und nach Büchern obendrein. Besonders verehrt haben die beiden den „Faust“ vom Goethe. Der Hans hat sogar richtige „Faust“-Studien betrieben und jeden Groschen, den er nicht für das tägliche Leben und das Theater ausgegeben hat, in Bücher gesteckt, die sich mit dem „Faust“ befasst haben.
Der Piwonka also kommt eines Tages zwecks Kontrolle. Er klopft an, die Tante Friedl öffnet ihm, es bleibt ihr nichts anderes übrig. Der Hans ist in der Kanzlei. Der Piwonka sieht, dass die Wohnung nicht ordentlich aufgeräumt ist. Er ist kein besonders großer Mann, der Piwonka, und ziemlich mager ist er, und was am meisten hervorsticht, ist eine Nase, die ihm aus dem Gesicht springt wie der Dolch, den der Brutus gegen den Caesar gezückt hat. Die Stimme vom Piwonka ist hoch und schnarrend und alle paar Wörter streut er ein Äh ein, ob es an der Stelle passt oder nicht.
„Des is owa, äh, a Sauhaufn, Frau Siebeat“, sagt der Piwonka. „Des gfoed ma, äh, goa net. Schaun S, Frau Siebeat, äh, so geht des net“, schnarrt der Piwonka. „Vastengan S mi“, schnarrt der Piwonka, „i maan des net bees, äh, weu, wia kummat i dazua. Owa i muaß a, äh, Vawoanung ausschbrechn, äh, und i wiad se bittn“, schnarrt der Piwonka, „des ollas in Uadnung z bringan, dass ma kane Diffarenzn hom bein nexdn Moe“, schnarrt er und verschwindet.
Die Tante Friedl ist ganz desparat23. Ordnung machen, nimmt sie sich vor. Schade, eigentlich, denn jetzt weiß sie genau, wo was liegt, und der Hans weiß es auch. Nur, erinnert sie sich, wie sie das letzte Mal Ordnung gemacht hat, haben sie und der Hans nachher gar nichts mehr gefunden.
Am Abend erzählt sie dem Hans die Geschichte, und der Hans sagt, das sei doch kein Problem, sie soll beim nächsten Mal einfach freundlicher sein zum Piwonka, ihm einen Kaffee anbieten oder ein Stamperl24 Schnaps oder beides.
Dauert nicht lang, der Hans ist wieder in der Arbeit, kommt der Piwonka. Noch bevor er irgendwas sagen kann, fragt ihn die Tante Friedl, ob er vielleicht ein Häferl Kaffee will oder ein Stamperl Schnaps. Der Piwonka ist dem Schnaps nicht abgeneigt. Er kippt das Stamperl mit einer Inbrunst, als würde er es noch mit der Zunge ausschlecken, vielleicht macht er das auch, bedankt sich, und dann schnarrt er los, was alles nicht in Ordnung ist und dass die Wohnung ein Sauhaufen ist, und wenn sich nichts ändert, dann sieht er schwarz, dann muss die Tante Friedl in einen Putzkurs.
Die Tante Friedl ist noch desparater als bei ersten Mal. Sie erzählt am Abend alles dem Hans, und der Hans sagt, die Tante Friedl soll halt dem Piwonka zum Stamperl Schnaps ein Schmalzbrot anbieten, das wird schon was nützen.
Genau so macht’s die Tante Friedl. Der Piwonka verschlingt das Brot mit dem Grammelschmalz, als hätte er mindestens drei Tage nichts gegessen. Dann schlürft er das Stamperl Schnaps, die Tante Friedl glaubt schon, dass er das Schnapsstamperl gleich samt dem Schnaps schluckt, und dann schnarrt der Piwonka los, dass er bei dem Sauhaufen wirklich nicht mehr beide Augen zudrücken kann, „des geht nimma, san S ma eh net bees, äh, i muaß des mochn, es is hoed a Vuaschrifd“, schnarrt der Piwonka und wedelt der Tante Friedl drohend mit dem Mittelfinger vor der Nase, weil ihm der Zeigefinger, mit dem man normalerweise drohen würde, im Krieg weggeschossen worden ist. „Des is jetzd wiaklech des, äh, ollaletzde Moe“, schnarrt der Piwonka, „bein nexdn Moe san S, äh, in Putzkuas, äh, so laad s ma duat“, schnarrt der Piwonka mit dem Ringfinger wedelnd.
Die Tante Friedl weiß sich keinen Rat mehr, und der Hans auch nicht, also muss man doch ans Ordnungmachen gehen.
Am Wochenende haben die beiden keine Lust dazu, am Montag mag die Tante Friedl nicht, und am Dienstag verschiebt sie die freudlose Arbeit auf Mittwoch. Allerdings steht der Piwonka schon am Dienstagabend wieder vor der Tür. Diesmal macht ihm der Hans auf. „Kontrolle“, schnarrt der Piwonka und schiebt sich an ihm vorbei. Die Tante Friedl kommt nicht einmal dazu, dem Piwonka ein Stamperl Schnaps und ein Grammelschmalzbrot anzubieten, fängt der Piwonka gleich zu schnarren an, jetzt sei, äh, der Putzkurs fällig, daran führe, äh, kein Weg vorbei. Das ganze Bitten von der Tante Friedl nützt nichts. Der Hans resigniert gleichfalls. Er legt der Tante Friedl die Hand auf die Schulter und singt sozusagen tröstend vor sich hin: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“25
Da geht ein Ruck durch den Piwonka. „Des is aus da ,Fledamaus‘“, schnarrt er ohne ein einziges Äh. Und dann stimmt er an: „Bist du’s, lachendes Glück“, und so schnarrend seine Stimme beim Sprechen ist, so geschmeidig klingt sie, wenn er singt. „Das ist aber ,Der Graf von Luxenburg‘ vom Lehár“, sagt der Hans.
„Sowieso“, sagt der Piwonka. Dann singt er die ganze Nummer so schön vor, dass der Lehár seine Freude dran hätt’.
„An Ihnen ist ein Tenor verloren gegangen“, sagt der Hans.
„I woet, äh, Schauschbüla wean“, schnarrt der Piwonka, „owa mia hom ka Gööd ghobd fia goa nix. Jetzd schleich i mi maunchmoe ins Buagdeata eine oda, äh, in a aundas Deata. Wissen S, fia mi is da ,Faust‘ des greßte.“
Jetzt geht ein Ruck durch den Hans. „Für mich auch“, sagt er und beginnt:
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein;
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.
Der Piwonka schnarrt: „Ostaschbaziagang. Kenn i.“ Und dann fährt er mit seiner schönen Stimme, mit der er gesungen hat, und in fast makellosem Hochdeutsch, dem man nur an manch einem Wort den Angehörigen der Arbeiterklasse anhört, mit dem Wagner fort:
Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren,
Ist ehrenvoll und ist Gewinn;
Doch würd’ ich nicht allein mich her verlieren,
Weil ich ein Feind von allem Rohen bin.
„I kaun den ,Faust‘ auswendig“, schnarrt der Piwonka, „hoed net gaunz, valleicht, owa fost.“
Was sich daran anschließt, ist keine Belehrung über Ordnung. Die drei unterhalten sich über das Theater und über Operetten, sie streuen Monologe ein und singen Melodien an, und alles geht durcheinander, weil allen der Mund übergeht, und der Piwonka ist selig, weil er endlich jemanden gefunden hat, mit dem er über seine geheime Leidenschaft reden kann, und die Tante Friedl ist selig und der Hans ist auch selig, weil sie unter ihren Freunden und in ihren Familien niemanden haben, mit dem sie ihre Freude an Operette und Theater teilen haben können.
Dann aber stellt zu guter Letzt die Tante Friedl doch die bange Frage, was jetzt mit der Ordnung und dem Putzkurs ist. „A wos“, schnarrt der Piwonka, „owa san S so guat und mochn S, äh, wiaklech sauwa, weu i söwa kaun zwoa a Äugal zuadruckn, owa waun a aundara kummt, dea waaß von ana Faust nua, wia ma s auffehoet26.“
Die Tante Friedl hat dann wirklich saubergemacht und ein bisserl aufgeräumt. Ab und zu ist sie unterwegs, auf dem Areal von Sandleiten, dem Piwonka begegnet. Meistens hat er ganz normal gegrüßt mit „Hawe d Ehre“, aber wenn er sozialistisch gegrüßt hat mit der Faust, hat die Tante Friedl gewusst, dass er auf eine Inspektion vorbeikommt. Dann hat sie die mittlerweile blitzblanke und aufgeräumte Wohnung noch ein bisserl sauberer gemacht. Und bei den Inspektionen hat der Piwonka nie wieder auch nur herumgeschaut, sondern hat sich gleich in Positur geworfen und eine Operettennummer gesungen oder eine Stelle aus dem „Faust“ zum besten gegeben.
Wie dann die Nationalsozialisten gekommen sind, hat sich ihnen der Piwonka zuerst begeistert angeschlossen, aber es hat nicht lang gedauert, und er ist in den Widerstand gegangen, so wie der Hans, der auf einem Aug blind von der Front zurückgekommen ist. Nach dem Krieg ist der Piwonka zu den Kommunisten gegangen, weil er in ihnen die Garanten gegen ein Wiedererwachen des Nationalsozialismus gesehen hat, und der Hans und die Tante Friedl sind für die Amerikaner gewesen, weil sie der Auffassung waren, das stärkste Gegengift gegen den Nationalsozialismus ist die Demokratie. Aber die drei haben sich weiter getroffen und ihre eigenen Operetten- und „Faust“-Abende veranstaltet. Richtige Freunde sind sie geworden über alle Gegensätze und Grenzen hinweg.
Apropos Tante Friedl und kaisertreu: Also die Kaiser – ich sage Ihnen …