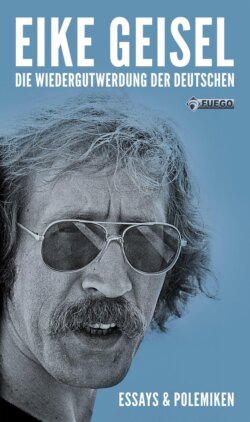Читать книгу Die Wiedergutwerdung der Deutschen - Eike Geisel - Страница 14
Sein Name ist ein Ärgernis Zur Kampagne des deutschen Feuilletons gegen Marcel Reich-Ranicki
ОглавлениеMeine Damen und Herren,
wären die militärischen Verschwörer vom 20. Juli erfolgreich gewesen und nicht die Alliierten, dann würden wir uns weder heute Abend hier einfinden können, noch gäbe es den Anlass zu dieser Veranstaltung. Es gäbe keine Medienkampagne gegen den Literaturkritiker, und zwar deshalb nicht, weil es Marcel Reich-Ranicki nicht gäbe, jedenfalls nicht in Deutschland.
Die letzten Juden Europas, derer die Nazis damals noch habhaft werden konnten, wurden gerade in die Gaskammern gejagt, da verständigten sich die Verschwörer auf einen älteren Plan zur Lösung der Judenfrage. Denn auch sie wollten eine Judenfrage lösen. Die Juden sollten aus Europa nach Kanada oder Südamerika verfrachtet werden. Dieser Plan war in Eichmanns Schublade verschwunden, nachdem die Nazis sich entschlossen hatten, es sei besser, die Juden umzubringen, statt sie zu verjagen. Die Juden, oder was von ihnen übrig war, sollten weggeschafft werden, denn die Welt, so die Auffassung der Verschwörer, käme nicht eher zur Ruhe, bis nicht eine globale »Neuordnung der Stellung der Juden« erreicht sei. Auch deutsche Offiziere fänden dann endlich wieder den inneren Frieden, den die Ermordeten gestört hatten. Durch ihre Abschiebung nach Übersee hätten die Juden keine Gelegenheit mehr, Anlass der moralischen Kränkung der Soldatenehre zu sein. Wie sehr Juden in ihrer Eigenschaft als Kandidaten der Ermordung durch SS und Wehrmacht deutschen Offizieren zusetzten, welch unerträgliche Belastungen die Opfer den Tätern aufluden, ja wie geradezu die Täter sich opferten, wenn sie Tote herstellten – von dieser Selbstlosigkeit zeugt nicht nur jene berühmte Rede Himmlers, der 1944 davon gesprochen hatte, dass deutsche Soldaten trotz all dieser Zumutungen anständig geblieben seien. Von General Speidel, dessen Name für die Kontinuität von Wehrmacht und Bundeswehr steht, ist aus dem Jahr 1950 die Auskunft überliefert, dass in Wahrheit nicht die Opfer, sondern die Vollstrecker des Verbrechens gelitten hatten. Über den hingerichteten Mitverschwörer General Carl-Heinrich von Stülpnagel, der an der Ostfront einen »vermehrten Kampf gegen das Judentum« befohlen hatte, über Stülpnagels Einordnung und frühes Leid erklärte Speidel: »Bei seinem hohen ethischen Grundgefühl empfand er das Amoralische des Systems als ständiges seelisches Martyrium.« Damit diese Leidensgeschichte ein Ende hätte, sollten die Juden weg. Reich-Ranicki hätte keine Chance gehabt – ab nach Kanada oder Chile; selbst die Ausnahmebestimmungen, über welche die Verschwörer penibel nachgedacht hatten, hätten ihm damals nicht geholfen. Nur Juden, deren Familie schon über mehrere Generationen in Deutschland ansässig waren, sollten bleiben dürfen, oder jene, die sich um Deutschland verdient gemacht hatten. Aber Reich-Ranickis unheilbare Liebe zur deutschen Kultur hatte damals noch vornehmlich darin bestanden, dass er las und noch nicht publizierte, dass er also noch nicht zum »Verdienstjuden«, wie es bei den Nazis geheißen hatte, avanciert war. Genau unter der Berufung auf diese Anstrengung, Reich-Ranicki habe einen wichtigen Beitrag zur deutschen Kultur geleistet, verteidigten manche den Angegriffenen gegen die Infamien des deutschen Feuilletons.
Von Tucholsky, der andere Daten deutscher Traditionsfindung kommentierte, stammt die treffende Bemerkung: »Nie geraten die Deutschen so außer sich, wie wenn sie zu sich kommen wollen.« Heute wollen sie wieder. Es soll historisch zusammenwachsen, was wirklich zusammengehört, denn nach der geschichtlichen Vorlage ist auch das Modell der Identität gebildet, das nun vom Stapel laufen soll. Die negative Abgrenzung nach außen korrespondiert mit der positiven Bindung nach innen und dem Anschluss der Vergangenheit. Deren Dioskuren oder doppeltes Lottchen heißen Schindler und Stauffenberg, oder auf einen Nenner gebracht: »der gute Nazi«. Doch wie damals, als der identische Deutsche um sein seelisches Gleichgewicht gebracht wurde, so stören die Juden auch heute den Frieden, der mit der Geschichte gemacht werden soll. Ansonsten umworben und für die Imagepflege Deutschlands bei jeder sich bietenden offiziellen Gelegenheit ins Rampenlicht geschleift, sind die Juden anlässlich der Ausrufung des »anderen Deutschland« auf eigentümliche Weise abwesend. Sie jedenfalls haben nicht vergessen, dass dieses »andere Deutschland« noch, wie Hannah Arendt es einmal formuliert hat, »durch einen Abgrund von der zivilisierten Welt getrennt war«. Und diesen Abgrund nimmt man den Juden übel. Sie hätten ein Problem mit dem 20. Juli, beschwerte sich der Sohn des Hitler-Attentäters, als der Vorsitzende des Zentralrats der Juden vorsichtig auf diesen Abgrund hinwies. Stauffenberg junior kann Bubis freilich nicht verzeihen, dass die Mehrzahl der militärischen Verschwörer ganz ordinäre Antisemiten waren. Für den Umstand, dass darüber beim offiziellen Gedenken nicht die Rede sein soll, wird man seit einiger Zeit ausführlich entschädigt. Dem Schweigen über die Vorgeschichte, die Motive und Pläne der militärischen Verschwörer gegen Hitler entspricht die Geschwätzigkeit über die Opfer. Wenn der Bürger, schrieb Adorno einmal, schon zugibt, dass Verbrechen geschehen sind, dann will er auch, dass das Opfer mitschuldig ist. Der gegenwärtig zu neuem Leben erweckte anständige Deutsche bezieht gerade aus der Unanständigkeit der Ermordeten und Überlebenden seine politische Vitalität. Wie die Kirche den Teufel, so braucht der gute Deutsche den bösen Juden. Dieser Zusammenhang liegt der »Affäre« Reich-Ranicki zugrunde, die eine Affäre des deutschen Feuilletons ist.
Die antijüdische Begleitmusik, die in diesem Fall gespielt wird, ist nicht neu. Die Orchesterbesetzung hat gewechselt. Jahrelang war, um einen verwandten Fall zu erwähnen, Heinz Galinski, der verstorbene Vorsitzende der Berliner jüdischen Gemeinde, die Projektionsfigur für einen weitverbreiteten Antisemitismus von unten, einen Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Wer gar nichts wußte, wußte immer noch, wer Galinski war; wer nichts zu sagen hatte, dem fiel zu Galinski etwas ein. Er war der »Mahner«, wie es immer wieder hieß, der sich als notorischer Gläubiger gebärdete. Er war der Itzig der Nachkriegszeit, die mit seinem Tod und der Wiedervereinigung zu Ende ging. Der Hass auf ihn freilich war nicht Ausdruck dumpfer Verdrängung der mörderischen Geschichte, sondern eine Leistung des hellwachen Bewusstseins selbst noch der verblödetsten Landsleute: mit der jüngeren deutschen Geschichte sollte nicht einfach Schluss sein, sondern diese sollte, indem es gegen Galinski ging, erst richtig zu ihrem Abschluss gebracht werden. Dass er noch da war, ging nicht mit rechten Dingen zu. Etwas war damals schiefgelaufen. Er war sozusagen ein Toter, der nicht sterben wollte.
Im Fall Reich-Ranicki, dem man nicht den Titel eines »Mahners«, sondern den um nichts weniger Respekt wie Ranküne vereinigenden Titel eines »Richters«, eines »gnadenlosen Richters« verliehen hat, in seinem Fall verhält sich die Sache etwas anders. Der Mann wird nicht vom Publikum, sondern von Kollegen und Literaten gehaßt, die das Ressentiment erst ausbilden und formulieren müssen, damit es kollektiv wirksam wird. Erst wenn diejenigen, die Reich-Ranicki als Literaturkritiker verrissen oder, schlimmer, ignoriert hat, es geschafft haben werden, den Kritiker im jüdisch-kommunistischen Agenten verschwinden zu lassen, können sich alle, nicht nur die Handvoll bedeutungsloser Schriftsteller und Journalisten, als bedeutende Opfer eines Bösewichts fühlen. Die Kampagne gegen Reich-Ranicki, der in den Augen ihrer Protagonisten den dreifaltigen Vorwurf: Jude, Kommunist und Kollaborateur verkörpert, ist der patriotische Beitrag des klugen Kerls, oder anders gesagt: Antisemitismus von oben. Es ist in diesem Zusammenhang von ausgesuchter Ironie, dass ausgerechnet in seiner eigenen Zeitung, der FAZ, vor Jahren die Frage aufgeworfen wurde, die nun anhand seiner Person beantwortet wird. Damals fragte ein Autor angelegentlich der Theateraufführung »Getto« ganz ungeduldig: »Wann verlieren die Opfer ihre moralische Unschuld«? Und auch der Spiegel nahm damals von einer lieb gewonnenen Vorstellung Abschied, der zufolge die umgebrachten Juden alle Kammermusiker, Philanthropen und Nobelpreisträger gewesen waren, und sprach von der »Wahlverwandtschaft zwischen Henkern und Opfern.« Diese Wahlverwandtschaft im Fall Reich-Ranicki zu belegen, war das Privileg eines polnischen Journalisten, den die Herrenmenschen von der Zeit engagierten. Auch an der Verteilung der Drecksarbeit hat sich nichts geändert. Außerdem macht ihn die aktuelle Amalgamierung von Nazi und Stasi ohnehin mindestens zu einem halben Nazi, was in seinem Fall natürlich als besondere Anmaßung gilt.
Reich-Ranicki, so ist absehbar, wird zur phantastischen Wunschfigur des ideellen Gesamtantisemiten: Intellektueller, Jude, Kommunist, erst im Geheimdienst, dann Verräter, übt Macht aus, sinnt auf Rache. Ein Ärgernis ist er schon immer gewesen. Doch der Neid auf ihn und seinen Erfolg tritt nun, da Reich-Ranicki dazu dienen soll, den Blick auf die Vergangenheit frei zu machen, als antijüdisches Ressentiment auf. Durchtränkt von diesem war der Neid schon immer. Talent habe er, aber keinen Charakter, hieß es, weil er unterhaltsam ist. Und vorgeworfen wurde ihm von jenen, die sich, wie Walter Jens etwa, als Hüter des Geistes verstehen, er sei ein Agent der Warenwelt, das Literarische Quartett sei so etwas wie ein Verkaufsveranstaltung für Jacobs-Kaffee. So wird von jenen, die nichts als marktgängigen Edelkitsch und Aufklärung von der Stange zu bieten haben, dem im Unterschied zu ihnen brillanten Exponenten der literarischen Zirkulation vorgeworfen, den Tod der Literatur zu verursachen und deshalb für eine Tendenz verantwortlich zu sein, die Reich–Ranicki doch bloß vorgefunden hat. Am Exponenten des Kulturbetriebs wird die Verwandlung von Literatur in Ware beklagt, eine alte Klage der liberalen Ära, »deren Hass gegen den jüdischen Mittelsmann«, so Adorno, »am Ende das unsägliche Grauen bereitete.«
Der zentrale Satz, der in immer neuen Variationen in die Attacken gegen den Literaturkritiker einfloss, wurde gleich zu Beginn des Treibens verübt: In der Fernsehsendung von Tilman Jens im Mai 1994 mahnte eine garantiert doppel-arische Frau Krone–Schmalz: »dass der Richter von heute einst ein Gerichteter war, dürfen wir niemals vergessen.« Oder anders gesagt: das Warschauer Getto werden wir ihm niemals verzeihen. Immer daran denken, Juden verfolgen, weil sie selbst verfolgt wurden. Verfolgung macht das Opfer zum Verfolger. Der Angriff auf Reich-Ranicki ist sozusagen ein Akt der Notwehr. Es ist dies die Angst für ein unabgegoltenes Kapitel der deutschen Geschichte, eine Angst, die Heiner Müller, der geborene Sprecher des Unterbewusstseins in Deutschland, auf die Formel gebracht hat: »Die Atombombe ist die jüdische Rache für Auschwitz.«
Reich-Ranicki ist den Kommunismus losgeworden, nicht aber sein Judentum. Das hängt an ihm wie eine Zielscheibe, auf die sich seit Beginn der Affäre alle eingeschossen haben. Da wird selbst seine Tätigkeit im polnischen Geheimdienst eine bloße Funktion seines Judeseins und nicht als Ergebnis sachlicher Gründe gesehen. In der Aneinanderreihung: vom Getto über den Geheimdienst zum gnadenlosen Richter erscheint das klassische antijüdische Stereotyp: Verfolgtwerden als eine Vorbedingung der Macht.
Sollte irgendjemand freilich nicht gewusst haben, dass Reich-Ranicki Jude ist, dass Juden Opfer und Opfer dazu da sind, geopfert zu werden, dem verschaffte der Spiegel mit einer dem Stürmer nachgeäfften Titelbild Gewissheit, dass sein Unbehagen einem bösartigen Tier galt und demzufolge begründet war. Andererseits freilich war Reich-Ranicki manchen nicht jüdisch genug, und dann gaben sie ihm, wie viele Deutsche das tun, wenn sie auf Juden treffen, Nachhilfeunterricht im Jüdischsein.
Wolf Biermann, vor dessen Zudringlichkeit kein jüdischer Autor mehr sicher ist, ist das beste Beispiel für die Nachäfferei dessen, was als jüdisch gelten soll. Wie einst Eichmann, der beim Besuch eines Konzentrationslagers jüdische Häftlinge beschimpfte, weil sie keine jüdischen Witze erzählen konnten oder die hebräische Sprache nicht beherrschten, also keine richtigen Juden seien, so ging Biermann auf Reich-Ranicki los mit der Vorhaltung, er wisse nichts von jiddischen Dichtern aus dem Getto oder es ermangele ihm an Interesse für die moderne israelische Literatur.
»Wir wissen nicht, was Sie draußen gemacht haben, aber wir wissen genau, was wir drinnen gemacht haben« – mit diesem Satz haben die Gleichgeschalteten nach 1945 Emigranten als Verräter und Deserteure verhöhnt. Was Reich-Ranicki »draußen« gemacht haben könnte, ist trotz aller Enthüllungen über seine kommunistische Vergangenheit eine Frage geblieben, von welcher die verfolgende Unschuld des deutschen Feuilletons heftig gequält wird. In der Wochenzeitung Die Zeit las man die kleinlaute Zwischenbilanz des drängenden Wunsches, überlebende Juden den Deutschen gleichzumachen: »Über die ›vielen Erfolge‹ des Tschekisten Marcel Reich-Ranicki wissen wir praktisch nichts.« Diesem unbefriedigenden Zustand wurde abgeholfen mit einem Buch über Polen, das die kollektiven Ahnungen zur Gewissheit werden lässt. »Auge um Auge«, so lautet der Titel. Und im Untertitel wird versprochen: »Die nicht erzählte Geschichte der jüdischen Rache an den Deutschen im Jahr 1945«. Reich-Ranicki kommt in diesen Protokollen der Rächer von Zion zwar nicht vor, aber in diesem neuen antijüdischen Standardwerk spielt dieser geringfügige Umstand keine Rolle mehr.
1994