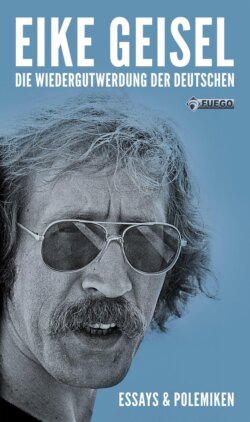Читать книгу Die Wiedergutwerdung der Deutschen - Eike Geisel - Страница 4
Some of my best friends are German Vorwort
ОглавлениеDer 1997 verstorbene Historiker und Journalist Eike Geisel gehörte zusammen mit Wolfgang Pohrt, Henryk M. Broder, Lothar Baier und Christian Schultz-Gerstein einer Generation von Kritikern an, die sich seit den siebziger Jahren radikal, scharfsinnig und originell mit dem ideologischen, politischen und kulturellen Zeitgeist auseinandersetzten, ohne einer institutionalisierten Opposition oder Gruppe anzugehören. Als Achtundsechziger hatte Geisel sein Denken wie viele andere an Adorno und Horkheimer geschult, im Unterschied zu vielen anderen aber auch an Hannah Arendts »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« und an ihrem Eichmann-Buch. In einer Zeit, als die Literatur über den Nationalsozialismus noch sehr spärlich war, beschäftigte er sich u.a. mit H.G. Adlers Theresienstadt-Studie, las Eugen Kogons Standardwerk »Der SS-Staat« und Jean Améry, dessen rhetorische Vortragskunst er bewunderte.
Er promovierte über »Marx und die nationale Frage«, arbeitete zwischen 1973 und 1975 am Otto-Suhr-Institut, bevor er anschließend (von 1975 bis 1981) zusammen mit Wolfgang Pohrt als Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg lehrte (eine zeitlich befristete Anstellung, was sich im nachhinein als Glücksfall herausstellte), wo er u.a. Seminare über die Aktualität des Faschismus und über Marx abhielt. Damals lernte er die kommunistische Jüdin, Partisanenkämpferin und KZ-Überlebende Hanna Lévy-Hass kennen und überredete sie, ihre Tagebücher »Vielleicht war das alles erst der Anfang« im Rotbuch Verlag (1979) zu veröffentlichen, denen ein langes Gespräch mit der Autorin beigefügt war.
1981 erschien das von ihm herausgegebene Buch »Im Scheunenviertel«, ein Bildband mit einem großen Essay, Fotos, zeitgenössischen Texten und Dokumenten über die während der Kriegs- und Revolutionswirren nach Berlin geflüchteten Ostjuden, ein Buch, das zahlreiche Auflagen erlebte. Weil die DDR in den 35 Jahren nach Kriegsende wenig getan hatte, um diese verrufene Gegend zu sanieren (was dem Westen innerhalb weniger Jahre dann vollständig gelang), verwiesen alte Schriftzüge an der Wand, Einschusslöcher und Elendsbehausungen noch rudimentär auf das jüdische Leben, das da einmal auf engstem Raum stattgefunden hatte.
Zu dieser Zeit lernte er Henryk Broder kennen, der sich schon seit den siebziger Jahren mit dem Antisemitismus in der Linken auseinandersetzte und mit linker Prominenz und Zeitschriften wie Emma und Konkret im Clinch lag, u.a. deshalb, weil Ingrid Strobl Israel das Existenzrecht absprach und Alice Schwarzer einer Redakteurin Kontaktverbot zum »militanten Juden« Broder erteilte. Immerhin ein Vorfall, der zur Planung einer kleinen Anthologie über das Verhältnis der Linken zum Antisemitismus führte, die dann allerdings nicht zustande kam.
Mit Broder verband Geisel eine enge Freundschaft. Gemeinsam suchten sie in den USA und Israel Überlebende des Jüdischen Kulturbunds auf, sammelten Dokumente und drehten den Film »Es waren wirklich Sternstunden«, der 1988 ausgestrahlt wurde. Geisel erstellte das Konzept für eine dann 1992 an der Akademie der Künste gezeigten großen Ausstellung mit einem umfangreichen Katalog (»Geschlossene Vorstellung«). Zudem erschien im gleichen Jahr ein Buch von ihm und Broder zu diesem Thema mit dem Titel »Premiere und Pogrom«.
Broder beteiligte sich da allerdings nur noch sporadisch an der historischen Forschung, denn mit der am 2. August 1990 beginnenden Annektierung Kuweits durch Saddam Hussein und der Intervention der USA und ihrer Verbündeten am 16. Januar 1991 begann in Deutschland eine heftig geführte Debatte, in die beide leidenschaftlich involviert waren. In der Textsammlung »Liebesgrüße aus Bagdad. Die ›edlen Seelen‹ der Friedensbewegung und der Krieg am Golf« spotteten sie über die wieder von den Toten auferstandenen Pazifisten, die weiße Laken als Zeichen der Kapitulation aus dem Fenster hängten, und polemisierten gegen Leute wie Rudolf Augstein, Alice Schwarzer und Christian Ströbele, die dem vom Irak durch Raketenbeschuss bedrohten Israel eine gewisse Mitschuld am Krieg gaben. Sie mieteten eine große elektronische Werbetafel an der Ecke Joachimsthalerstraße und Kurfürstendamm gegenüber vom Café Kranzler, auf der dann zu lesen war: »An die deutsche Friedensbewegung: Vielen Dank für die moralische Nachrüstung. Ihr Saddam Hussein.«
Danach setzte die Debatte um die Stasi ein, die für Broder allerdings eine andere Bedeutung hatte als für Geisel. Er sah in der kollabierten DDR nicht so sehr den mit dem Nationalsozialismus vergleichbaren Unrechtsstaat, sondern eine kommode und lächerliche Diktatur, mit der sich die Bevölkerung arrangiert hatte, bis die Verlockungen des Westens in Form von Beate Uhse und Bananen und weniger von Freiheit sie überlaufen ließen. In der öffentlichen Diskussion über die Stasi erkannte er das Bedürfnis der Deutschen, die nicht stattgefundene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nach 1945 nachzuholen, um sich ein gutes Gewissen zu machen. Die Outings von ehemaligen Stasimitarbeitern fand er nicht weniger erbärmlich als die »Schwerter-zu-Pflugscharen«-Pazifisten, die sich als Fundamentalopposition stilisierten, lächerlich. Empörend fand er die Jagd auf Ausländer im Osten, die schließlich im Pogrom in Lichtenhagen kulminierte, und über die Rechtsradikalen, die es zusammen mit dem Mob phasenweise schafften, »national befreite Zonen« einzurichten, in die sich keine Bürger anderer Staaten mehr trauten. Als er 1992 zu einem Vortrag in die Vereinigten Staaten reiste, schrieb er mir: »Es wird höchste Zeit, dass ich abhaue, ehe alle Brüder und Schwestern aus der Zone kommen. Die Wiedervereinigung sehe ich mir gerne aus 6.000 km Entfernung an.«
Der 1945 geborene Eike Geisel passte nicht in das Bild, das sich die Öffentlichkeit von den Achtundsechzigern machte, die zu Beginn der Neunziger angeblich überall in der Gesellschaft den Ton angaben. Eike Geisel hatte sich nicht auf den langen Marsch durch die Institutionen begeben, um eine Beamtenstelle mit Pensionsanspruch zu ergattern. Zwar hatte er gegen eine solche nichts einzuwenden, aber er besaß weder die Geduld noch die Zähigkeit, eine Karriere einzuschlagen, bei welcher der Erfolg durch Verbitterung erkauft wird. dass es andere taten, warf er ihnen nicht vor, er mochte sich bloß nicht damit abfinden, dass mit der Karriere der ehemaligen Genossen in der Bundesrepublik der freiwillige Verzicht auf Kritik an ihr einherging. Aus erklärter Feindschaft gegen den Staat wurde die Sorge um sein Ansehen in der Welt, mit dem Effekt, dass die Umstürzler von einst sich zum Objekt ihrer Fixierung nunmehr wie Kosmetikberater verhielten. Sie traten den Beweis für die These an, dass das Einverständnis mit dieser Gesellschaft nur um den Preis der eigenen vorzeitigen Verblödung möglich ist.
Die Intellektuellen verhielten sich schon vor der Wiedervereinigung als ihrem nationalen Erweckungserlebnis so, als wollten sie beweisen, dass Adorno dreißig Jahre nach seinem Befund noch aktuell war: »Der Glaube an die Nation«, hatte Adorno 1960 geschrieben, »ist mehr als jedes andere pathische Vorurteil die Meinung als Verhängnis; die Hypostasis dessen, wozu man nun einmal gehört, wo man nun einmal steht, als des Guten und Überlegenen schlechthin. Er bläht die abscheuliche Notstandsweisheit, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, zur moralischen Maxime auf. Gesundes Nationalgefühl vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der pathogenen; unaufhaltsam ist die Dynamik des angeblich gesunden Nationalgefühls zum überwertigen, weil die Unwahrheit in der Identifikation der Person mit dem irrationalen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft wurzelt, in dem die Person zufällig sich findet.«
Zwar ließ sich gegen die Rauner des Nationalen und der Wiedervereinigung mit Polemik wenig ausrichten, aber es bereitete Eike Geisel dennoch großes Vergnügen, die als »Identitätssuche« veredelte Anbiederei bloßzustellen, um zu demonstrieren, wie überaus eifrig die Intellektuellen ihren eigenen Bankrott bewerkstelligten. Vor allem, wenn ihre unheilbare Liebe für den Befreiungskampf des palästinensischen und irakischen Volkes entflammte und sie sich als Nationalisten und Antisemiten entpuppten, befanden sie sich in einer Tradition, die ihrer Überzeugung nach schon lange vorüber war, derzufolge die Vergangenheit verarbeitet sei und die Deutschen aufgeklärt und liberal wie nie. Die Deutschen aber zeigten sich »resistent gegen jede Aufklärung über die eigene Vergangenheit«.
In den achtziger Jahren fing dann das Geschäft mit der Erinnerung zu boomen an, eine »unspezifische Erinnerungswut« (Clemens Nachtmann) setzte ein, aber die hatte nur wenig mit Einsicht zu tun. »Verordnete Aufklärung«, schrieb Eike Geisel, »ist so unsinnig wie die komplementäre Bereitschaft, an ihr wie durch massenhafte Verabredung organisiert teilzuhaben. Dass die Deutschen mit der nämlichen Betriebsamkeit, die sie einst beim Vernichten und dann beim Vergessen an den Tag gelegt hatten, sich nun an die eigene Vergangenheit machten, diesem Umstand haftet etwas Groteskes an. Erst in der beflissenen Erfassung der Nazizeit kommt Horkheimers Verdikt, er kenne kein verhärteteres Kollektiv in der ganzen Welt, zu seiner vollen Wahrheit. Gemünzt auf die geschäftige Verdrängung der Verbrechen, erfährt jenes Urteil gerade durch die treibende Kraft der deutschen Rückschau eine paradoxe Bestätigung. Denn in der eifrigen Materialsammlung und der sie begleitenden gefühligen Anschauung wurde aus der Besinnung auf den Nationalsozialismus eine neue Besinnlichkeit und der Verstand wurde vom Verständnis abgelöst [...] Gerade die offenherzige Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ging reibungslos konform mit wachsendem Ausländerhass und parteiübergreifendem Patriotismus, wohingegen wahrhafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einzig darin bestünde, den notorischen Zusammenhang zu kündigen.«
Mit dem Boom der Erinnerungskultur und den sich häufenden Jubiläen von Ereignissen, die Meilensteine auf dem Weg zur Vernichtung der Juden und mit deren Erforschung zahllose Wissenschaftler beschäftigt waren, wurde ein lukrativer Erwerbszweig hervorgerufen: das »Shoabusiness«. Eike Geisel stellte seine Beteiligung an diesem Geschäft, welcher man auch in aufklärender Absicht nicht entgeht, nie in Abrede, zeigte sich vielmehr amüsiert darüber. In einer Notiz vom 14. April 1988 schrieb er mir, ob ich nicht Lust hätte, etwas über Broder und ihn zu schreiben unter der Überschrift: »Die neue deutsch-jüdische Symbiose. Zwei Vernichtungsgewinnler.« Trotz dieses nicht sehr ernst gemeinten Vorschlags: Aus Deutschen wurden Experten, und die Experten meldeten eine Art Copyright auf die »Shoa« an – »Auschwitz bleibt deutsch« –, während andere Experten wiederum jedes kleinere Massaker schon mit der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gleichsetzten.
Eike Geisels Kritik am deutsch-jüdischen Verständigungskitsch einerseits, der auf Tagungen evangelischer Akademien zelebriert wurde, und andererseits an der weitverbreiteten Auffassung, dass Auschwitz eigentlich eine »Besserungsanstalt« gewesen sei, aus der die Juden geläutert hätten hervorgehen müssen, was leider nicht der Fall war, weshalb die Deutschen glaubten, die Juden ihrer besonderen Fürsorge unterziehen zu müssen, Eike Geisels Kritik an diesen Haltungen hatte einen Ausgangspunkt. Und dieser bestand in seinem immerwährenden Umkreisen und Hinweisen auf das, was die Nazis den Juden angetan hatten, die durch die willkürliche Entrechtung und Erniedrigung in einen Zustand gebracht wurden, in dem sie bereits verwaltungstechnisch ausgelöscht waren, bevor sie dann in den Lagern auch physisch aus dem Leben geschafft wurden.
»Die vollendete Sinnlosigkeit« der Lager schließlich, wie Eike Geisel einmal eine Studie Hannah Arendts über die deutschen Konzentrationslager übersetzte, war eine weitere Besonderheit, die für Eike Geisel Voraussetzung war, um das nationalsozialistische System zu begreifen, die Überzeugung der Nazis, »es sei wichtiger, die Vernichtungsfabriken in Betrieb zu halten als den Krieg zu gewinnen« (Hannah Arendt). Dass dafür bis auf Ausnahmen keine Menschen vonnöten waren mit einem besonders ausgeprägtem Hang zum Sadismus, damit setzte er sich in seinem Film über Eichmann mit dem Titel »Erbschaft eines Angestellten« von 1990 auseinander, der sich in typisch deutscher Tradition auf den Befehlsnotstand berief, der ihn unter anderen Vorzeichen und in der Nachkriegszeit auch zu einem ausgezeichneten und leidenschaftlichen »Judenpfleger« gemacht hätte, wenn es von ihm verlangt worden wäre. Unabhängig davon, dass es sich bei Eichmanns Prozessaussagen um Schutzbehauptungen handelte und er in Wirklichkeit ein überzeugter, ja fanatischer Antisemit war, hätte er unter bundesrepublikanischen Bedingungen eine gegenteilige Bestimmung gefunden, und diese charakterliche Eigenschaft war es, die Eike Geisel in der deutschen Geschichte nachwirken sah.
Für die Vernichtung der Juden waren also lediglich eine funktionierende Bürokratie und ganz normale Menschen aus ganz normalen Familien nötig, die vielleicht die Auswüchse nicht gut hießen, aber dennoch bereit waren, ihren Teil an der Vernichtung der Juden beizutragen, und das war ebenfalls eine wesentliche Prämisse, die das Denken Eike Geisels prägte und die wichtig war in der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, wie sie in Politik und Gesellschaft bis in die heutige Zeit hinein geführt wird und die Eike Geisel in der Regel als Versuch wertete, die Opfer mit haftbar zu machen für das, was ihnen angetan wurde. Insofern stand er jedem Versuch der Versöhnung skeptisch gegenüber, denn es war »etwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden«, wie Hannah Arendt einmal gesagt hat, etwas, das »nicht hätte geschehen dürfen«, weil sich ein Abgrund geöffnet hatte, der sich der Logik des Denkens entzog.
Trotz Bezugnahme auf das tagespolitische Geschehen wirken Eike Geisels immer auch als Invektiven ebenso wie als Interventionen gemeinten Artikel nie antiquiert. Davor bewahrt sie der sarkastische, manchmal auch ironische Ton, der schon Hannah Arendt in der Eichmann-Debatte vorgeworfen wurde. Ein Ton, der jedenfalls nie weihevoll, selbstgefällig oder bemüht wirkte. Ein Ton, der dazu führte, dass sich Rezensenten seiner Bücher nie besonders wohl fühlten. Empfindet ein Journalist im Neuen Deutschland die »Bösartigkeit des Autors« noch als »wohltuend«, fragt er sich vier Zeilen später, »wie weit Kritik an der israelischen Politik gehen darf, ohne dass er [Eike Geisel] sie als antisemitisch bewertet?« In diesem Punkt war die Presse sehr sensibel. Selbstverständlich war niemand in der aufgeklärten Linken antisemitisch, und wenn dennoch der Vorwurf erhoben wurde, konnte man sicher sein, dass man folgende Begründung zu hören bekam, derzufolge man gar kein Antisemit sein könne: »Einige meiner besten Freunde sind Juden«. Eike Geisel machte sich über dieses jeglicher Logik entbehrende Argument gerne mit dem Bonmot lustig: »Some of my best friends are German«.
Ausgewogene Artikel zu schreiben oder betuliche Vorträge zu halten, wäre Eike Geisel sinnlos erschienen, denn er wollte nicht das Für und Wider abwägen, sondern Reaktionen provozieren in dem Wissen, dass sich im Streit nachhaltiger Erkenntnisse gewinnen lassen und Differenzen klarer werden als in lauer Zustimmung. Seinen Aufsätzen wurde in der Regel »Kälte« und eine »bemerkenswerte Herzlosigkeit« attestiert. Die gleichen Vorwürfe hatte man auch Hannah Arendt gemacht.
Als er am 20. Februar 1991 von der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste Hamburg, dem Deutsch-Israelischen Arbeitskreis, der GAL, der Solidarischen Kirche und Konkret eingeladen wurde, an einer Diskussion zum Verhältnis der deutschen Friedensbewegung und Israel teilzunehmen, rief sein »unausgewogener, unfairer Beitrag« (wie er ihn selbst ankündigte) erhebliche Unruhe hervor. Eike Geisel sagte, dass Saddam Hussein zumindest in Deutschland »ein Kriegsziel bereits erreicht hatte. Der Karneval war ausgefallen, und ersatzweise bevölkerten lauter gutgesinnte Menschen die Straßen«. Er wurde als »Kaffeehaus-Zionist« beschimpft, ein Vorwurf, den er mit »Du hast leider nicht die Möglichkeit, den damit verbundenen Gedanken in die Tat umzusetzen. Das ist vorbei« konterte.
Als Konkret in der Ausgabe 8/93 einen umstrittenen Vortrag von Christoph Türcke, den dieser auf dem Konkret-Kongress am 12. Juni gehalten hatte, veröffentlichte, um, wie Konkret schrieb, »eine Versachlichung der andauernden Debatte zu ermöglichen«, da kommentierte Wolfgang Pohrt: »Mir ist der Unterschied zwischen Bewohnern verschiedener Erdteile herzlich egal. Wichtig ist mir, mich von einem wie Türcke zu unterscheiden. So wie der mag ich nicht sein. Und wenn er in konkret publiziert, tue ich es nicht.«
Und auch Eike Geisel, der gerade wieder aus den USA zurückkam, kündigte seine Mitarbeit bei Konkret auf: »Irgendwo bei Adorno steht, dass ein Grenzübertritt nach Deutschland so etwas wie der Wiedereintritt in die Barbarei sei. dass mich neulich bei der Rückkehr aus dem Ausland ein derartiges Gefühl beschlich, lag nicht daran, dass neue Nazis gerade eine Parade in Hessen abhielten, sondern daran, dass alte Linke publizistisch nach Fulda hinübergrüßten mit der Frage: ›Gibt es ein biologisches Substrat, das es gestattet, Menschenrassen in nichtdiskriminierender Absicht zu unterscheiden?‹ [Christoph Türcke] Noch vor Jahresfrist wollte man den Rechten nicht die Nation überlassen; jetzt ist man bei dem Wettstreit folgerichtig bei der Rasse angelangt. Der Skandal ist nicht Türckes Text, der in die ›Junge Freiheit‹ oder in den ›Spiegel‹ gehört; skandalös ist der Gestus, mit dem ›konkret‹ ihn als ›Türcke-Kontroverse‹ abdruckt. Skandalös vor allem aber ist Gremlizas Kommentar, der sich zu Türckes Melange aus Adorno und Gobineau, einer nun wirklich postmodernen Zuchtwahl, verhält wie der Sozialarbeiter zu den rassistischen Brandstiftern: wenig Verstand, viel Verständnis. Bei dieser Suche nach einer neuen Nürnberger Gesetzlichkeit möchte ich nicht mehr zu den Autoren von ›konkret‹ zählen.« Erst über ein Jahr später erschien wieder ein Artikel von Geisel in Konkret.
Die Redakteure, die er belieferte, waren von der »begnadeten Niedertracht seines gewitzten Stils« beeindruckt. Nur drucken wollte man sie in der bürgerlichen, aber auch linken Presse wie der taz in der Regel dann doch lieber nicht. Die bürgerlichen Medien wollten sich keinen Ärger einhandeln, Redakteure der taz bekamen »Bauchschmerzen« von seinen Artikeln. In Israel hingegen, wo einige Arbeiten Eike Geisels in der Tageszeitung Haaretz veröffentlicht wurden, gab es damals zwar nicht unbedingt eine bessere öffentliche Meinung, aber die Angst vor ihr und möglichen Abokündigungen hatte noch nicht dazu geführt, dass man sich ihr unterwarf und ihre Ressentiments teilte, indem man Verständnis für diese aufbrachte.
Trotz dieser unerfreulichen Auseinandersetzungen mit Redakteuren, die oft mühseliger waren, als die Artikel zu schreiben, landete Eike Geisel mit einem seiner letzten Texte einen Coup, der im Leben eines freien Autors nicht sehr häufig vorkommt. Eike Geisel hatte das Buch »Auge um Auge. Opfer des Holocaust als Täter« von John Sack, eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, in der Frankfurter Rundschau (die taz hatte den Artikel abgelehnt) als »Antisemitische Rohkost« vorgestellt. In der Februarausgabe von Konkret erschien zur gleichen Zeit unter dem Titel »Die Protokolle der Rächer von Zion oder die neuen ›Opfer der Opfer‹« eine ausführliche Fassung.
Noch bevor das Buch ausgeliefert wurde, zog der Piper Verlag es am 9. Februar 1995 zurück. Dieser nunmehr publik gemachte Skandal wurde sogar in der New York Times und der Herald Tribune registriert. In der folgenden ausgedehnten Kontroverse waren die meisten Journalisten trotz der primitiven antisemitischen Töne John Sacks dem Überbringer der schlechten Nachricht nicht sehr freundlich gesonnen, weil viele von ihnen der dünnen These von der Angleichung der Opfer des Nationalsozialismus an die Täter eine gewisse Plausibilität abgewinnen konnten.
Tagesspiegel, Welt, taz, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ja sogar die Zeit, die den »Opfern der Opfer« nicht nur ein ganzes Dossier widmete, sondern auch einen Leserbrief John Sacks im redaktionellen Teil veröffentlichte, waren sich einig, dass ein tapferer und wegen seiner jüdischen Herkunft unverdächtiger Autor zwar etwas naiv, aber durchaus verdienstvoll das »Tabuthema Vertreibung« behandelt habe, dem man sich, wie es in der taz hieß, »unverkrampft« nähern wollte. Zu diesem Thema nämlich könne man sich »entweder überhaupt nicht, oder wenn, dann (nur) unter permanenter Hinzufügung, dass die Vertreibung letztendlich eine Folge des von Deutschen begangenen Weltkrieges, von Auschwitz und den deutschen Verbrechen sei« (taz), äußern. Der Mühe der »permanenten Hinzufügung« wollte man sich nicht mehr unterziehen, man wollte reden dürfen wie ein Vertriebenenfunktionär, und insofern hat Eike Geisel diesen Journalisten zu ihrem coming out verholfen.
Auf ein nicht mehr realisiertes Projekt verweist der Artikel »Das Ende der Schonzeit« über jüdische Rächer nach 1945, eine Art Exposé für ein Buch, das bei Rowohlt Berlin erscheinen sollte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zunächst Interesse an einem Vorabdruck gezeigt, dann aber doch lieber Abstand davon genommen. Ein anderes Vorhaben, das nicht mehr mit Hilfe des Autors zustande kam, war ein dritter Band seiner Aufsätze, der dann 1998 unter dem Titel »Der Triumph des guten Willens« als seine nachgelassenen Schriften veröffentlicht wurde.
Dieser dritte Essay-Band war nur einer der zahlreichen Pläne, die Eike Geisel immer gerne schmiedete und von denen er mit einer Begeisterung erzählte, die äußerst ansteckend war. Zuletzt bemühte er sich um einen Lehrauftrag in den Vereinigten Staaten, den er zum einen mit Archivforschungen für sein Buchprojekt über die jüdischen Rächer nutzen wollte, zum anderen hoffte er, mit der Ortsveränderung etwas Abstand von den immer unerträglicher und zäher werdenden Debatten in Deutschland zu gewinnen. Aber daraus wurde nichts mehr.
Es ist etwas einfach, darauf hinzuweisen, dass seinen Artikeln heute aufgrund des weltweit grassierenden Antisemitismus und der Toten in Paris wieder große Aktualität zukommt, aber es ist nicht zu leugnen, dass es tatsächlich so ist, auch wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse seit 1995 erheblich verändert haben. Aber gerade in einer Zeit, in der selbst das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin im Nahostkonflikt einen nachvollziehbaren Grund für die »generalisierte Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden« erkennt, wäre es spannend gewesen zu erfahren, wie Eike Geisel dagegen angeschrieben hätte, denn mit Sicherheit hätte ihm die Krankheit dieser Zeit keine Ruhe gelassen.
Im Sommer 1995 fiel Eike Geisel in ein Koma, aus dem er nicht wieder erwachte. Er starb am 6. August 1997. Am 1. Juni 2015 wäre er 70 Jahre alt geworden. Er liegt auf dem Friedhof Stubenrauchstraße in Berlin-Friedenau in unmittelbarer Nähe von Marlene Dietrich, die er bewunderte und die bis über ihren Tod hinaus in Deutschland als Verräterin galt. Ich glaube, das hätte ihm gefallen.
Klaus Bittermann