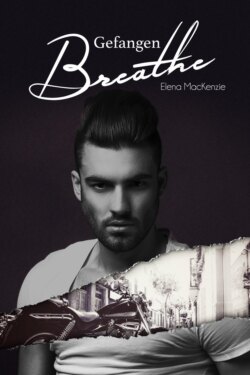Читать книгу Breathe - Elena MacKenzie - Страница 7
2
ОглавлениеSie wirkt nervös, während sie das Auto vom Parkplatz auf die einzige Hauptstraße in diesem Kaff steuert. Da es in dieser Stadt weder tagsüber noch nachts wirklich Verkehr gibt, rührt ihre Nervosität wohl nicht daher. Entweder beunruhige also ich sie oder ihr Plan, die Stadt zu verlassen. Ich setze mich etwas schräg, um sie besser sehen zu können. Der Gedanke, ich könnte diese Unruhe in ihr auslösen, gefällt mir. Wie unruhig sie wohl werden wird, wenn ich ihr meine Waffe gegen die Stirn drücke und ein Loch in diesen hübschen Kopf schieße?
»Du verlässt also die Stadt?«, sage ich möglichst desinteressiert zu ihr. Sie hat dieses kurze, fast schon zu kurze schwarze Haar, das ihr aber perfekt steht. Diese Frisur würde nicht vielen Frauen stehen, aber bei ihr sieht es einfach perfekt aus. So wie bei dieser Schauspielerin aus den 50ern. Audrey Hepburn. Es ist gerade so noch lang genug, um es beim Sex packen und die Finger darin vergraben zu können.
Sie zieht eine Augenbraue hoch und sieht mich flüchtig an. Ihr Gesicht wird von der Beleuchtung der Armaturen erhellt. Entschlossen nickt sie, bevor sie den Blick wieder auf die Straße richtet. Noch vier Häuser, dann sind wir schon wieder aus der Stadt raus und auf der schlechten Straße unterwegs, die Black Falls mit dem nächsten Nest verbindet. Zwischen hier und dort gibt es nur ein paar Farmen und einen kleinen Wald. Der Wald ist mein Ziel, weil wir dort abgeschirmt vor neugierigen Blicken sind. Auch wenn die Chance gering ist, dass jemand uns sehen könnte, ich muss ganz sicher sein, dass mein Gesicht demnächst nicht über die Nachrichtenkanäle tickert. Dass sie die Stadt verlassen will und jeder es weiß, spielt mir in die Hände. Nur ihr Vater soll hiervon wissen. Er soll den gleichen Schmerz fühlen wie ich, als er meine Mutter ausgeweidet hat.
»Warum?«, frage ich sie, als sie nichts weiter sagt.
Sie stößt genervt die Luft aus und verzieht dieses hübsche Gesicht. Sie ist eine von diesen Frauen, die nicht süß und unschuldig wirken. Sie wirkt stark, sportlich, ein wenig wild und geheimnisvoll. Und der Blick aus diesen sturmblauen Augen wirkt so viel älter und schmerzerfahrener als er eigentlich wirken sollte. Ich denke, das ist es, was mich an ihr so anzieht: Ich sehe sie an und erkenne den gleichen Schmerz, den auch ich fühle, den nur eine abgefuckte Kindheit auslösen kann. Ich frage mich, wie abgefuckt ihre war. Weiß sie überhaupt, wer ihr Vater ist? Meine Kindheit war abgefuckt. Ihr Vater hat meinen im Zweikampf besiegt und getötet, seinen Platz eingenommen, meine Mutter geheiratet und mich und meinen Bruder großgezogen. Er hat die Familie, die ich kannte, ausgelöscht. Das Zuhause, das ich kannte, vernichtet. Innerlich grinse ich abfällig, die Schönheit neben mir ist eigentlich meine Stiefschwester. Und doch gehört sie in eine ganz andere Welt. Eine ohne Gewalt, Tod und Kinder, die zu Killern erzogen werden.
»Du bist schon seit Tagen in Black Falls, musst du das wirklich fragen? Ist das nicht offensichtlich?«
Ich wiege grinsend den Kopf hin und her. »Entschuldige, ich wollte nur ein Gespräch in Gang bringen«, sage ich und zucke mit den Schultern. Ich beginne einen der Siegelringe an meinen Fingern zu drehen. Man sieht es den Ringen nicht an, aber an ihnen klebt eine Menge Blut. Mit ihnen habe ich auf der Jagd oder im Training schon einige Gesichter demoliert. »Aber wir müssen nicht reden, wenn du nicht willst.«
Sie sieht mich wieder an, verzieht seufzend das Gesicht und lächelt verbissen. »Tut mir leid, ich bin nur müde«, meint sie.
»Und dann willst du heute noch hier weg? Stunden im Auto?«
»Ja, will ich.« Sie seufzt. »Ich werde mir ein Motelzimmer nehmen, sobald ich weit genug weg bin, dass mich nichts dazu treiben kann, wieder umzukehren.«
»Du hast also Zweifel?«, frage ich sie neugierig. Ich lasse meinen Blick über ihr Gesicht streifen und überlege, ob ihr Vater weiß, was seine Tochter hier treibt. Den Ort verlassen, an dem er sie vor der Gewalt beschützt, die er ausgelöst hat.
»Nein. Keine Zweifel, nur ein wenig Angst. Ich war noch nie weiter als zwei Stunden von Black Falls entfernt«, erklärt sie.
Ich sehe zum Fenster raus, die Scheinwerfer des Autos huschen über die schlechte Straße und leuchten nur wenige Meter vor uns aus, aber ich erkenne die Kurve, die wir gerade nehmen. Dahinter kommen noch zwei größere Felder, eine Einfahrt zu einer Farm und dann der Wald, auf den ich es abgesehen habe. Und jetzt ist nicht mehr nur sie nervös, ich bin es auch. In mir spannt sich jeder Muskel bei dem Gedanken an, was ich gleich mit ihr tun werde. Kaltblütig zu töten, damit hatte ich noch nie Probleme. Ich bin darauf konditioniert worden, zu töten: schnell und ohne Gewissen. Sherwood ist der Richter und ich bin der Vollstecker. Aber dieses Mal ist es etwas anderes. Dieses Mal habe ich vor, ein Mädchen zu töten, das mit der Welt, in der ich aufgewachsen bin, nichts zu tun hat, außer, dass ihr Erzeuger zufällig in dieser Welt zu Hause ist.
»Also doch Zweifel. Du befürchtest, du könntest es dir anders überlegen.«
Sie schnaubt. »Wenn du willst, nenn es Zweifel. Was hast du denn in Black Falls gesucht?«, will sie wissen und sieht mich kurz an. Ich spüre es bis in meine Lenden, als ihr Blick über mich gleitet. Brennend heiß. So heiß, dass mein Puls sich beschleunigt und ich mich verspanne, weil ich so nicht fühlen will. Ich habe einen Plan. So wie sie auch einen hat. Nur wird sie ihren Plan nicht mehr durchziehen können, weil ich meinen durchziehen werde. Und doch muss ich mir eingestehen, dass ihre Nähe etwas in mir auslöst. Ein Gefühl, das ich noch niemals zuvor empfunden habe. Ein aufregendes Prickeln, eine träge Hitze, die sich durch meinen Körper schleicht. Das hier ist mehr als pure sexuelle Anziehung.
»Ich habe jemanden gesucht, der dort leben soll.«
»Und, hast du ihn gefunden?«
Ich starre auf ihre Finger, als sie sich damit über ihren schlanken Hals fährt, als hätte etwas ihre Haut berührt. Vielleicht hat sie meinen Blick gespürt, der für eine Sekunde auf ihrer Kehle lag. »Nein, habe ich nicht.«
»Und jetzt suchst du weiter?«
»Das habe ich noch nicht entschieden.« Ich deute nach vorn, wo das Licht der Scheinwerfer über die ersten Bäume hüpft. »Kannst du da vorn halten? Ich müsste mal pinkeln«, sage ich zu ihr.
Sie runzelt die Stirn, mustert mich kurz und nickt. Offensichtlich hat sie entschieden, mir vertrauen zu können. Ein Fehler, der sie gleich ihr Leben kosten wird. Aber sie weiß ja nicht, wer neben ihr sitzt. Ihre Welt und meine sind völlig verschieden. Ich weiß zumindest, dass es ihre Welt gibt. Sie hat keine Ahnung, dass es meine gibt. Unser Leben, unsere Geheimnisse, unsere Gesetze. Wir haben unsere eigenen Regeln. Regeln, die ihr Vater nochmal verschärft hat, als er nach dem Tod meines Vaters der Anführer des Clans geworden ist und die Führung in Nordamerika übernommen hat.
»Okay«, sagt sie, und jetzt kann ich doch Unsicherheit in ihrer Stimme hören. Sie kennt mich nicht, ist mitten in der Nacht mit einem Fremden unterwegs und soll jetzt auch noch am Rand eines Waldes anhalten. In ihr klingeln gerade sämtliche Alarmglocken, und das ziemlich laut. Und doch tut sie es, weil alle es tun würden. Weil niemand daran glaubt, dass ausgerechnet ihm schlimme Dinge widerfahren würden. Nur Menschen wie ich würden daran glauben und deswegen jemanden wie mich nicht in ihre Autos lassen. Der Rest der Menschheit hat dabei vielleicht ein komisches Gefühl, mehr nicht.
»Danke«, sage ich. »Das Bier muss raus.« Noch ein paar Sekunden lang soll sie glauben, alles wäre in Ordnung. Während ich diese Sekunden nutze, um mich gedanklich damit abzufinden, dass ich dieses Mal einen Mord begehen werde, der meine letzte Grenze einreißen wird. Dieser Mord wird meine Seele direkt in die Hölle befördern. Kein Zurück mehr.
Raven fährt das Auto in eine kleine Einbuchtung, die hier gebaut wurde, damit entgegenkommende Autos einander ausweichen können, dann schaltet sie den Motor aus, lässt aber das Licht an. »Also dann«, meint sie und lehnt sich zurück.
Ich grinse sie genüsslich an. »Was, wenn ich ein Mörder wäre?«, frage ich sie und halte ihren fragenden Blick fest, als sie mich ungläubig ansieht. Alles in mir hat auf Jagd geschaltet. Ich bin der Jäger und sie meine Beute. Mein Blut pulsiert gierig durch meine Adern. »Ich könnte ein Serienmörder sein, der dich hierhergebracht hat, um dich zu töten. Du willst mit deinem Wagen wer weiß wohin fahren, nimmst einen Fremden mit und denkst nicht an die Möglichkeit, dass dieser Fremde ein Mörder sein könnte?« Mein Puls rast in aufgeregter Vorfreude, als ich sie das frage und in ihrem Blick deutlich die Furcht erkenne. Sie versucht mich abzuschätzen und schafft es nicht, sich vorzustellen, dass ich ihr wirklich etwas antun könnte. Eigentlich spiele ich nicht mit meinen Opfern, aber ich habe auch noch nie eine Frau töten müssen, die die Dunkelheit in mir anspricht. Alles fühlt sich anders an bei ihr. Zum ersten Mal spüre ich Zweifel, zum ersten Mal hasse ich mich selbst. Zum ersten Mal will ich das nicht tun müssen. Aber da ist auch das Monster in mir, und das erwacht mit einer perfiden Lust auf Blut zum Leben bei dem Gedanken, gleich töten zu dürfen. Ich dränge es zurück, denn das hier wird ein schneller Tod werden. Keine Jagd.
»Dann werde ich jetzt wohl sterben«, sagt sie, versucht es belustigt klingen zu lassen, aber es gelingt ihr nicht ganz, die Unsicherheit in ihrer Stimme zu verbergen. »Willst du mir eine Lektion erteilen, indem du mir Angst machst? Glückwunsch, ist dir gelungen. Ich werde nie wieder jemanden mitnehmen. Nicht einmal, wenn er wie ein verlorener Welpe aussieht.«
»Du meinst, ich sah wie ein verlorener Welpe aus?«, frage ich sie lachend. Ich beobachte genau jede Reaktion in ihrem Gesicht. Wenn sie wüsste, wie sehr sie recht hat. In den letzten Wochen fühle ich mich verlorener als jemals zuvor. Wahrscheinlich sollte ich mich schäbig fühlen, weil ich dieses Spiel mit ihr treibe, bevor ich sie gleich wirklich töte. Aber statt mich schäbig zu fühlen, erregt es mich, ihr das anzutun. So bin ich nun mal, Dreck.
»Musst du jetzt oder nicht?«, will sie harsch wissen und legt die Finger um den Zündschlüssel.
Ich reiße die Tür auf, bevor sie den Motor wieder starten kann. »Ich muss. Leider«, murmle ich, als ich schon aus dem Wagen gesprungen bin. Ich weiß nicht, warum ich das eben getan habe, aber es hat sich gut angefühlt. Vielleicht wollte ich nur wissen, wie sie reagiert. Vielleicht diesen hilflosen Blick in ihren Augen sehen. Vielleicht sie noch einmal anschauen, ohne Abscheu in ihrem Blick zu sehen. Oder die Zeit, die ich mit ihr habe, einfach noch ein wenig rauszögern.
Aber all das ist jetzt egal. Ich habe einen Plan, eine Sache, die ich erledigen muss, weil ich ihrem Vater eine Botschaft senden muss: Du musst mit mir rechnen, Sherwood.
Wenn ich eine Chance gehabt hätte, ihn zu töten, dann würde jetzt er mit mir hier sein. Aber ich kann ihn nicht töten. Nicht zuletzt, weil er trotz allem, was er uns angetan hat, wie ein Vater für mich ist und ich gelernt habe, ihn zu lieben. Er hat aus mir gemacht, wer ich bin. Er hat mich erzogen, unterrichtet und geformt. Er hat für Sam, meine Mutter und mich gesorgt. Deswegen wollte ich ihn, wenn überhaupt, in einem Zweikampf töten. Nicht hinterrücks ermorden. Nur er und ich, so wie es unsere Gesetze sind. Aber er hat mir die Chance dazu verweigert. Auch weil mir das Recht dazu fehlt, ihn herauszufordern.
Also muss er den Schmerz über seinen Verrat an unserer Familie, den ich empfinde, auf eine andere Weise erfahren. Ich will, dass er leidet. Ich will, dass er innerlich zerbricht. Ich will ihn fühlen lassen, was ich fühle, jetzt wo ich nichts mehr habe. Nicht einmal mehr den Clan. Und töten ist alles, was ich kenne, was ich je gelernt habe. Also ist das der einzige Weg, ihm klarzumachen, dass er einen Fehler begangen hat. Der einzige Weg, um ihm zu zeigen, dass er nicht tun kann, was er getan hat.
Ich gehe um den Wagen herum zur Fahrertür, reiße sie auf und richte meine Waffe auf sie. »Aussteigen«, sage ich hart, packe mit der freien Hand ihren Arm und reiße sie aus dem Auto. Ich ignoriere ihre weit aufgerissenen Augen und zerre sie in das Scheinwerferlicht, dann stoße ich sie auf ihre Knie und richte die Waffe wieder auf sie. Meine Hände zittern. Meine Knie zittern. Mein Herz rast. Adrenalin peitscht durch meine Venen. Einen Menschen zu töten, löst die unterschiedlichsten Emotionen in mir aus. Beim ersten Mal habe ich gezittert, geheult und mich mehrmals davor und danach übergeben. Beim nächsten Mal hat sich mein Körper, jeder Muskel, jede Zelle angefühlt, als wäre ein Truck über mich hinweggerollt. Beim dritten Mal habe ich gar nichts gefühlt. Und jetzt? Jetzt brennt unbändige Wut auf mich, sie und ihren Vater in mir. Nein, ich will das hier nicht tun. Aber ich muss. Ich muss alles tun, um Sherwood dazu zu bringen, sich auf mich zu konzentrieren. Damit er keine Sekunde mehr an Sam denkt. Sherwood muss mich jagen.
Sie kniet vor mir, ihr Blick verfinstert sich, wird regelrecht hart und zornig. Sie wirkt, als hätte sie weniger Angst als ich in diesem Augenblick. Und das macht mich fertig.
»Schieß schon«, sagt sie herausfordernd, ihr Blick glüht vor Wut. Ich wusste, sie würde nicht flehen. In dem Punkt hat sie mich nicht enttäuscht. Aber diesen Mut, diese Stärke hätte ich nicht erwartet. Als wäre sie eine von uns. Was sie nicht ist. Weil es unmöglich ist.
Ich stehe da, die Waffe auf ihren Kopf gerichtet. Sie kniet, das Kinn stolz vorgereckt, blickt sie zu mir auf. In ihrem Blick nichts weiter als eisige Härte. Als würde sie das hier jeden Tag erleben und es könnte sie nicht mehr überraschen. Ich konzentriere mich auf das Blut auf dem Körper meiner Mutter und krame jede Einzelheit aus meinem Gedächtnis hervor: Ihre toten Augen, ihre zerrissene Kleidung. Ich rufe mir den Geruch von Blut und Erbrochenem zurück ins Gedächtnis und die Gefühle, die mich überwältigt haben, als ich sie so gefunden habe. Ihr Oberkörper war aufgerissen, ihre Gedärme herausgerissen, ihr Blick noch immer entsetzt. Ich konzentriere mich auf meine Wut und meinen Hass, den Schmerz, und versuche nicht, Ravens Gesicht zu sehen, sondern seins, auf das ich ziele.
»Worauf wartest du?«, schreit sie mich an. »Ich werde nicht betteln, vergiss es.« Sie spuckt mir vor die Füße.
Ihr Mut erschüttert mich. Und er nimmt mir die Luft zum Atmen. Zerreißt meine Wut regelrecht. Meine Hände zittern. Eigentlich tun sie das nie.
Mein Blick fällt auf das Grim Wolves Color auf der Innenseite meines Unterarms. Ich war einmal stolz, ein Teil des Clubs zu sein. Sherwood hat es zu einer großen Ehre gemacht, Mitglied in seinem MC zu sein. Und ich hatte mir nach drei Jahren als Vollstrecker seiner Urteile diese Ehre verdient. Ich hatte für ihn Abtrünnige gejagt und die getötet, die sich dem Clan und seinen Regeln nicht unterwerfen wollten. In den Augen der Abtrünnigen bin ich das größere Monster. Ein Verräter. Aber ich habe diese Aufgabe nie hinterfragt. Jeder Befehl meines Präsidenten war ein Befehl, dem ich gefolgt bin. So wurde ich ausgebildet.
Ich stelle mir vor, wie es sich anfühlen wird, Sherwood ein Foto von ihrer Leiche zu schicken. Aber diese Vorstellung fühlt sich nicht so an, wie ich erwartet hätte. Nicht, als könnte ich besser atmen, wenn ich sie erst getötet habe. Jetzt bin ich derjenige, der zweifelt. Und das alles wegen ihr. Ich wünschte, ich hätte sie sofort getötet, als ich sie zum ersten Mal in der Bar gesehen habe. Spätestens, als mir klar wurde, dass ihre Mutter nicht mehr auftauchen wird. Stattdessen habe ich zugelassen, dass sie mich ablenkt. Mich zögern lässt und sogar die Dunkelheit in mir anspricht.
Sie schnaubt abfällig, als ich die Waffe sinken lasse und steht auf. Ich stecke die Waffe weg, sie kommt auf mich zu und donnert mir eine recht beeindruckende Faust gegen mein Kinn. »War das jetzt ein Witz?«, will sie wissen und stapft an mir vorbei zum Auto. »Du kannst mich mal, ich fahr ohne dich weiter.«
»War es nicht«, sage ich und hole die Glock wieder hervor. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tue. Warum ich es mir anders überlegt habe. Ich weiß nur, ich kann sie nicht gehen lassen. Ich trete nah hinter sie, bevor sie einsteigen kann, und drücke ihren Körper mit meinem gegen den Pick-up. Der Lauf meiner Glock drückt gegen ihre Schläfe. Ich atme tief ihren süßen Geruch nach Frau ein. Was tut sie mit mir? Wieso kann ich sie nicht töten, obwohl ich nichts mehr will als das? Ich will meine Rache. Ihr Blut für das meiner Mutter. Ich will, dass Sherwood mich durch das ganze Land jagt, damit Will Zeit hat, Sam zu verstecken, wo Sherwood ihn niemals zwischen die Finger bekommen wird. Ich vergrabe meine Nase in ihrem Haar und treffe eine Entscheidung, die ich wahrscheinlich noch bereuen werde. Aber jede verdammte Zelle in meinem Körper verlangt danach, sie nah bei mir zu behalten. Ich muss sie gar nicht töten, um zu bekommen, was ich will. Sie muss nur bei mir bleiben. »Ich werde dich nicht töten, aber ich lasse dich auch nicht entkommen.«
»Fick dich«, flüstert sie mit zitternder Stimme abfällig.
»Fick dich«, stoße ich hervor. Meine Stimme zittert, aber nicht aus Angst, sondern vor Wut. Ich bin wütend auf ihn und wütend auf mich. »Was soll der Mist? Warum tust du das?«, fordere ich zu wissen und bin mir bewusst, dass ich ihn nur noch mehr provoziere, aber es ist mir egal, was sollte ich sonst tun? Wie sollte ich ihm sonst zeigen, dass nichts, was er tut, mich dazu bringen wird, ihn um mein Leben anzuflehen? Diese Genugtuung werde ich ihm nicht geben.
Sein heißer Atem trifft auf meine Wange, eine Hand liegt an meiner Kehle und mit der anderen drückt er seine Waffe gegen meine Schläfe. Sein Körper lehnt schwer gegen meinen. So nahe, dass ich sogar das heftige Trommeln seines Herzens spüren kann. Meins schlägt mindestens genauso schnell. Durch meinen Körper schießt Adrenalin. Ein beängstigendes und zugleich berauschendes Gefühl. Ich muss wahnsinnig sein, aber den dunklen Teil in mir spricht alles an dieser Situation an. »Steig in das Auto und rutsch rüber auf den Beifahrersitz«, knurrt er mich an. Er drückt den Lauf der Waffe noch fester gegen meine Schläfe, als wolle er mir damit verdeutlichen, wie ernst es ihm ist.
»Hast du mich nicht verstanden?«, fauche ich ihn an. Meine Hände liegen flach auf der Autotür. Wenn ich könnte, würde ich sie jetzt gern wie Krallen in das harte Material treiben, um meiner Wut irgendwie Ausdruck zu verleihen. »Ich habe ›Fick dich‹ gesagt.«
Er lacht düster hinter mir, löst seine Hand von meiner Kehle und tritt von mir weg. Seine freie Hand packt meinen Oberarm und zerrt mich von der geschlossenen Tür weg. »Aufmachen und einsteigen. Jetzt!«, brüllt er mich an. »Tu es, bevor ich die Geduld verliere, Kleine.«
Ich drehe mich zu ihm um und spucke ihm ins Gesicht, aber er zuckt nicht einmal mit der Wimper, stattdessen lacht er noch lauter. Sein Lachen scheint von überall um uns herum von den Bäumen zu hallen. »Bring es einfach hinter dich«, sage ich und kann nicht verbergen, dass meine Stimme meine Hoffnungslosigkeit widerspiegelt. Er steht vor mir, zwischen seinen Brauen hat sich eine Furche gebildet, so zornig ist er. Seine breiten Schultern heben und senken sich unter harten Atemzügen. Ich habe das Gefühl, er kämpft um jeden Funken Kontrolle, den er finden kann. Er senkt sogar seinen Blick und schließt für mehrere tiefe Atemzüge die Augen. Und doch kann ich ihm ins Gesicht blicken, weil er so viel größer ist als ich. Ich reiche ihm gerade einmal bis zur Brust. Ich bin ihm körperlich unterlegen. Was kann ich also tun?
Ich lege meine Hände an den Bund meiner Jeans und öffne den Knopf. Ich hebe trotzig meinen Blick und schlucke schwer, als Hitze sich durch meinen Körper frisst. Eigentlich wollte ich ihn mit dieser Geste provozieren, stattdessen erregt mich die Vorstellung, er könnte es wirklich tun. Mir die Kleidung vom Leib reißen und mich in den Dreck drücken. So wie Nick es häufig getan hat. Er hat mein Gesicht auf den dreckigen Boden seines Trailers gedrückt und mich dann zwischen Spritzen und leeren Flaschen gefickt, meine Hände gefesselt, in meinen Unterarmen und Schenkeln blutige Schnitte, die er oder ich selbst mir zugefügt haben, bis mein Körper so voller Adrenalin war, dass ich das Gefühl hatte, zu zerbersten. Nur wenn ich diesen Punkt erreiche, füllt sich die dunkle Leere in mir. Nur dann fühle ich wirklich. Ich schließe die Augen und kämpfe gegen die Bilder in meinem Kopf an. Das will ich eigentlich nicht. Ich hasse mich für diese Gedanken und Gefühle. Und ich hasse mich, dass ich jetzt in diesem Augenblick darüber nachdenke, es zuzulassen, dass ein Fremder all das mit mir tut. Jemand, der mit einer Waffe auf mich zielt. Auf gar keinen Fall. Das ist die Finsternis in mir, die das hier will. Aber wenn ich es zulasse, dann lässt er mich vielleicht gehen.
»Was zur Hölle machst du da?«, knurrt er und stößt mit der Waffe meine Hände von der Hose.
»Ich will es dir nur leichter machen, damit wir es schneller beenden können«, stoße ich aus. Denn genau das ist mein Plan: Ihm geben, was er will, damit er mich hoffentlich schnell wieder gehen lässt. Wenn ich mich nicht wehre, vielleicht sind dann meine Überlebenschancen viel größer. Ich reibe mir mit den Händen über meine fröstelnden Oberarme. Es ist nicht kalt, die Luft ist noch immer dick und warm, aber der Schock jagt mir Eis durch die Adern. Je länger wir hier stehen, desto mehr beginnt mein Körper zu zittern. Desto mehr weicht die Wut der Panik. Und das will ich nicht, weil ich dann schwach wäre. Und er soll nicht glauben, dass ich schwach bin.
»Ich werde dich nicht anfassen.«
»Was willst du dann von mir?«, fahre ich ihn an.
Ice zieht die Schultern bis zu seinen Ohren hoch und lässt sie wieder fallen. »Steig endlich in das verdammte Auto ein«, sagt er harsch, greift so schnell an mir vorbei, dass ich den Augenblick verpasse, in dem ich mit meinem Knie seine Hoden hätte erwischen können. Er reißt die Tür auf, packt mich brutal und zwingt mich in das Auto. Als ich auf dem Fahrersitz sitze, fällt mein Blick auf den Schlüssel, der noch immer im Zündschloss steckt und leicht hin und her schwingt. Ich zögere eine Sekunde zu lange, denn noch bevor ich meine Finger an den Schlüssel legen kann, hält Ice mir seine Waffe wieder an den Kopf. »Rüber«, befiehlt er mit hartem Tonfall.
»Du bist ein Arschloch«, stoße ich aus, rutsche aber auf den Beifahrersitz. Doch bevor ich nach drüben rutsche, greife ich hinter den Sitz, bekomme die Smith & Wesson zu fassen und zerre sie nach vorn. So schnell ich kann, richte ich mich auf, wende mich auf dem Beifahrersitz Ice zu und richte die Waffe auf ihn. Mein Finger liegt auf dem Abzug. Ich spüre den Druck des Stahls. Ich müsste nur etwas mehr Kraft ausüben. Mich nur überwinden, es zu tun. In meiner Vorstellung sehe ich es ganz deutlich, seine schreckgeweiteten Augen, das klaffende Loch in seiner Stirn.
Ich zögere nur einen Atemzug lang. Aber diese Zeit, in der mir durch den Kopf geht, wie es aussehen würde, wenn sein Gesicht vor meinen Augen explodieren würde, reicht ihm, um in das Auto zu steigen und sich auf mich zu werfen. Er bekommt den Lauf der Waffe zu fassen und richtet sie nach oben. Ein Schuss löst sich und hinterlässt ein walnussgroßes Loch in der Decke. Ich keuche auf, lasse zu, dass er mir die Waffe entreißt, und drücke meine Hände gegen meine Ohren, in denen der Knall klingelt.
»Die gehört Rage«, stellt Ice mit einem Blick auf das in den Griff geritzte R fest und setzt sich hinter das Lenkrad. Er verzieht das Gesicht und wirft die Waffe aus dem Fahrzeug. »Fuck! Fuck! Ich kann nicht fassen, dass du mich töten wolltest.«
Ich schnaube abfällig. »Du wolltest mich auch töten.«
»Aber ich hab es nicht getan.« Ice beugt sich zu mir rüber, packt mein Gesicht und drückt mir Daumen und Zeigefinger in die Wangen, bis ich zischend einatme vor Schmerz. Seine Augen wirken deutlich dunkler. »Tu das nie wieder.«
Erst als er den Motor startet und die Tür des Trucks zuzieht, spüre ich, wie sehr jeder Muskel in meinem Körper sich verkrampft hat und wie wenig handlungsfähig ich mich fühle. Aber ich kann ihn noch immer mit meinem Mundwerk provozieren. »Ich will wissen, was du mit mir vorhast.«
Ice steuert den Pick-up auf die Straße zurück. Er schnaubt, legt seine Pistole griffbereit zwischen seine Schenkel und hält das Auto nach nur wenigen Metern wieder an, um sich unter dem matten Licht der Lampe an der Decke im Cockpit umzusehen. »Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was ich mit dir tun werde, aber es wird hoffentlich weder dir noch deinem Vater gefallen«, sagt er, dann beugt er sich zum Ablagefach hin und zieht einen Spanngurt hervor. »Deine Hände!«
»Vergiss es«, stoße ich entrüstet aus und rücke von ihm weg so weit ich kann. Er kennt Rage, meinen Onkel. Er kennt meinen Vater. Das alles hier ist kein Zufall. Als mir das bewusst wird, droht der Schock mich zu verschlingen. Mein Körper zittert unkontrolliert. Ich sitze nicht zufällig neben ihm im Auto. Er kam nicht zufällig in die Bar, in der ich gearbeitet habe. Er wollte mich wirklich töten.
Sein Blick verengt sich und so schnell wie eine Kobra schnappt er nach meinen Händen und zieht sie zu sich. Er umwickelt meine Handgelenke mit einem Ende des Gurts, das andere Ende wickelt er sich um seine Faust. »Zuerst solltest du wissen, dass es besser ist, wenn du tust, was ich dir sage, dann werden wir uns wahrscheinlich besser verstehen.«
Ich lache dumpf auf und verziehe das Gesicht. »Und was sollte ich noch wissen?«
»Dass ich normalerweise nicht zögere, wenn es darum geht, einen Menschen zu töten.« Seine Miene wird hart, dann legt er den Kopf schief, und in seinen Augen kann ich sehen, dass er jedes Wort ernst meint. Er sagt die Wahrheit, einen Menschen zu töten, bedeutet ihm eigentlich nichts.
»Und warum zögerst du jetzt?«, will ich bissig wissen. Ich habe nicht vor, ihm zu zeigen, wie angespannt ich bin. Und ich habe nicht vor, mich verunsichern zu lassen. Ich weiß nicht viel über Entführungen, aber ich weiß, dass es wohl das Klügste wäre, wenn ich versuche, einen klaren Kopf zu behalten. Denn ich werde mich nicht einfach fügen. Wie konnte ich in so eine Situation geraten? Es hätte mir klar sein müssen, dass mit diesem Arschloch etwas nicht stimmt. Warum habe ich nicht auf das überlaute Warnsignal in meinem Verstand gehört? Weil ein anderer Teil meines Körpers lauter gebrüllt hat. Der Teil, der mich immer wieder Dummheiten begehen lässt. Der dunkle Teil, der auf der Suche nach etwas ist, von dem ich nicht weiß, was es ist.
Ice reibt sich mit dem Daumen über den Unterarm. Ich hatte bisher keine Zeit, mir seine Tattoos genauer anzusehen, aber diese Bewegung lenkt meine Aufmerksamkeit auf etwas, das ich kenne, weil ich es schon bei zwei Männern gesehen habe. Rage und meinem Vater. Beide hatten dieses Symbol auf ihren Lederkutten, wenn sie uns besucht haben. Es ist das Zeichen eines Motorradclubs, das weiß ich, weil ich manchmal fernsehe. Ich unterdrücke jede Reaktion, weil ich nicht will, dass Ice mitbekommt, dass ich das Symbol erkannt habe. Hier geht es also um irgendwelche Streitereien unter Bikern und ich bin unverschuldet dazwischengeraten.
»Vielleicht ist mir klar geworden, dass du mir lebend mehr hilfst«, sagt er mit einem breiten Grinsen. »Vielleicht ist mir aber auch klar geworden, dass Rache sich so viel besser anfühlen könnte, wenn man sie länger auskosten kann. Ich könnte dich jetzt töten und würde mich ein paar Tage, vielleicht auch nur Stunden, besser fühlen. Oder ich behalte dich einfach eine Weile und genieße die Vorstellung, wie viel wütender es deinen Vater machen wird zu wissen, dass du bei mir bist.« Ice packt mein Kinn und zwingt mich, ihn anzusehen. »Du bist die Rache für das Arschloch, das meine Mutter umgebracht hat, Stiefschwesterchen.«
Ich schnappe heftig nach Luft und reiße mich los, dann rücke ich so weit, wie es möglich ist, von ihm ab. Ich mustere Ices Gesicht nachdenklich. Vielleicht hoffe ich, darin eine Lüge zu erkennen, aber alles, was ich sehe, ist Hass und Wut. Ich weiß, mein Vater ist zu Gewalt fähig. Ich weiß, er ist alles andere als ein Heiliger. Trotzdem werfe ich ihm vor, gelogen zu haben. »Das ist nicht wahr.«
»Was davon? Dass du meine Stiefschwester bist?« Er zwinkert mir zu. »Glaub es, meine Mutter war die Frau deines Vaters, bis er sie ermordet hat.« Ice lacht und schüttelt den Kopf. »Du bist die Tochter eines Frauenmörders.« Seine Stimme klingt dabei giftig, hasserfüllt. Als würde er diese Worte regelrecht vor meine Füße kotzen.
Ich schnaube abfällig, erschauere aber innerlich und spanne jeden Muskel in mir an, weil ich ihm glaube. Irgendwie. Dass es da eine andere Familie gibt, würde erklären, weswegen er nur so selten bei uns vorbeigeschaut hat. Wusste meine Mutter davon? Aber ich kann ihm nicht sagen, dass ich ihm glaube. Mein Vater ist kein guter Mensch. Er hat meine Mutter manchmal so grün und blau geschlagen, dass ich darüber nachgedacht habe, ihn mit Rages Waffe zu erschießen. Ich war keine acht Jahre alt, als der Gedanke mir zum ersten Mal kam. Ich habe seine Besuche gehasst und war froh, dass er nur so selten vorbeischaute. Anders als bei Rage, ihn mochte ich. Er war ruhig, freundlich, hat mit mir lange Wanderungen im Wald gemacht und mich gelehrt, die Natur zu lieben.
»Du hast noch vor fünf Minuten gestanden, dass du auch tötest, was macht dich also zu etwas Besserem?«
Er sieht mich an und zieht einen Mundwinkel hoch. »Nichts, Süße. Rein gar nichts.«
Schaudernd ziehe ich mich mehr auf meine Seite zurück. Ich drücke mich so eng an die Tür, dass ein Teil von mir hofft, sie würde aufspringen, aber das wird nicht passieren, weil Ice die Türen von innen verriegelt hat. »Du willst mich vielleicht nicht töten, aber ich verspreche dir, ich werde nicht noch einmal zögern«, fahre ich ihn an. In meinem Inneren rast Blut und Adrenalin durch meine Venen, so sehr, dass ich kaum atmen kann und mir ganz schwindlig ist. Aber meine Stimme klingt fest und entschlossen, was ihn zu beeindrucken scheint, denn er wirft mir einen interessierten, fast schon amüsierten Seitenblick zu.
»Du bist ganz schön tough, Süße«, sagt er mit einem dunklen Funkeln in den Augen. »Zuerst einmal bleibst du einfach bei mir. Und dann sehen wir weiter. Ich könnte dich noch immer töten. Vielleicht morgen.«
Ich starre hoffnungslos aus dem Fenster, in der Ferne tauchen die Lichter der nächsten Stadt auf, aber als wir an die Kreuzung kommen, biegt Ice rechts auf die einsame Straße ab, die gut zwanzig Meilen durch nichts als Wald und Äcker führt. Als ich das sehe, sinkt auch die letzte Hoffnung in mir, ich könnte vielleicht in der Stadt irgendwie auf mich aufmerksam machen.
»Was bringt es dir, wenn mein Vater nicht einmal weiß, dass du mich entführt hast, um dich zu rächen?«, frage ich ihn und muss schreien, um den harten Rock zu übertönen, den Ice im Radio eingestellt hat. Ich hinterfrage es nicht einmal, ob Ice mir die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube ihm, dass mein Vater seine Mutter getötet hat. Es gab Situationen, da hat nicht viel gefehlt und er hätte meine auch getötet. Manchmal hat es ihn wütend gemacht, wenn er überraschend vorbeikam und sie high und betrunken war. Manchmal hat es ihn wütend gemacht, wenn sie so nervös war, dass sie sein Essen hat anbrennen lassen. Und manchmal hat sie auch gar nichts falsch gemacht. Was er nie getan hat, war mich zu schlagen. Aber wahrscheinlich hätte er mich dafür überhaupt erst mal beachten müssen. Das Einzige, was er mir jemals beigebracht hat, was ihm wichtig war: dass ich mich selbst schützen konnte, wenn er nicht da war.
Ice dreht das Radio leiser, sieht mich flüchtig an, dann zuckt er mit den Schultern. »Er wird es rausfinden, da bin ich mir sicher. Wann auch immer er wieder jemanden schickt, um nach dir zu sehen.«
»Ich lebe seit Monaten allein. Niemand war da, um nach mir zu sehen. Meine Mutter ist spurlos verschwunden, mein Vater war seit Jahren nicht mehr in Black Falls.«
»Sein Prospect war erst vor ein paar Wochen hier, sonst hätte ich dich gar nicht gefunden. Dein Vater hat dich also nicht vergessen. Er überwacht dich nur aus der Ferne.«
»Wieso sollte er das tun?«, will ich verwirrt wissen und bezweifle jedes Wort, das über seine Lippen kommt.
»Er macht sich eben Sorgen um dich, will aber nicht, dass jemand davon erfährt, dass es dich gibt. Er hat viele Feinde. Du bist seine Tochter. Es gibt einen Grund, warum er wegen dir unsere Gesetze missachtet hat.«
»Was für Gesetze?«
»Die, die deine Welt von unserer trennen.«
»Was ist das für eine Welt? Für Mörder und Vergewaltiger?«
»Die, in der er Kids dazu zwingt, für ihn zu arbeiten. Die, in der er mit meiner Mutter zusammen war und sie getötet hat. In der er Krieg gegen andere Clans führt und alles vernichtet, was ihm und seinen Zielen im Weg steht.« Ice knurrt diese Worte regelrecht und wirft mir einen hasserfüllten Blick zu. »Du weißt offensichtlich nichts über deinen Vater.«
Ich senke verlegen den Blick, als ich den Schmerz in Ices Augen sehe und ich diese tiefe Verletzung seiner Seele erkenne. Wahrscheinlich habe ich wirklich keine Ahnung, denn obwohl meine Mutter keinen Orden verdient hat, war sie doch auf ihre Art immer eine Mutter und mir ging es gut. Und Black Falls ist vielleicht die langweiligste Kleinstadt im ganzen Land, aber unser Leben dort war immer sicher. Ich schüttle mich, als mir klar wird, dass ich gerade einen Anflug von Mitleid mit meinem Entführer habe. Auf keinen Fall sollte ich solche Gefühle zulassen. Alles, was er von mir bekommen sollte, ist Hass und Zorn.
»Wir haben alle so unsere Probleme, aber das gibt dir nicht das Recht, mir das hier anzutun. Ich hab nichts mit dem zu tun, was er dir und deiner Familie angetan hat.«
»Was tue ich dir denn an? Du wolltest raus aus deinem Leben, ich helfe dir nur dabei«, schnaubt er, dann schaltet er das Radio an und dreht es so laut, dass klar ist, für ihn ist diese Unterhaltung beendet.
Ich drehe mich von ihm weg zur Tür hin, lehne meine Stirn wieder gegen die kühle Scheibe und erlaube es mir, in der Dunkelheit meinen Tränen freien Lauf zu lassen, während draußen Felder an uns vorbeihuschen, die in der Nacht kaum mehr als tiefschwarze Flächen sind, hin und wieder unterbrochen von kleinen Wäldern. Möglichst unauffällig versuche ich, den engen Strick um meine Handgelenke zu lockern und meine Hände aus den Schlingen zu befreien, aber je mehr ich mich darin winde, desto enger ziehen sich die Fesseln zusammen. Und als ich aufsehe und in das breit grinsende Gesicht meines Entführers blicke, gebe ich auf und lasse meine Hände kraftlos in meinen Schoß fallen.
Ich lehne mutlos den Kopf wieder gegen die Scheibe, und während ich meinen Tränen gestatte zu fließen, die Landschaft monoton an uns vorbeifliegt und ich darüber nachdenke, wie ich vor ihm fliehen kann, oder was mich am Ende dieser Reise erwarten könnte, kämpfe ich gegen die Müdigkeit, die mich befallen hat. Was ich auf gar keinen Fall tun darf, ist einschlafen. Die Kontrolle über das verlieren, was mit mir geschehen wird. Wenn ich überhaupt noch Kontrolle darüber habe. Aber der Gedanke einzuschlafen, macht mir noch mehr Angst. Er lässt mich befürchten, dass im Schlaf Dinge passieren könnten, die meine Situation noch verschlimmern könnten. Oder vielleicht könnte ich eine Möglichkeit zur Flucht verpassen. Oder ich könnte aufwachen und alles wäre nur noch grauenvoller als jetzt schon. Wenigstens weiß ich jetzt noch, wo ich mich befinde. Aber wenn ich einschlafe … Ich könnte wer weiß wo aufwachen.