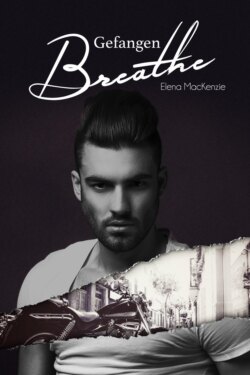Читать книгу Breathe - Elena MacKenzie - Страница 9
4
ОглавлениеFür einen Moment war ich davon überzeugt, sie würde versuchen, der Frau am Empfang einen Hinweis zu geben. Ihr zuflüstern, dass sie entführt wurde und Hilfe braucht. Ihr unsicherer Blick war immer wieder in meine Richtung gezuckt, als wollte sie sichergehen, dass ich nicht bemerken würde, wenn sie der Frau etwas zuraunt. Nur deswegen habe ich mich nahe an die Tür gestellt, damit sie gewarnt ist, denn ich hätte die Frau getötet. Ihr Leben hätte mir nichts bedeutet. Ich hätte nicht einmal darüber nachgedacht, wen sie hinterlassen hätte. Es wäre mir egal gewesen. Denn genau dafür wurde ich ausgebildet, zu tun, was nötig ist, um mich und meinen Auftrag zu schützen. Ich habe bisher nur ein einziges Mal nicht getan, was nötig war, als ich Raven am Leben gelassen habe.
»Es war gut, dass du es dir noch einmal überlegt hast«, sage ich und folge ihr zum Zimmer Nummer 14. Die Tür sieht so heruntergekommen und dreckig aus wie der Rest des Gebäudes. Wahrscheinlich sieht das Zimmer genauso aus, aber das macht mir nichts aus. Ich bin es gewohnt, im Dreck zu leben. Ich habe nie etwas anderes als das gehabt. Motels, Scheunen, den Waldboden. Je nach Auftrag musste ich mich manchmal mehrere Wochen an die Fährte eines Abtrünnigen hängen. Und viele von ihnen leben versteckt im Untergrund, in Höhlen, Zelten oder Abrisshäusern. Und wenn ich sie gejagt habe, war ich oft gezwungen, mich ihnen anzupassen, um herauszufinden, ob dort, wo sie herkommen, vielleicht noch mehr von ihnen leben.
Sie schaut über die Schulter zurück und zuckt nur mit den Achseln. »Soll ich dir danken, dass du sie nicht umgebracht hast?«, stößt sie düster aus und tritt zur Seite, damit ich die Tür aufschließen kann.
Ich lege grob eine Hand um ihren Nacken, drücke den Daumen gegen ihren Kiefer und sehe ihr fest in die traurigen Augen. »Du solltest mir danken, dass ich dich noch nicht umgebracht habe.« Langsam beuge ich mich zu ihr nach unten und vergrabe meine Nase in ihrem Haar. Es ist schwarz, aber nicht so schwarz wie meins. Eher eine Mischung aus Mitternachtsschwarz und dunkler Schokolade. Je nachdem, wie das Licht darauf scheint. Ich atme tief ein, laut genug, damit sie hört, was ich da tue, und kann ein Grinsen nicht unterdrücken, als sich ein Zittern durch ihren Körper arbeitet. Ich stelle mir vor, dieses Zittern wurde durch meine Nähe ausgelöst und nicht aufgrund ihrer Angst vor mir. Danach lasse ich sie so abrupt los, als hätte ich mich an ihr verbrannt, öffne die Tür und stoße sie grob in das Zimmer. Je mehr Zeit ich mit ihr verbringe, desto mehr spricht ihr Duft mich an. Es erregt mich, wie sie riecht. Es löst ein Zerren in mir aus, wie ich es noch bei keiner anderen Frau erlebt habe. Aber mit den meisten Frauen verbringe ich auch nicht so viel Zeit wie mit ihr. Weil es für jemanden wie mich keinen Grund dafür gibt. Ich nehme mir von einer Frau, was ich brauche, und vergesse sie danach. Mehr Zeit in eine Frau zu investieren macht für uns einfach keinen Sinn.
Noch bevor ich das Licht anschalte, verschließe ich die Tür wieder hinter mir. Das Zimmer ist definitiv so schäbig, wie ich gedacht habe. Im Raum stehen zwei einzelne Betten, auf denen hässliche kaffeebraune Tagesdecken liegen. Die moosgrüne Tapete an den Wänden war in den 70ern mal modern. Und so alt wie die Tapete ist auch der kleine Fernseher und die Kommode an der Wand.
»Nun mach schon«, dränge ich sie weiter in das Zimmer, als sie keine Anstalten macht, von der Tür wegzutreten.
Sie wendet sich abrupt zu mir um und sieht mich flehend an. »Wirklich, was auch immer mein Vater angestellt hat, ich kann nichts dafür. Lass mich gehen.«
Ich schüttle den Kopf und dränge sie mit meinem Körper so lange rückwärts, bis sie mit ihrem Hintern auf dem zweiten Bett landet. »Das geht nicht. Aber ich verspreche dir, wenn ich es könnte, dann würde ich es tun.« Ich lächle sie breit an und fühle mich erregt von der Hitze ihres Körpers, ihren weit aufgerissenen Augen und dem direkten Blick auf ihren Mund, den ich habe, wenn ich auf sie herabsehe. Sie spürt meinen Blick und leckt sich über die Lippen. Als sie bemerkt, was sie da tut, presst sie die Lippen fest aufeinander und wendet den Blick ab.
Ich packe ihre Handgelenke und zerre Raven über die Matratze zum Kopfende, um sie dort an den Metallstreben festzubinden. Ich lasse meinen Blick über ihre gefesselten Hände gleiten, ihren Körper, der wie dahingestreckt auf dem Bett vor mir liegt, und schlucke schwer bei dem Anblick. Sie liegt da wie ein Geschenk, nach dem ich nur greifen muss. Das nur darauf wartet, von mir verschlungen zu werden. Ich lasse mir Zeit damit, ihren Körper zu studieren, einfach, um sie zu provozieren. Es gefällt mir, sie zu verärgern. Und ihr Körper gefällt mir auch. Sie ist schlank, sportlich, mit sanften Rundungen. Ihr Bauch ist flach und ihre Oberschenkel muskulös. »Cheerleader«, kommentiere ich abfällig.
»Geht dich einen Dreck an, aber nein, Läuferin«, sagt sie und zerrt an ihren Fesseln. »Wollten wir nicht essen?«
»Du läufst also gern? Staffel? Kurzstrecke?«, hake ich weiter nach. Sie hat etwas an sich, das meine Neugier schürt. Ich will mehr über sie wissen und kann mir nicht einmal erklären, warum. Warum sollten mich ihre Hobbys interessieren? Warum will ich wissen, was sie denkt, wenn ich sie ansehe? Was fühlt sie, wenn ich meine Hand nach ihr ausstrecke und sie berühre? Warum will ich überhaupt etwas über sie wissen? Ich schiebe die Gedanken weg, wahrscheinlich stehe ich nur hier, um sie immer weiter zu provozieren, weil ich eine perfide Freude daran habe, wie sich ihr Puls beschleunigt, ihre Wangen verfärben und sie vor Wut hektischer atmet.
»Ich steh nicht so auf Gruppenaktivitäten. Ich laufe für mich allein.«
Ich bohre einen Finger in ihren Oberschenkelmuskel, der sich unter dem Stoff der knielangen Hose abzeichnet, und ziehe eine Augenbraue hoch. »Sieht mir nach mehr als nur Laufen aus.«
»Ich wandere manchmal auch. Reden wir jetzt ernsthaft über meine Hobbys?«, blafft sie mich an. »Wir wollten essen gehen.«
Ich setze mein breitestes Grinsen auf, um ihr zu zeigen, dass ich sie durchschaut habe. Sie will nicht essen, sie hofft auf eine Möglichkeit zu entkommen. »Ich wollte essen, du bleibst schön hier.« Ich wickle das rote Bandana von meinem Handgelenk und mache einen Knoten in die Mitte, den ich ihr zwischen die Lippen schiebe.
»Nein«, keucht sie auf und wehrt sich dagegen, dass ich ihr einen Knebel um den Kopf binde. Mir macht das hier auch keinen Spaß, aber ich darf kein Risiko eingehen, weil ich sie brauche. Vielleicht benutze ich sie einfach als Schutzschild, sollte Sherwood mich jemals finden. Und ich bin mir sicher, er wird mich irgendwann finden. Und dann wird er mich töten und nach Sam suchen. Aber bis dahin hat Will ihn hoffentlich weit weggebracht. Ich habe Raven nicht getötet, so wie es geplant war. Aber ich kann sie wenigstens benutzen, um unsere Freiheit auszuhandeln. Ich kann sie bei mir behalten und mich an dem Gedanken erfreuen, wie sehr es Sherwood quälen wird, nicht zu wissen, was mit seiner Tochter geschehen ist. Ich kann sie als Köder benutzen und ihn mit ihrer Hilfe zwingen, mich statt Sam zu jagen. Ich könnte so viel tun, woran ich bis vor wenigen Stunden noch nicht einmal gedacht habe. Das macht sie. Sie löst das in mir aus und lässt mich tausend Gründe erfinden, warum ich sie noch immer bei mir habe.
Raven beginnt sich noch heftiger zu wehren, sie tritt nach mir aus, während ich verzweifelt versuche, einen Knoten an ihrem Hinterkopf zu knüpfen. Als mir die Enden des Tuchs immer wieder entgleiten und ihr Fuß beinahe meine empfindlichste Stelle trifft, reicht es mir. Ich werfe mich auf sie und fixiere sie so unter meinem Körper. Ihre weit aufgerissenen Augen zeigen mir deutlich, wie sehr ich sie damit erschrecke. Damit hat sie nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ihr Geruch steigt mir in die Nase, dunkel und erregend. Etwas, das mich anspricht und an mir zerrt. Ich vergrabe die Nase in ihrem Haar und atme ein. Ihr Duft weckt Verlangen nach ihr in mir. Raven hat eine verwirrende Wirkung auf mich. Intensiv.
Sie wird plötzlich ganz steif und hört auf, sich zu winden. Einige Sekunden lang kann ich nichts außer ihre Kurven unter mir spüren. Und ich weiß nicht, ob ich genieße oder verabscheue, was ich fühle. Aber ich fühle viel mehr als ich möchte. Und sie spürt die Reaktion meines Körpers, denn ihre Augen werden noch größer und ein leises Wimmern dringt durch den Stoff des Bandanas.
So schnell es mir möglich ist, klettere ich von ihrem Körper. »Glaubst du wirklich, ich könnte dir so etwas antun?«, frage ich sie, noch bevor mir klar wird, dass sie genau das denken muss und wie blöd meine Frage ist. Ich töte Menschen, habe ihr damit sogar gedroht, natürlich glaubt sie, dass ich sie auch vergewaltigen würde. Ich fahre mir frustriert durch die Haare und murmle eine Entschuldigung, was genauso bescheuert ist, wie anzunehmen, dass sie keine Angst davor hat, ich könnte sie vergewaltigen. Ich habe sie entführt, dafür gibt es keine Entschuldigung, auch nicht dafür, dass ich sie ständig mit dem Tod bedrohe.
»Ich gehe jetzt unter die Dusche, danach besorge ich uns etwas zu essen«, sage ich, reiße mir mein Shirt vom Körper und lasse es auf den Boden fallen.
Unter der Dusche lasse ich das Wasser kalt über meinen Körper fließen. Nicht, um mich herunterzukühlen, sondern weil ich immer kalt dusche. Weil ich das schon als Kind so beigebracht bekommen habe. Sherwood hat uns mit eiskaltem Wasser abgeduscht, um »aus kleinen Weicheiern echte Soldaten zu machen«. Es ist wie ein innerer Zwang, an einigen Dingen festzuhalten, die er uns eingetrichtert hat. Sie sitzen in meinem Kopf, haben sich dort eingenistet und ich bin nicht dazu in der Lage, sie dort herauszubekommen.
Jede Handlung, einfach alles, was ich tue, ist genau abgestimmt: Die Motels, in denen ich absteige, die Art, wie ich ein Opfer erst ausspioniere, meine Namen, die ich benutze, bis hin zur allabendlichen Reinigung meiner Waffen und dem antrainierten leichten Schlaf. In seinem alten Leben war Sherwood ein Seal, danach Mitglied eines Motorradclubs, der den Ruf hatte, nicht zimperlich mit seinen Feinden zu sein. Seine Ausbildungsmethoden für uns waren gnadenlos.
Nur Raven, sie bringt alles durcheinander. Und die Gefühle, die sie in mir auslöst. Als würde sie nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Geist in Aufruhr versetzen. Als könnte sie die Finsternis durchdringen und die Kälte vertreiben. Da ist viel mehr als nur das Bedürfnis, ihr nahekommen zu wollen. Da ist ein Hunger, der tief in mir nach ihr brüllt. Keine andere Frau zuvor hat ein solches Chaos in meinem Verstand gestiftet und meine andere Seite so in Aufruhr versetzt.
Ich verlasse die Dusche, meine Haut ist eiskalt, aber das bemerke ich kaum noch, und schnappe mir das dünne Duschtuch, um es mir um den Körper zu schlingen. Durch die weit offen stehende Tür bemerke ich, dass Raven jede meiner Bewegungen beobachtet. Sie ist so vertieft in den Anblick meiner bunten Haut, dass sie sich erschrocken abwendet, als sie mitbekommt, dass ich sie dabei ertappt habe, wie sie meine Brust mustert.
Ich unterdrücke das Grinsen, das sich auf meinen Lippen breitmachen will, trete nur mit dem Handtuch um meine Hüften in das Zimmer an mein Bett und krame frische Kleidung aus meiner Reisetasche, dann lasse ich das Handtuch einfach zu Boden fallen und schlüpfe in meine Lederhosen und ein ausgeblichenes schwarzes Shirt.
»Gefällt dir, was du siehst?«, frage ich sie, schließe meine Tasche wieder und schiebe mein Messer zurück in meinen Stiefel, ohne sie anzusehen.
Raven schnaubt nur abfällig und wendet ihr Gesicht trotzig dem Fenster zu. Ich habe vorhin die Vorhänge zugezogen, damit niemand zu neugierig wird. Außerdem habe ich den Tisch vor das Fenster geschoben und einen Sensor daraufgestellt, wenn jemand versucht, durch das Fenster hereinzukommen, wird der Sensor ihn zwar nicht abhalten, aber er wird genug Krach machen, um mich aus meinem Schlaf zu wecken. Und dann mache ich ihn mit meiner Knarre bekannt. Meinen Fäusten oder dem Grim Wolve in mir. Je nachdem, wonach mir der Sinn steht.
»Ich bin in zehn Minuten zurück«, sage ich zu Raven und deute auf den Sensor, den ich neben die Tür gestellt habe. »Bewegt sich etwas in diesem Zimmer, oder öffnet sich die Tür, werde ich das sofort erfahren.« Ich öffne die Tür, dann aktiviere ich den Sensor und deute auf mein Handy, das sofort eine Nachricht ankündigt, als ich an dem Sensor vorbeigehe.
Raven kommentiert meine Demonstration nur mit einem lauten Grunzen.
»Wir verstehen uns also«, sage ich und verschließe die Tür.
Ich spüre noch immer das Gewicht seines Körpers auf mir. Das Gefühl, ihm ausgeliefert zu sein, kam mir so erstickend vor wie die Sekunden, in denen er seine Waffe auf mich gerichtet hatte und ich dachte, er würde mich töten. Was wäre wohl schlimmer? Eine Kugel im Kopf und sterben oder vergewaltigt zu werden? Ich entscheide mich für die Vergewaltigung, weil sie länger dauern würde. Eine Kugel im Kopf wäre ein schnellerer und gnadenvollerer Tod.
Seine Erregung zu spüren und zu fühlen, dass mein Körper darauf reagiert hat, hat meine Angst nur noch größer gemacht. Und jetzt liege ich hier, angeekelt von mir selbst mit noch immer pochender Klitoris zwischen meinen Schenkeln. Wie kann mein Körper so empfinden? Wie kann er sich danach sehnen, meinem Entführer noch einmal so nah zu sein? Seinen Geruch nach Mann in der Nase, seine Wärme, sein Atem auf meiner Wange. Ich kenne die Antwort auf diese Fragen nur zu gut, weil Ice die Dunkelheit in mir anspricht und ich weiß, genau wie Nick noch bis vor ein paar Wochen, könnte auch er die Leere in meinem Inneren für kurze Zeit füllen. Es ist verwirrend, aber es scheint, als würden meine Gefühle einen Krieg ausfechten. Da ist die Anziehung, die Ice seit dem Tag auf mich ausübt, an dem er in der Bar aufgetaucht war. Und da ist der Hass und das Entsetzen, das die letzten Stunden in mir ausgelöst haben. Ich möchte mich nicht von ihm angezogen fühlen. Nicht nach dem, was er getan hat. Und dass mein Körper es doch tut, lässt meinen Puls vor Selbstverachtung rasen.
Wütend zerre ich an meinen Fesseln. Ich stöhne gegen den Knebel an, strample mit den Beinen und winde mich verzweifelt. Ich muss hier raus. Ich muss weg von ihm. Nicht wegen meiner Empfindungen, sondern vor allem, weil ich nicht aufgeben will. Ich will mich nicht von ihm besiegen lassen. Und ich will mich nicht von ihm für seine Rache an meinem Vater benutzen lassen. Ich zerre und ziehe so heftig, dass das Kopfteil des Bettes dumpf gegen die Wand stößt und jemand auf der anderen Seite wütend dagegen schlägt.
»Fickt gefälligst leiser«, brüllt er laut genug, dass ich ihn gut verstehen kann. Die Wände sind nur dünn.
In der Sekunde keimt Hoffnung in mir auf und ich winde mich noch stärker, stoße das Bett mehrmals gegen die Wand und stöhne »Hilfe« gegen den Stoff in meinem Mund. Wieder drischt der Mann nur gegen die Wand und brüllt: »Wenn ich rüberkomme, reiße ich euch den Arsch auf. Ich will verdammt nochmal schlafen.«
Als er droht rüberzukommen, fällt mein Blick auf die Sensoren - kleine weiße Zylinder, die Ice aufgestellt hat -, und ich erinnere mich wieder an seine Drohung, jeden zu töten. Meine Muskeln erschlaffen und ich sinke hoffnungslos zurück auf das Bett. So wenig wie ich schuld am Tod meines Vaters sein will, so wenig will ich schuld am Tod eines Fremden sein.
Ich beiße auf den Knebel, der schon ganz feucht von meinem Speichel ist und schlucke. Der Stoff schneidet in meine Mundwinkel ein und verursacht ein Brennen, außerdem habe ich das Gefühl, dass immer mehr Speichel in meinen Mund fließt und ich durch die Nase schlecht Luft bekomme.
Ich weiß, dass ich mir das nur einbilde. Dass die Panik mir das einredet, aber es fühlt sich real an. Obwohl meine Nase frei ist, glaube ich, nicht genug Sauerstoff in meine Lunge zu bekommen. Ich versuche schneller und tiefer zu atmen, meine Nägel drücken sich krampfhaft in meine Handflächen und vor meinen Augen tanzen Punkte. Ich kann nicht atmen. Und je mehr ich nach Luft ringe, desto weniger bekomme ich. Desto schneller rast mein Herz. Desto schmerzhafter sind die Fesseln. Ich beginne, um jeden Atemzug zu kämpfen, bis ich mir mit einem Schrei Luft verschaffe, der vom Stoff verschluckt wird und sich doch befreiend anfühlt. Meine Panik versiegt langsam und die Wut auf diesen Mann, der plötzlich mein Leben kontrolliert, kommt zurück.
Ich starre an die vergilbte Decke über mir und denke an all die Pläne, die ich geschmiedet hatte und die ich jetzt nicht mehr erfüllen würde. Ich denke an meine Mutter und unsere wenigen glücklichen Momente. Und ich versuche mir das Gesicht meines Vaters ins Gedächtnis zu rufen, aber ich habe ihn zu selten und schon zu lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nur noch, dass er einen dunklen Vollbart hatte und viele Tattoos. Er hatte immer diese Bikerjacke an, die er ›Kutte‹ nannte. Und seine Stimme war sehr dunkel und rau gewesen. An seinem Hals hatte er eine dicke grauenvolle Narbe, die er hinter seinem Bart zu verbergen versuchte, was ihm aber nur schlecht gelang. Er hat absoluten Gehorsam gefordert. Wenn er bei uns war, hat sich immer alles nach ihm gerichtet. Er war hart, hat ständig gewollt, dass jede Aufgabe, die er meiner Mutter oder mir gestellt hatte, sofort erledigt werden musste. Wollte er essen, musste sofort etwas zubereitet werden. Wollte er ein Bier, musste ich es ihm sofort bringen. Und wollte er, dass ich seine Stiefel putze, musste auch das auf der Stelle geschehen. Meine Mutter hat sich immer unterwürfig verhalten, kaum gewagt zu atmen, wenn sein Blick sie getroffen hat. Ich habe diesen Mann gehasst. Und jetzt wurde ich wegen ihm entführt. Weil er eine Frau getötet hat. Mich würde es nicht wundern, wenn er sie zu Tode geprügelt hat.
Ich fahre erschrocken zusammen, als die Tür aufgerissen wird und gleich darauf ein Piepen eine Nachricht auf einem Handy ankündigt. Ice grinst mich breit an, auf einer Hand balanciert er Einmalgeschirr, mit der anderen verschließt er die Tür hinter sich. Er tritt näher an mein Bett, stellt das Essen ab, dessen Duft mir in die Nase steigt und meinen Magen knurren lässt, dann beugt er sich über mich und starrt mir in die Augen.
»Wirst du auch brav sein?«, will er wissen und legt seine warmen Hände an meine Wangen. Er wischt mit seinen Daumen die letzten Spuren meiner Tränen weg. »Wirst du schreien, wenn ich dich losmache?«
Alles in mir verlangt danach, gefälligst zu schreien und um meine Freiheit zu kämpfen, aber dann fällt mein Blick auf seine Waffe, die er vorn im Bund seiner Hose trägt, also nicke ich ergeben. Nicht zuletzt, weil ich Hunger habe und das Essen so köstlich riecht, dass ich im Moment alles dafür tun würde.
Ice löst zuerst meinen Knebel. Meine Lippen fühlen sich ganz taub an, als der Stoff endlich weg ist. Ich bewege meinen Mund und bereue es sofort, als Schmerz sich ausbreitet. Auch meine Hände schmerzen und meine Arme protestieren, als ich sie nach unten nehme. Es dauert ein paar Sekunden, bis das Gefühl in meinen Armen und Händen zurückkommt.
Ice reicht mir den Teller aus Styropor und eine Büchse Cola. Ich nehme beides und rutsche an den Bettrand, um aufzustehen und mich an den Tisch zu setzen.
»Bleib wo du bist!«, befiehlt er. »Du kannst auf dem Bett essen. Das ist weiter von der Tür weg.« Er setzt sich auf sein Bett und beobachtet mich dabei, wie ich den locker sitzenden Plastikdeckel von dem Teller hebe und genüsslich den Duft von Chili con Carne inhaliere.
Ich breche vorsichtig etwas von dem Brötchen ab, das auf einer Ecke des Tellers liegt und durch den Wasserdampf schon etwas feucht geworden ist. »Ich hoffe, dir hat dein Essen geschmeckt«, sage ich schnippisch, weil ich irgendetwas sagen muss, um mich davon abzulenken, dass er mich beobachtet.
Er fährt sich durch diese schwarzen, glänzenden Haare, die immer etwas wirken, als wären sie vom Wind zerzaust worden, und leckt sich nachdenklich über die Lippen. Seine Gesichtszüge sind ausdrucksstark, seine Nase geradezu aristokratisch, seine Wangenknochen hoch und ausgeprägt. Seine Vorfahren müssen American Native gewesen sein. Nur seine Augen sind zu hell. In ihnen kann man die tiefe Verletzung, die er erlitten hat, sehen. Er trägt sie offen zur Schau, ohne sich die Mühe zu machen, zu verstecken, wie sehr ihn sein Schmerz quält. Vielleicht kann ich ihm deswegen nicht wirklich böse sein. Ich sollte ihn mehr verabscheuen, aber sein Schmerz wurde durch meinen Vater verursacht und deswegen fühle ich mich auch schuldig.
»Ich kann zumindest nicht behaupten, dass ich oft etwas zu essen bekomme, das besser ist«, antwortet er, steht vom Bett auf, zieht seine Waffe aus dem Bund und setzt sich damit an den Tisch. Er beginnt die Waffe auseinanderzunehmen und in ihre Einzelteile zu zerlegen. Die silberfarbenen Patronen reiht er fein säuberlich vor sich auf, bevor er mit seinem Shirt über den Lauf der Pistole wischt.
Vielleicht wäre dieser Augenblick der beste, um zu fliehen. Aber er sitzt direkt neben der Tür, wo er mich einfach nur packen bräuchte. Und wer weiß, was er dann tun würde, also bleibe ich, wo ich bin und schiebe mir den ersten Löffel lauwarmen Chilis in den Mund. »Warum bekommst du selten was Besseres?«, frage ich ihn, nachdem ich die zerkochte und wenig gewürzte Masse heruntergeschluckt habe. Das Essen ist wirklich nicht gut und ich bekomme schon fast Mitleid mit ihm, wenn es das ist, was er normalerweise bekommt.
»Weil ich die meiste Zeit in Spelunken wie dieser esse«, murmelt er vertieft in seine Arbeit.
Ich beobachte ihn ein paar Sekunden und versuche abzuwägen, wie abgelenkt er wohl ist. Versuchsweise bewege ich mich etwas auf dem Bett und stoße frustriert die Luft aus, als er sofort aufblickt und mich warnend ansieht.
»Wenn du nicht essen möchtest, dann kann ich es auch entsorgen«, sagt er leise. Sein Blick gleitet über mich und die plötzliche Kälte in seinem Gesicht lässt mich erstarren.
»Ich esse es«, stoße ich hart aus und beginne, das Chili runterzuwürgen. Ich esse es wirklich nur, weil ich Hunger habe und nicht weiß, wann ich das nächste Mal etwas bekommen werde. Selbst meine Mutter hat ein besseres Chili kochen können.
»Du hast ungewöhnliche Augen«, rede ich in der Hoffnung weiter, dass sich etwas wie eine Beziehung zwischen uns aufbaut. Meine beste Chance ist es, ihn dazu zu bringen, mich zu mögen, zu glauben, wir wären so etwas wie Freunde. Ich hoffe, dass ich dann sicherer bin und er weniger scharf darauf sein wird, mich in seiner Gewalt zu behalten. Es sollte selbst jemandem wie ihm schwerer fallen, einen Menschen zu töten, zu dem man eine Verbindung aufgebaut hat. Vielleicht irre ich mich aber auch. Woher will ich schon wissen, wie leicht oder schwer es ist, einen Menschen zu töten?
»Ungewöhnlich für einen Lakota?«, will er abfällig wissen und mustert mich mit hartem Blick. Ich verspanne mich, weil es nicht das ist, was ich sagen wollte. Er verzieht das Gesicht, als er meine Reaktion bemerkt und schüttelt entschuldigend den Kopf. »Meine Mutter hatte skandinavische Vorfahren.«
»Sind ihre Augen auch so ungewöhnlich hell gewesen?«, hake ich weiter nach und schiebe mir einen Löffel der lauwarmen Pampe in den Mund.
»Heller.« Ice setzt seine Waffe wieder zusammen, danach läuft er durch das Zimmer, sichert die Türen und Fenster mit seinen Sensoren und stellt zusätzlich einen Stuhl vor die Tür. »Wenn du duschen willst, solltest du dich beeilen, ich will nämlich schlafen«, sagt er düster mit einem Blick auf meinen Teller, der noch immer halb voll ist.
»Du kannst auch schlafen, während ich esse«, werfe ich mit einem Schnauben ein.
Ice lacht laut auf und schüttelt seinen Kopf, dann schaut er mich mit hochgezogener Augenbraue an. »Für wie dumm hältst du mich?«
Ich schnappe nach Luft, weil ich gar nicht weiß, was er meint. »Dieses Zimmer ist besser gesichert als Fort Knox, glaubst du ernsthaft, ich käme hier raus, während du schläfst?«, entrüste ich mich.
»Nein, das glaube ich nicht«, sagt er trocken und tritt an das Fußende meines Bettes. Sein Blick verengt sich grimmig. »Aber ich will dich auch nicht erschießen müssen, weil du es versuchst.«
Ich stelle meinen Teller weg, hebe ihm die Hände hin und knurre. »Nun fessle mich schon«, fordere ich.
Er grinst breit, und in seinen Augen funkelt etwas, als er näher kommt. »Und du bist dir sicher, dass du nicht duschen möchtest?«
»Ich werde bestimmt nicht duschen, während du dabei zusiehst.« Ich hebe noch einmal auffordernd meine Hände.
Ohne weiter abzuwarten, packt Ice meine Handgelenke, zieht meine Hände bis an das Kopfende und fesselt mich wieder. »Wie du willst.« Er senkt seine Lippen an mein Ohr. »Glaub nicht, dass das hier kein Vergnügen für mich ist. Das ist es. Und mir gehen dabei Bilder durch den Kopf …«
»Halt den Mund«, schnauze ich ihn an. »Ich will es nicht hören. Mir nicht einmal vorstellen müssen.«
Ice zieht lachend meine Fesseln fest, kontrolliert sie noch einmal und wirft sich dann auf sein Bett. »Süße Träume«, sagt er kühl und knipst das Licht aus. Und lässt mich mit meinen Gedanken und Ängsten allein in der Dunkelheit zurück. Alles, was ich Sekunden später noch höre, sind seine tiefen, ruhigen Atemzüge und ein Hund, der irgendwo in der Nähe bellt. Ich bin müde, aber die Augen zu schließen, würde bedeuten, das letzte bisschen Kontrolle aufzugeben. Und doch schlafe ich irgendwann ein und träume davon, durch einen Wald zu rennen. Ich renne immer schneller, viel schneller als es mir möglich sein sollte. Und hinter mir höre ich den schweren Atem eines Verfolgers, der sehr schnell näherkommt.