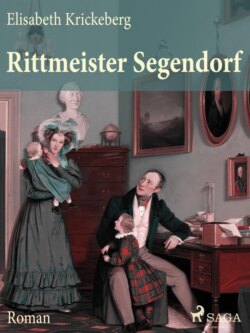Читать книгу Rittmeister Segendorf - Elisabeth Krickeberg - Страница 3
1. Kapitel.
ОглавлениеAlso er kommt!“ sagte der alte Baron von Segendorf, indem er einen soeben erhaltenen Brief mit einer Miene der Befriedigung, wie bei unverhofftem Gelingen eines schweren Werkes, aus der Hand legte.
Er sass mit seiner Enkelin Mite am Frühstückstisch. Das junge Mädchen blickte nur eben flüchtig von ihrer eigenen Korrespondenz auf und warf gleichmütig hin: „Nun, da kannst du dich ja freuen, Grosspapa!“
„Nein, da kann ich mich nicht freuen!“ rief der alte Herr mit einem Ton, der die zufriedene Miene Lügen strafte, „solch junger Schnüffel in die grosse Wirtschaft — lächerlich!“
„Aber Grosspapa, dann hättest du doch einen älteren, erfahreneren Beamten nehmen sollen —“
„Als ob ein ‚älterer, erfahrenerer‘ Inspektor sich auf so eine Klitsche und mitten ’rein in die Lotterwirtschaft hier setzen würde!“ — Der alte Herr regte sich immer mehr auf. Seine von Natur rote Gesichtsfarbe spielte ins Kupferne, der breite Mund unter dem weissen, ausrasierten Kaiserbart kniff sich grimmig zusammen, und die lichtblauen Augen gaben sich wenigstens alle Mühe, ihren gewöhnlichen Ausdruck einer wahrhaft kindlichen Gutmütigkeit unter einem erregten Funkeln zu verbergen. „Und für das Gehalt, das ich ihm bieten kann!“ fuhr er fort. „Nee, Kinning, auf den Leim geht bloss ein junger Dummbart, der noch mit der Zusicherung der unbedingten Selbständigkeit zu ködern ist. — Pah!“ — er schlug mit der Hand verächtlich durch die Luft — „der letzte Versuch! — Gelingt dem Neuen auch nicht, die Karre aus dem Dreck zu schieben, — na, dann ade Segendorf. Dann überlassen wir den Schwindel hier den Herren Gläubigern, Kinning, leben ein paar Jahr noch gut und machen dann auf ’ne anständige Art Schluss — du mit ’ner vernünftigen Heirat und ich mit ... na wie sich’s für ’nen alten Kerl geziemt.“
„Grosspapa,“ rief das junge Mädchen empört, „du weisst doch, dass ich es nicht leiden kann, wenn du so frivole Reden führst.“
„Nanu, wenn’s dir besser behagt, können wir ja auch mit unsern glänzenden Mitteln in Posemuckel oder Kuhschnappel unterkriechen. Zwei Stuben mit Hängeboden, Staubsaugeapparat und Müllschlucker ...“
Während er sprach, war eine ältliche Dame, gross, stattlich, zur Fülle neigend, von draussen ins Zimmer getreten und einen Augenblick lauschend an der Türe stehengeblieben. „Ach — so,“ fiel sie jetzt ein, „und mich hängen Sie dann in den Rauch!“
„Sie, beste Siebenstein? — warum nicht gar! Haben Sie nicht gehört, dass ich drei Gelasse vorgesehen habe? Nun, Mite erhält als Jüngste den Hängeboden. — Wer soll denn unsere Schlemmermahlzeiten herrichten? — doch nicht etwa das Gör da? Da wäre ich in vierzehn Tagen wahrscheinlich schon auf dem Kirchhof, wenn ich all das essen müsste, was Mite kocht.“
„Grosspapa, es ist schrecklich, dass du immer deine Possen treiben musst“, klagte seine Enkelin. Sie hatte jetzt ihre Postsachen zusammengelegt und ihr zartes, frisches Blondinengesichtchen in bitter ernste Falten gezogen. „Die Sache scheint doch wirklich nicht spasshaft zu sein. Steht es denn so schlecht — so beinahe hoffnungslos mit Segendorf?“
Der alte Herr fuhr mit seinen kurzen Fingern ein paarmal hastig durch die noch immer volle graue Haarmähne. Sein Gesicht war jetzt so grimmig zusammengezogen, dass er aussah wie ein Nussknacker. „Das weiss der Deibel, schlimm genug!“ stiess er hervor.
„Und da hoffst du, dass ein junger, unerfahrener Mensch die Karre ...“ sie schreckte davor zurück, den derben Ausdruck des Grossvaters zu wiederholen.
„Ich hoffe gar nischt, Kind! — ’s ist eben ein letzter Versuch.“
Frau von Siebenstein war an den Tisch neben Mite getreten und strich ihr beruhigend über das lichtblonde Haar, das, in zwei dicke Zöpfe geflochten und nach Backfischart als Kranz um den Kopf gelegt, einen Glorienschein von krausen goldigen Löckchen um ihre weisse Stirn wob. „Grossvater übertreibt wie gewöhnlich“, tröstete sie.
„Ist das wahr, Grosspapa?“ fragte Mite dringend.
„Du bist ein Kindskopf!“ schalt Herr von Segendorf mit einem kurzen, unfreien Auflachen. „Lass die Klitsche hier doch getrost zum Kuckuck gehen, wir brauchen sie nicht!“ Und er nahm plötzlich sehr eifrig die Zeitung auf und vertiefte sich hinein. Er hatte sich da mal wieder verplappert, und die Auseinandersetzung begann, ihm peinlich zu werden. Er war all sein Lebtag gern trüben Dingen aus dem Weg gegangen.
Mite atmete erleichtert auf. Sie liebte so wenig wie der Grossvater, düstern Gedanken nachzuhängen, des Lebens Ernst war ihr noch nicht nahegetreten.
Als ihre Eltern in China, wo ihr Vater als militärischer Erzieher gewirkt hatte, rasch nacheinander einem zehrenden Fieber zum Opfer gefallen waren, zählte sie erst fünf Jahre und befand sich auch bereits in der Obhut des Grossvaters und der Frau von Siebenstein, einer Freundin seiner verstorbenen Frau und nach deren Tod Vorsteherin seines Haushalts, und die beiden sorgten um die Wette dafür, dass ihr Goldkind nur ja kein rauher Luftzug treffe.
Damals lebte der Grossvater noch als aktiver Offizier im Westen des Reichs, und das Majoratsgut Segendorf, nicht weit von der russisch-polnischen Grenze, befand sich in den Händen seines älteren Bruders. Der war nun vor einigen Jahren kinderlos gestorben und das Stammgut in den Besitz von Mites Grossvater übergegangen. Die beiden, Jobst von Segendorf und Mite von Segendorf, waren überhaupt die letzten der Familie, und mit dem Geschlecht zugleich schien auch dessen einst so glänzender Wohlstand dahinzugehen.
Ein Hang zu fröhlichem Lebensgenuss hatte von jeher in dem Blut derer von Segendorf gelegen, aber die Ahnen waren von Beruf aus Landwirte gewesen, und tüchtige Landwirte, die etwas vor sich gebracht hatten. Das war im letzten Jahrhundert anders geworden, seitdem Alexander von Segendorf sich auf die Gelehrsamkeit geworfen und eine Künstlerin zur Frau genommen hatte. Die hatte mehr in Italien ihren Malstudien gelebt als daheim ihrer Wirtschaft, und ihr Mann war auf Forschungsreisen in der halben Welt „herumkutschiert“, wie Grossvater Jobst despektierlich meinte. Da war bei den Segendorfs nicht mehr aufgehäuft, sondern vermindert worden, rasend schnell vermindert, und der Sohn Alexanders, der nach seiner Mutter artete und ein Maler wurde, hatte das fortgesetzt. Er war der Grossvater des Jobst, und es hatte nicht viel genutzt, dass des Jobst Vater als echter Segendorf wieder mit Eifer die Landwirtschaft pflegte; seine beiden Söhne waren auch gewissermassen aus der Art geschlagen, der ältere, Wolfram, der Majoratserbe, war kränklich, lebte fast stets in Ägypten und starb unvermählt, der jüngere Jobst verbrauchte als Reiteroffizier viel Geld und hatte den Kuckuck Lust, sich um die Bewirtschaftung des Gutes zu bekümmern, zumal nachdem ihm der einzige Sohn, der es hätte erben sollen, so früh aus dem Leben gerissen war.
Die beiden Brüder standen nicht gut miteinander. Sie waren grundverschiedene Naturen, und es gab nur unerquickliche Stunden, wenn der schwächliche, empfindliche, durch seine Krankheit verbitterte Majoratsherr mit dem frischen, derbheiteren, immer fröhlichen und von ihm glühend beneideten Bruder zusammentraf. Und Jobst war allezeit darauf gefasst gewesen, dass der ältere eines Tages doch noch heiraten würde, ihm zum Trotz, um ihm und seinen Nachkommen das Erbe zu entziehen. Freilich, als er es dann doch erhielt, hatte er mit einem grimmigen Lachen gemeint, der Verstorbene hätte wohl gewusst, dass er ihm damit einen grösseren Possen spiele, als wenn er es einem eigenen Sohn hinterlassen hätte.
Die Wirtschaft war mit Schulden belastet, soweit das überhaupt bei einem Majorat möglich war, ja Waldbestände hatte man bereits gegen Gesetz und Recht niedergeschlagen und zu Geld gemacht.
Die auf die Wirtschaft eingetragenen Schulden wurden vermehrt durch eine Last persönlicher Verpflichtungen des Toten, der eben in dem Bewusstsein, für keinen geliebten Menschen sorgen zu müssen, nach Gefallen darauflosgelebt hatte, ohne sich um das Nachher zu kümmern. Diese persönlichen Verpflichtungen hätte sein Bruder Jobst allerdings nicht auf sich zu nehmen brauchen, wenn sein Ehrgefühl es zugelassen hätte, dass man einem Segendorf nachsagte, er sei als Lump aus der Welt gegangen.
So wurde die Gesamtschuldenlast dem Majorat aufgebürdet. Der Ertrag des Gutes war auf Jahre hinaus den Gläubigern verpfändet, und der Erbherr von Segendorf sah sich genötigt, seine eigenen Bedürfnisse und die Kosten für seinen Privathaushalt allein mit seiner Pension eines Generalmajors zu bestreiten. Dazu kam, dass er selber nichts von der Landwirtschaft verstand, ja als eingefleischter Soldat nicht einmal Sympathie für sie besass, und dass zu allem Unglück bei dem allgemein bekannten verrotteten Zustand der Wirtschaft auf Segendorf ein wirklich tüchtiger und erfahrener, älterer Beamter nach des alten Barons eigenem Ausspruch nicht daran dachte, sich in die verlotterte Wirtschaft zu setzen.
Der alte Herr hatte, sosehr er es auch mit seinem grimmen Spott zu verdecken strebte, seine schweren Kümmernisse. Jetzt, seitdem er, der Not gehorchend, den Abschied genommen hatte und wieder auf dem Stammgut seines Geschlechts lebte, war auch die alte Anhänglichkeit zur Heimat wiedererwacht, und während er es in bitterm Sarkasmus liebte, sich und seinen Angehörigen den völligen Bankerott des Geschlechts Segendorf und den Zwangsverkauf der „Klitsche“ auszumalen, blutete ihm sein Herz dabei, und eine glühende Scham über diesen schmählichen Untergang seiner einst so hoch angesehenen und so kernig tüchtigen Familie bohrte ihren Stachel in seine Seele.
Und dann war da das Kind, seine Enkelin. Was sollte aus ihr werden, wenn mit seinem Tod die zwar nicht glänzende, aber doch ausreichende Versorgung durch seine Pension aufhörte? Sie besass keinen Pfennig Vermögen, und so würde sie als die Erbin eines grossen Gutes einmal hungern müssen; denn wo würde sich einer verarmten und verkrachten Adeligen die Aussicht auf eine standesgemässe Heirat bieten?
Und während der alte Baron scheinbar eifrig die Zeitung studierte, wälzte er diese Gedanken unruhevoll in seinem Kopf umher.
Mite hatte nachdenklich die Stirn in ihre Hand gestützt. Der Grossvater führte in letzter Zeit oft diese seltsamen und eigentlich recht abscheulichen Reben. Tante Siebenstein bemühte sich zwar, sie als Übertreibungen hinzustellen, und der Grossvater liebte ja auch wirklich krasse und manchmal höchst derbe Äusserungen, aber es lag doch so ein eigen unfreier Ton in seiner Stimme, wenn er von dem „Segendorfer Elend“ redete. Sie war auch alt genug, um zu merken, dass die Segendorfer Verhältnisse wirklich nichts weniger als glänzend waren. Als Grosspapa noch aktiv war, hatten sie viel kostspieliger gelebt, und es war niemals vorgekommen, dass Tante Siebenstein gefunden hatte, ein echter Panamahut für Mite sei eigentlich ein törichter Luxus, da man doch so vorzügliche Nachahmungen für lächerlich billigen Preis haben könnte.
Prüfend liess das junge Mädchen ihre Blicke auf dem Grossvater ruhen. Er las ja gar nicht, starrte immer auf dieselbe Stelle der Zeitung, und die Tante Siebenstein strickte gar wie ein altes Spittelweib neue Fersen in einen Strumpf des Grossvaters.
„Grosspapa,“ sagte Mite plötzlich, „wenn der junge Mann nun aber wieder so untüchtig ist wie der vorige Inspektor, den du Knall und Fall hast entlassen müssen?“
„Ach, Unsinn!“ Die Antwort kam ein wenig ungeduldig. „Es wird doch nicht lauter dumme Tröpfe in der Welt geben.“
„Aber ein so junger Mann — —“
„Du tust ja, als ob er noch ein Schuljunge wäre; er hat doch immerhin schon bald seine dreissig Jahre.“
„Von wo stammt er eigentlich, und wie heisst er?“ warf Frau von Siebenstein ein.
„Er stammt von da irgendwoher aus Ostpreussen und hat so einen Gattungsnamen — Schmidt oder Schulze — ich weiss es wirklich im Augenblick nicht mehr, da liegt ja der Brief, lesen Sie doch selber.“
Er erhob sich, warf seiner Enkelin noch ein paar Scherzworte zu und ging hinaus. Die Ausfragerei behagte ihm nicht, denn so sehr er anfangs befriedigt gewesen war, durch die Zusage des „Neuen“ der lästigen Sucherei nach einem Ersatz für den davongejagten Inspektor enthoben zu sein, jetzt war er bereits geneigt, zu glauben, dass sie ihm nur frische Enttäuschungen und Ärgernisse bringen würde.
Mite nahm den Brief auf und las ihn. In Knappen Worten die Versicherung, dass der Schreiber mit den Bedingungen des Barons v. Segendorf einverstanden sei und bereits in einigen Tagen die neue Stellung antreten würde. Darunter der Name, nicht Schmidt und auch nicht Schulze, sondern Müller, Hans Georg Müller.
Mite zog das Näschen kraus. „Er ist gewiss schrecklich pöbelhaft und plump, Tante, sieh nur diese eckige Schrift. Er wird doch nicht wieder bei uns am Tisch essen?“
„Es wird nicht zu umgehen sein, Kind, da er doch unverheiratet ist.“
Mite seufzte. „Der andere hatte so schlechte Manieren und so grobe, braune Tatzen, und er putzte nicht einmal immer seine Nägel.“
„Nun, der Neue ist ja noch jung,“ tröstete die Tante, „der lässt sich wohl noch von uns zurechtstutzen.“