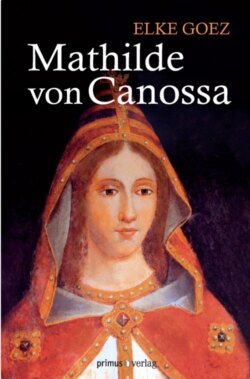Читать книгу Mathilde von Canossa - Elke Goez - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Die Welt um die Mitte des 11. Jahrhunderts
ОглавлениеWie kaum eine andere nicht-königliche historische Persönlichkeit des Hochmittelalters ist Mathilde von Canossa, deren Leben wir uns nun zuwenden wollen, mit den Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 11. und zu Beginn des 12. Jahrhunderts verbunden. Gerade in Italien sprach und spricht man daher gerne von einer „epoca matildica“, die aber nicht nur das Leben und Wirken Mathildes selbst, sondern auch ihre Familie sowie den langen Streit um ihr Erbe umfasst. Für alle Zeiten ist der historische Bußgang Heinrichs IV. nach Canossa mit der Burgherrin Mathilde verknüpft, weshalb das Istituto Superiore di Studi Matildici, das sich der Erforschung aller Canusiner gewidmet hat, anlässlich der 900. Wiederkehr des Jahrestages von Canossa 1977 gegründet wurde. Doch ist der Begriff „epoca matildica“ mit Vorsicht zu genießen, mischen sich doch in die oftmals regionalen Erinnerungen an Mathilde von Canossa nicht selten verklärende Aspekte, legendenhafte Erzählungen oder der immer wieder aufscheinende Wunsch nach einer mächtigen Fürstin in einer Zeit, da Frauen in der großen Politik vermeintlich oder tatsächlich wenig mitzubestimmen hatten.
Der Aufstieg der frühen Canusiner gewann, wie wir gesehen haben, im Schulterschluss mit den Königen und Kaisern enorm an Dynamik. Gerade die Zusammenarbeit des Markgrafen Bonifaz mit dem ersten Salier, Konrad II., verlief für beide Seiten mehr als erfreulich, und der Canusiner stieg, seinen vielen Gegnern zum Trotz, zur unumstrittenen Ordnungsmacht in Oberitalien auf. Als Konrad II. am 4. Juni 1039 in Utrecht starb, schien die alte Ordnung unverrückbar sicher zu stehen; die beiden Universalgewalten Kaisertum und Papsttum interagierten ohne ernsthafte Spannungen. Konrads Kaiseridee war universell, eine Einschränkung hätte er keinesfalls akzeptiert; sie wurde aber auch von niemandem ernstlich gefordert. Die Zeiten, da die Pavesen die Reichsburg im Inneren ihrer Stadt niedergerissen hatten, schienen lange vergangen, und Konrad dürfte in der Überzeugung gestorben sein, dass Reichsitalien – nicht zuletzt auch dank seiner kaiserlichen Heiratspolitik, die gezielt Fürstenfamilien aus beiden Reichsteilen miteinander verband – fest und unverbrüchlich mit dem Reich nördlich der Alpen verwoben war. Nichts bringt die unerschütterlich scheinende Position des ersten Saliers besser zum Ausdruck als seine Darstellung im Stammbaum der neuen Dynastie in der Chronik Ekkehards von Aura, deren Handschrift heute in der Staatsbibliothek Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) aufbewahrt wird. Ehrfurchtgebietend sitzt Konrad II. im ganzen Schmuck seiner Majestät auf dem Thron, die Krone auf dem Haupt, in der linken Hand den Reichsapfel haltend. Die rechte Hand präsentiert ein Medaillon, das seinen Sohn und Nachfolger Heinrich III. zeigt, darunter befinden sich die Abbildungen des Sohnes Heinrichs III., Heinrichs IV., sowie Darstellungen von dessen Kindern Konrad, Heinrich V. und Agnes, die auf der Umschrift des Medaillons irritierenderweise „Adelheit“ genannt wird. Umgeben wird das Familienbild von einer Palastarchitektur, die offenkundig die Wehrhaftigkeit der Salier unterstreichen soll, da das Dach mit Türmen und Zinnen bestückt ist. Hier setzt sich eine starke und siegverwöhnte Familie ein bildliches Denkmal.
Erstaunlicherweise entstand dieses demonstrativ Stärke und Geschlossenheit manifestierende Bild der salischen Familie wohl 1106 /07, also zu einer Zeit, da von einer innigen Verbundenheit der letzten Salier nicht die Rede sein konnte – hatte sich doch der noch junge Heinrich V. im Winter 1104 /05 der Opposition gegen seinen Vater angeschlossen und diesen in der Folgezeit entmachtet. Allerdings gehört die berühmte Darstellung bei Ekkehard von Aura, darauf hat Stefan Weinfurter mehrfach nachdrücklich und zurecht hingewiesen, in das politische Umfeld Heinrichs V., der gerade wegen seiner Empörung gegen den Vater die Zusammengehörigkeit der Salier zur Stabilisierung seiner eigenen Macht gar nicht oft genug betonen konnte.
Beim Tode Konrads II. war von diesen Umbrüchen noch nichts zu spüren. Sein Sohn Heinrich III. übernahm bruchlos und ohne erkennbare Widerstände die Macht, doch schnell wurde deutlich, dass der fromme König einen neuen Führungsstil pflegte. Nicht ohne Grund verglichen die Zeitgenossen ihn mit König David, der mit harter Hand regierte. Schon unter Konrad II. zeichnete sich die Sakralität des Königtums immer stärker ab, und die Vorstellung, die königliche Autorität sei direkt von Gott gegeben, wurde zu einer unbezweifelten Grundidee salischer Herrschaftspraxis. Aber erst unter Konrads Sohn Heinrich III. erlebte die sakrale Überhöhung des Königtums ihren Höhepunkt, stilisierte dieser sich doch als typus Christi und caput ecclesiae, dem die Sorge für das Heil der gesamten Christenheit oblag. Diese extrem exponierte Stellung forderte aber auch den ihr entsprechenden Respekt ein; es lag auf der Hand, dass ein solcher König von Gottes Gnaden Widerspruch gegen seine Entscheidungen kaum dulden würde.
Auch wenn es zu Lebzeiten des Markgrafen Bonifaz zu Spannungen mit Heinrich III. kam, entfaltete sich die canusinische Macht doch ganz maßgeblich im Schutze des Königtums. Allerdings demonstrierte der Kaiser dem eigensinnigen Markgrafen seine Macht auf das nachdrücklichste, und auch das Verhalten Heinrichs III., als er auf dem Weg zur Kaiserkrönung in Rom am 20. Dezember 1046 in Sutri, nur knapp fünfzig Kilometer nördlich der Ewigen Stadt, gleich zwei Päpste, Silvester III. und Gregor VI., absetzte, stellte allen vor Augen, dass mit diesem Herrscher nicht zu spaßen war und dass er seine (kirchen-)politischen Überzeugungen mit harter Hand durchzusetzen vermochte. Der dritte Papst, Benedikt IX., war sicherheitshalber gar nicht erst nach Sutri gekommen, was ihm indessen nicht half; nur wenige Tage später wurde er in Rom seines Amtes enthoben. Mit der Einsetzung der sogenannten deutschen Päpste – Clemens’ II., Damasus’ II., Leos IX. und Viktors II. – förderte der Salier die Kirchenreform nachdrücklich, ebnete ihren Vertretern den Weg auf den Thron Petri und riss das Reformpapsttum aus den Wirren und Querelen römischer Adelsrivalitäten heraus. (Von dieser die Salierzeit und damit auch die ‚epoca matildica‘ ganz entscheidend prägenden Reformbewegung wird noch zu sprechen sein.) Dass sich Mathilde von Canossa in diesem Konflikt klar auf die Seite des Reformpapsttums und damit im Grunde gegen den salischen König stellen würde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen.
Obwohl das harte Durchgreifen Heinrichs III. in Sutri dem Reformpapsttum enorm genützt hat, stellt sich die Frage, ob sein Vorgehen überhaupt rechtens war. Die Zeitgenossen waren sich nicht sicher: Einzelne Stimmen meldeten Bedenken an, doch grundsätzlich stellte niemand die Kirchenhoheit des sakral legitimierten Königtums in Frage – noch! In der Rückschau des 12. Jahrhunderts hagelte es Kritik für Heinrich III. Mit seinem Tod endet die Zeit unangefochtener christlicher Königsideologie in der Verschmelzung von Priesterkönigtum und Gottesgnadentum. Die Tage, da Wipo im Tetralogus den Kaiser als zweiten Mann im Erdkreis gleich nach dem Herrn des Himmels selbst bezeichnen konnte, waren gezählt. Als Heinrich III. mit nur 39 Jahren starb, erschütterten zahlreiche Unruhen das Reich an seinen Rändern, und an vielen Stellen rührte sich Widerstand gegen die zuvor erlittene Härte und Unbedingtheit kaiserlicher Machtausübung. Es waren dies keine leichten Voraussetzungen für Heinrich IV., der mit nur sechs Jahren dem Vater in der Bürde königlicher Herrschaft nachfolgte.
Mit der Machtübernahme des kindlichen Heinrich IV. begann eine lange Phase der Minderjährigkeitsregierung, die eine eklatante Schwächung der Krongewalt zur Folge hatte. Den weltlichen Großen eröffnete das Machtvakuum Möglichkeiten, die ihnen ein starker König sicher nicht kampflos eingeräumt hätte. Die Übernahme der canusinischen Besitzungen einschließlich der Reichslehen durch Beatrix nach dem Tod ihres ersten Mannes Bonifaz konnte wohl als Regentschaft für ihren damals noch lebenden minderjährigen Sohn durchgehen. Nach dessen Tod und Beatrix’ Wiederverheiratung mit einem gegen Heinrich III. in Opposition stehenden Herzog jedoch ging der Kaiser machtvoll gegen die Fürstin vor, wovon noch ausführlich zu sprechen sein wird. Dass Mathilde von Beatrix systematisch zur Übernahme des canusinischen Erbes erzogen wurde und die Reichslehen im Grunde dauerhaft okkupiert werden konnten – eine formelle Belehnung hatte nicht stattgefunden –, ist dem Umstand geschuldet, dass die Regentschaft für Heinrich IV. allzu sehr mit eigenen Problemen im Reich nördlich der Alpen beschäftigt war, um sich auch noch um die politischen Entwicklungen südlich der Alpen mit dem nötigen Nachdruck kümmern zu können. Als Heinrich IV. dann endlich selbst die Regierungsgeschäfte übernehmen konnte, hatte sich die Position der Canusiner schon so weit gefestigt, dass ein Vorgehen gegen sie kaum mehr möglich war; es sei denn, mit Waffengewalt. Als Mathilde 1076 allein das Erbe ihrer Mutter antrat, war der salische König ganz in seinem Streit mit Papst Gregor VII. gefangen und konnte und wollte es sich mit der Fürstin nicht verderben, hoffte er doch wohl stark auf ihre fürsprechende Vermittlung.
Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht, denn in Canossa setzte sich Mathilde nachdrücklich für einen Ausgleich zwischen den Universalgewalten ein und bedrängte Papst Gregor VII., den Salier vom Bann zu lösen. Aber auch ‚nach Canossa‘ trat nicht der ersehnte wirkliche Friede ein. 1080 kam es zur neuerlichen Bannung Heinrichs IV., und bald erschütterte ein zermürbender Krieg Oberitalien, der Mathildes personelle und materielle Ressourcen so stark in Anspruch nahm, dass sie phasenweise an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geriet. Die Lage besserte sich für die Markgräfin erst, als eine Koalition aus den süddeutschen, in Opposition zum Salier stehenden Herzögen gemeinsam mit der Canusinerin den Kaiser in die Enge treiben und ihn am Gardasee geraume Zeit gleichsam festnageln konnte, wovon ebenfalls noch ausführlich zu handeln sein wird.
Nachdem Heinrich IV. 1095 Italien endlich nach langem, unfreiwilligem Aufenthalt verlassen konnte, blieb das Reich südlich der Alpen praktisch sich selbst überlassen. Bis 1110 war Italien für die Salier nach Ausweis ihrer Urkunden praktisch verloren. Mathilde, aber auch andere Kräfte, nutzten das Vakuum, um ihre alten Herrschaftspositionen so gut es ging zurückzuerobern. Allerorten war eine regionalisierende Abgrenzung Italiens vom Reich nördlich der Alpen spürbar, die allerdings in keinem ursächlichen Zusammenhang zu der Herrschaft Heinrichs IV. oder Heinrichs V. stand.
Während der Zeit des Investiturstreits wurde zunehmend zwischen dem regnum Italicum und dem regnum Teutonicum unterschieden; und dies nicht nur bei den Reformkräften, sondern sogar vom Gegenpapst Clemens III. (Erzbischof Wibert von Ravenna) und im Mai 1111 von Heinrich V. selbst. Sicher entsprach diese Zweiteilung nicht dem Denken und dem politischen Verständnis des letzten Saliers, aber niemand konnte dauerhaft die Augen davor verschließen, dass sich eine gewisse Abgrenzung der beiden Reiche vollzog, die kaum aufzuhalten war. Überall tauchen in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts italianisierende Namenszusätze auf; so 1073 in einer Gerichtsurkunde Mathildes von Canossa ein gewisser Rainerius Toccacoscia. Bei Frauen werden Eigennamen mit italienischem Klang immer beliebter: Bonissima, Speciosa oder gar Italia. Das heißt nicht, dass es allerorten aggressiv separatistische Tendenzen gegeben hätte mit dem erklärten Ziel einer Abspaltung vom Reich nördlich der Alpen und der Errichtung eines eigenen Königtums, aber es scheint, als habe sich weitflächig ein dezidiertes Eigenbewusstsein ausgebreitet: So rühmte Petrus Damiani, der große Vordenker der Kirchenreform, Petrus Bennonis, der Grundbesitz für die Klostergründung von San Gregorio in Conca zur Verfügung gestellt hatte, als „lux Italiae“.
Gleichzeitig lässt sich ein zunehmendes Desinteresse an salischen Königsurkunden konstatieren. Kaum jemand machte sich noch die Mühe, für eine Königsurkunde die beschwerliche und kostspielige Reise über die Alpen nach Norden anzutreten. Man wartete lieber, bis der Herrscher selbst kam. Dann freilich nahm man seine Gunsterweise gern entgegen, obwohl dem aufmerksamen Beobachter nicht entgehen konnte, dass immer größere Teile Reichsitaliens sich dem letzten Salier ganz entzogen, und er in viele Regionen seines Reiches südlich der Alpen niemals den Fuss gesetzt hatte, geschweige denn dort über Einfluss verfügt hätte. Alarmzeichen waren auch die Zerstörungen herrscherlicher Pfalzen in italienischen Städten oder deren erzwungene Verlagerung vor die Stadtmauern – so geschehen in Pavia, aber auch in Pisa, Ravenna, Turin, Bologna, Cremona, Mantua und Lucca. Die dadurch entstandenen Machtlücken im Innern der Kommunen konnte Mathilde nicht füllen; sie war von der Tendenz, weltliche Fürsten aus den Zentren der Städte zu verdrängen, ebenso betroffen wie der König selbst. Schon zu Lebzeiten ihrer Mutter konnten die Canusiner nicht mehr am alten Platz mitten in der Stadt in Lucca Gericht halten, sondern mussten sich auf das offene Feld vor der Mauer zurückziehen. Dass Heinrich V. versuchte, auf vielfältige Weise der für seine Herrschaft bedrohlichen Entwicklung entgegenzuwirken, ist bekannt; einen wichtigen Meilenstein stellte für ihn dabei der Erwerb des Mathildischen Erbes dar, wobei der Salier unmittelbar nach dem Tod Mathildes in ihren Machtbereichen auf breite Zustimmung traf.
Geistig-religiös geprägt wurde die Lebenszeit Mathildes – und damit die zweite Hälfte des 11. sowie der Beginn des 12. Jahrhunderts – durch die Kirchenreform und den sogenannten Investiturstreit. Dass alle Geistlichen ein möglichst sittenstrenges und vorbildliches Leben führen sollten, war keine neue Forderung des 11. Jahrhunderts; allerdings wurde sie jetzt besonders nachdrücklich gestellt. Vor allem von Nikolaitismus und Simonie sollten sich alle Geistlichen fernhalten, also nicht in eheähnlichen Verhältnissen leben und ihre Ämter nicht gegen Geld, Versprechungen oder andere Gegenleistungen erhalten. An vielen Stellen war die Kirche also reformbedürftig, und vor allem das Kirchenvolk nahm immer häufiger Anstoß an unzüchtig lebenden Geistlichen und registrierte moralisches Fehlverhalten mit Argusaugen – reagierte aber auch zunehmend sensibel und verstimmt auf offensichtlich schlecht ausgebildete oder gar unfähige Priester. Denn nicht nur die Lebensweise der Geistlichen sollte reformiert und die vita canonica eingeschärft werden: Auch die Pfarrorganisation und die seelsorgerische Betreuung bedurften der Besserung. Von dieser Melioration konnten alle nur profitieren, weshalb sich die Könige ebenso wie weltliche und geistliche Große für eine Reform stark machten. Auch die Canusiner engagierten sich in der Kanonikerreform und banden entsprechende Stiftungen an die Einhaltung der gemeinschaftlichen und regelkonformen Lebensweise der Beschenkten. Dass Stiftungsgut nicht sinnlos verprasst oder verschleudert werden durfte, kam nicht nur den Canusinern, sondern allen Donatoren zugute, versuchten doch viele, die Kontrolle über verschenkte Liegenschaften und Güter auch weiterhin zu behalten.
Weit größere politische Sprengkraft beinhaltete das Simonieverbot. Zwar stand es außer Frage, dass geistliche Ämter nicht an Unwürdige verkauft werden sollten, die für ein solches Amt nicht geeignet waren, es sich aber leisten konnten. Aber so einfach es klang, geistliche Ämter künftig ohne Simonie zu vergeben, so kompliziert war die Umsetzung dieser Forderung. Bislang hatte man sich wenig daran gestört, dass geistliche Ämter gegen Bezahlung vergeben wurden. Was sollte nun mit den solcherweise in Amt und Würden gelangten Stelleninhabern geschehen? Mussten sie alle ihrer Ämter enthoben werden? Und wie verhielt es sich mit den von ihnen gespendeten Sakramenten? Waren diese womöglich alle hinfällig? Die Verunsicherung war groß und der Streit zwischen gemäßigten, pragmatischen Simoniegegnern und strengen Reformern eskalierte rasch.
Bald noch brennender war das Problem der Ernennung der Bischöfe durch den König. Heinrich II. hatte in den 22 Jahren seiner Herrschaft 64 Bischöfe erhoben, Konrad II. 38 und Heinrich III. 52, ohne dass die Zeitgenossen daran Anstoß genommen hätten. Vor einer größtmöglichen Öffentlichkeit wurde dem neuen Bischof sein Amt durch die Symbole Ring und Stab übertragen. Dass es sich hierbei um geistliche Symbole handelte, war hinlänglich bekannt, doch erst im Verlauf des 11. Jahrhunderts nahm man Anstoß daran, dass über diese Insignien vom König verfügt wurde. Zugleich wurde unter dem Vorsitz Papst Nikolaus’ II. 1059 von den Teilnehmern der Lateransynode festgelegt, dass künftig kein Geistlicher mehr eine Kirche aus Laienhand erhalten solle – und zwar weder gegen Geld noch ohne offenkundige Gegenleistungen. Es ist fraglich, ob bei diesem ersten allgemeinen Investiturverbot bereits an die Vergabe geistlicher Ämter durch den König gedacht worden war, oder ob es sich eher auf adlige Eigenkirchen bezog. Aber einmal formuliert, enthielt das Verbot enorme Sprengkraft. In dem Augenblick, da man den König als einen ‚ganz normalen Laien‘ betrachtete, würde er aus geistlicher Sicht das Recht verlieren, die Bischöfe seines Reiches einzusetzen, obwohl Ottonen und frühe Salier auf deren Auswahl besondere Sorgfalt verwandt hatten. Angesichts der immensen Bedeutung der Bischöfe für den Zusammenhalt des Reiches und dessen Administration konnte und wollte der Herrscher darauf aber nicht verzichten.
Die Frage der Bischofserhebungen berührte auch die Canusiner, und es irritiert nicht wenig, dass Mathilde von Canossa in ihren späten Jahren den Erzbischof von Mailand mit einem Ring investierte, wozu sie in keiner Weise berechtigt war. Dass sie darüber hinaus – und ganz selbstverständlich – ein Symbol handhabte, das die Reformgruppe schon lange nicht mehr in Laienhänden sehen wollte, verwundert noch mehr. Es darf also berechtigterweise gefragt werden, ob sich Mathilde der aus der Reformbewegung resultierenden politischen Implikationen in ganzem Umfang bewusst war. Vielleicht schimmert hier aber auch eine Möglichkeit auf, die strengen Investiturverbote zu unterlaufen. Da es sich um einen Einzelfall handelt, muss die Interpretation vorsichtig ausfallen, aber es scheint, als habe sich die zeitweilig wichtigste Vorkämpferin des Reformpapsttums selbst nicht an dessen Verbote gehalten.
Wenig Grund zur herrscherlichen Freude bot auch das neue, von Nikolaus II. 1059 erlassene Papstwahldekret, das zwar künftig Doppelwahlen verhindern sollte, die Mitwirkung des Königs an der Papstwahl jedoch nur an einer Stelle, im sogenannten Königsparagraphen, überhaupt anspricht. Dem König wird zwar Respekt gezollt, aber im Grunde nur ein Konsensrecht zugebilligt, das noch dazu jeder neue König wieder neu beim Papst erbitten musste. Obwohl hier erstmals der königliche Einfluss bei der Papstwahl schriftlich geregelt wurde, klingt der Passus doch recht dürftig. Faktisch würden die Einflussmöglichkeiten des weltlichen Herrschers auch weiterhin immer von der jeweils aktuellen Machtverteilung abhängen.
Rasch wurde deutlich, dass die Reformpäpste mit aller Kraft danach strebten, ihre Leitungsposition in der Kirche und in der Welt auszubauen. Leo IX. lud regelmäßig zu den Fastensynoden und schuf damit zum ersten Mal ein Instrument institutionalisierter Kommunikation zwischen dem Papst in Rom und den Bischöfen in der Welt. Viktor II., Bischof Gebhard von Eichstätt, der letzte der sogenannten deutschen Päpste, nahm sich die Freiheit, bei Heinrich III. Forderungen zu stellen, ohne deren Erfüllung er, wie er sagte, die Wahl zum Papst nicht annehmen würde. Diese Pille dürfte für den Kaiser einigermaßen bitter gewesen sein – gehörte doch zu den Bedingungen, dass der Salier für die Rückgabe aller dem Apostolischen Stuhl entfremdeten Güter Sorge zu tragen habe. Trotz der unverhohlenen Emanzipationstendenzen und dem Paukenschlag gleich zu Beginn seiner Amtszeit war die Zusammenarbeit der Universalgewalten zu Lebzeiten Heinrichs III. aber weitgehend ungetrübt. Auf seinem Sterbebett in der Pfalz Bodfeld bat der Salier Viktor II. sich seines erst sechs Jahre alten Sohnes und Thronfolgers, Heinrichs IV., anzunehmen, was ihm der Papst ohne Weiteres versprach.
Doch schon im Juni 1057 verstarb Papst Viktor II., und die Reformpartei ernannte – wohl ohne Rücksprache mit dem fernen Hof – Stephan IX., den Bruder Herzog Gottfrieds des Bärtigen, des Stiefvaters der Markgräfin Mathilde, zu seinem Nachfolger. Der Herrscher als Beschützer des Papsttums hatte spürbar an Bedeutung verloren, und die Canusiner übernahmen ein Stück weit diese Rolle, was ihre Position in Ober- und Mittelitalien natürlich enorm festigte. Dass der Schutz des Papsttums nicht nur Einfluss, Ehre und Ansehensgewinn mit sich brachte, sondern auch materielle Opfer forderte und unkalkulierbare Risiken nach sich zog, musste vor allem Mathilde von Canossa während der langen Zeit des Kampfes im sogenannten Investiturstreit erfahren.
Trotz des neuen Papstwahlrechts, das Doppelwahlen verhindern sollte, brach 1061 ein Schisma aus, das mit einem Schlag die Schwäche der Regentschaft für Heinrich IV. verdeutlichte. Erstmals ergriff der Hof für einen Papst Partei, der sich letztlich nicht gegen seinen Konkurrenten durchzusetzen vermochte. Zwischen Honorius II. (Bischof Cadalus von Parma) und Alexander II. (Bischof Anselm von Lucca) vermittelte auch kein Abgesandter der Königinmutter Agnes, sondern Herzog Gottfried der Bärtige, der Stiefvater Mathildes von Canossa, der den letztlich siegreichen Alexander II. favorisierte.
Fast wäre es schon zu Lebzeiten Alexanders II. zu einer Eskalation der Spannungen mit dem seit 1065 volljährigen und allein herrschenden Heinrich IV. gekommen, doch starb der Papst überraschend, bevor sich diese gereizte Stimmung hätte entladen können.
Die Pontifikate Gregors VII., Urbans II. und Paschalis’ II. spielten im Leben Mathildes eine so maßgebliche Rolle, dass sie später ausführlich behandelt und hier nicht vorweggenommen werden sollen. Am Ende des Investiturstreites hatte sich die mittelalterliche Welt verändert: Hatte bislang das Papsttum darum gerungen, mit dem Kaisertum auf einer Stufe zu stehen, so war es nun an den Herrschern, ihre Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit zu verteidigen und zu begründen. Die salische Propaganda mühte sich redlich, doch konnte die Zwei-Schwerter-Lehre nicht vertuschen, dass das Kaisertum unter Zugzwang geraten war und sich nach dem Teilverlust seiner Sakralität um andere Begründungen seiner Herrschaft bemühen musste.
Die Fürsten gingen aus den Umbrüchen gestärkt hervor und betonten nachdrücklich ihre Verantwortung für das Reich, was sie als ernstzunehmende Partner neben den König treten ließ. Für Mathilde von Canossa sah es dagegen anders aus, was nicht nur daran lag, dass sie die letzte Vertreterin ihrer Familie war, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass sie mit Entwicklungen zu kämpfen hatte, von denen die Fürsten des Reiches nördlich der Alpen noch wenig zu spüren bekamen: dem unaufhaltsamen Aufstieg der Städte in Italien, die sich zu einer eigenständigen Macht entwickelten, und deren Aufstreben die letzte Canusinerin keinen Einhalt gebieten konnte. Je stärker die Kommunen wurden, desto mehr bemühte sich Mathilde, wie zuvor schon ihre Mutter Beatrix, wenigstens durch die Unterstützung innerstädtischer Klöster gleichsam einen Fuß in die sich schließenden Stadttore zu bekommen. Auch versuchte sie, die Kooperation mit den Bischöfen zu stärken, die ihrerseits zusehen mussten, wie sie ihre Macht in ihren Bischofsstädten bewahrten. Auch hierbei konnte die Fürstin eigentlich nur verlieren, denn als langfristiger Partner kam sie angesichts ihres Alters und des Fehlens eines Nachfolgers kaum in Frage, so dass die Bischöfe sich immer öfter sogar gegen die Markgräfin wandten, um sich in ihren Städten zu profilieren.
Vom ersten Kreuzzug hat Mathilde offenbar keinerlei Notiz genommen. Zwar gibt es in Mantua Kreuzzugs-Fresken, doch ist fraglich, ob sie tatsächlich zu Lebzeiten der Fürstin entstanden sind. Sie entsandte kein Kontingent und nahm auch in keiner anderen Weise aktiv am ersten Versuch teil, das heilige Grab in Jerusalem zu befreien. Die Kreuzfahrer müssen teilweise durch ihre Einflussgebiete gezogen sein, doch ist nicht bekannt, dass sie ihnen besondere Unterstützung gewährt hätte. Da sie damals um die Rückeroberung und Behauptung ihrer eigenen Besitzungen rang, dürfte sie wohl kaum die Mittel und die Truppen gehabt haben, um ein größeres Kontingent auszurüsten und für lange Zeit zu entbehren. Zudem konzentrierte sich das Interesse Mathildes in ihren letzten zwanzig Jahren ganz auf das canusinische Machtgebiet; für militärische Abenteuer in der Fremde scheint sie keine Kraft mehr besessen zu haben.
Den Siegeszug der Zisterzienser in Europa hat Mathilde nicht mehr erlebt. Die Strenge der weißen Mönche hätte die Fürstin wohl mit Sicherheit begeistert, aber bis zum Zeitpunkt ihres Todes gab es in Italien noch keine zisterziensische Gründung. Zu Lebzeiten Mathildes waren Vallombrosa und Cluny die wichtigsten Reformimpulsgeber in den Canusinergebieten, welche die Markgräfin nach Kräften unterstützte – davon jedoch mehr im Kontext ihrer Lebensgeschichte.