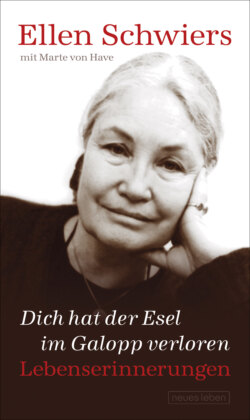Читать книгу Dich hat der Esel im Galopp verloren - Ellen Schwiers - Страница 11
ОглавлениеKrieg
Der Zweite Weltkrieg weckt in mir fürchterliche Erinnerungen. Ständiger Fliegeralarm, Tod, Zerstörung, Flucht, Hunger, Hilflosigkeit und die immer präsente Angst. Die Menschen haben den Krieg unterschiedlich erlebt. Manche waren sogar kaum von ihm betroffen. Was Krieg mit Menschen macht, mit ihrer Seele, ist nicht vermittelbar, macht sprachlos. Zumindest mich. Es trennt die Menschen, es trennt sie von nachfolgenden Generationen, die so etwas nicht erlebt haben und nicht nachvollziehen können. Meine Ausdrucksmittel sind zu gering, um das Ausmaß des Erlebten zu schildern. Sobald ich es versuche, tauche ich ein in längst vergangene Situationen, bin sofort wieder im Geschehen und werde davon überwältigt.
Jahrelang konnte ich vieles gut verdrängen, aber jetzt im Alter gelingt mir das immer weniger. Meine Erinnerungen scheinen ein Eigenleben zu führen und suchen mich immer häufiger heim. Das Ringen um Seelenfrieden, der einhergeht mit Unbeschwertheit, Gelassenheit und auch mit Leichtigkeit, habe ich verloren.
Ich war neun Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Zu dieser Zeit lebten wir in Koblenz. Mein Vater war dort in der Spielzeit 1939 am Stadttheater engagiert. Ich erinnere mich noch, dass er eines Tages empört nach Hause kam und zu meiner Mutter sagte: »Liselotte, beide Konfessionen haben die Waffen gesegnet, wir treten sofort aus der Kirche aus.« Von da an waren wir ohne eine Institution, aber Gott-gläubig.
Schon bald wurde meinem Vater angeboten, als Oberspielleiter nach Krefeld zu gehen, für ihn ein großer Schritt nach vorne, denn Krefeld war ein ganzjähriges Theater. Mein Vater sagte zu, machte gleichzeitig aber einen fatalen Fehler. Aufgrund des Theaterwechsels war er drei Monate arbeitslos, hatte sich beim Wehrbezirkskommando aber nicht nach Krefeld umgemeldet und wurde nun genau in dieser Zeit von der Wehrmacht eingezogen. Angeblich wusste er nicht, dass man das tun musste. Der Krefelder Intendant bemühte sich zwar, meinen Vater aus dem Wehrmachtsdienst herauszulösen, der Koblenzer Intendant ebenfalls, aber es war aussichtslos.
Daher wurde mein Vater bereits 1941 eingezogen. So bestürzt die Familie war, im Nachhinein erwies sich das sogar als glückliche Fügung, denn die Schauspieler, die erst 1944, nach der Schließung aller Theater, eingezogen wurden, waren das reinste Kanonenfutter. Mein Vater kam zur »Landmarine« und lernte dort Lastwagen fahren, mit denen die Schiffe versorgt wurden. Ich sah meinen Vater in den folgenden fünf Jahren nur bei seinen seltenen Heimaturlauben.
Bei einem seiner Besuche fand in Koblenz ein entsetzlicher Bombenangriff statt. Als wir aus dem Keller kamen, sahen wir das Dach der Florinskirche brennen. Die Dachziegel flogen explosionsartig durch die Luft. Vater sagte zu mir: »Schau es dir genau an, so etwas siehst du in deinem Leben nie wieder.« Das war gemessen an all dem, was noch kommen sollte, allerdings naiv.
Mein Vater nahm mich, seine dreizehnjährige Tochter, in Richtung der brennenden Altstadt mit, um dort zu helfen und zu retten. Wir liefen an der Mosel entlang bis zur Moselbrücke. Um uns herum ein Höllenlärm: die lodernden Flammen der brennenden Altstadt, die lauten Geräusche der Feuerwehr, die Löschwasser aus dem Fluss pumpte, die Verzweiflungs- und Schmerzensschreie der den Flammen ausgesetzten Menschen. Geblendet durch den gleißenden Schein der Feuersbrunst, der sich in der Mosel widerspiegelte, konnte ich nicht sehen, wo ich hintrat. Plötzlich hörte ich eine hysterische Frauenstimme schrill schreien. Der Strahl einer Taschenlampe wurde auf meine Füße gerichtet. Ich stand auf Leichen, die dort abgelegt waren. Immer noch sehe ich dieses entsetzliche Bild: ein kleiner toter Junge, voller Blut, sein aufgeschlitzter Bauch, und er hielt noch ein Essgeschirr in der Hand, mit dem er seinem Vater das Essen zur Arbeit gebracht hatte. Der Körper seines Vaters lag völlig zerfetzt neben ihm. Ich war vor Entsetzen wie gelähmt, ich wusste nicht, wie ich mich bewegen sollte, wie ich dort wegkommen konnte. Überall breitete sich mehr und immer mehr Blut aus. In meinen Holzschuhen, in denen meine nackten Füße steckten, stand das Blut. Wenn ich die Zehen bewegte, spürte ich, wie es quatschte. Mein Vater fasste mich unter den Achseln und hob mich von den Leichen herunter. Ich schleuderte meine blutigen Schuhe von den Füßen in die Mosel. Das war eine Kurzschlussreaktion, denn überall lagen Bombensplitter, die mir beim Gehen nun die Fußsohlen zerschnitten.
Als Vater und ich nach Hause kamen, sahen wir, dass sämtliche Fenster des Hauses kaputt waren. Die ganze Hausgemeinschaft saß im ersten Stock zusammen. Damit sich alle etwas beruhigten, hatte jemand Schnaps ausgegeben. Alle starrten uns an, und meine Mutter schrie entsetzt: »Ellen, wie siehst du denn aus?« Bis zu den Knien war ich voller Blut, eigenem und fremdem. Da brach ich mit einem Weinkrampf zusammen: »Mami, ich habe auf Toten gestanden.« Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Irgendjemand hat mir schließlich eine Beruhigungsspritze gegeben, meine blutenden Füße desinfiziert und die tiefsten Schnitte genäht.
Bis heute habe ich den toten kleinen Jungen mit dem Essgeschirr vor Augen und bin immer wieder mitten im Geschehen. Es ist nicht zu verarbeiten.
Nach jedem Bombenangriff musste ich mich als BDM-Mädchen in der Steinschule zum Appell melden. Wir mussten Verschüttete aus den Kellern ausbuddeln. Sie lagen, vom Staub und Schutt weiß wie die Mehlwürmer, in den Trümmern. Wenn alle überlebt hatten, waren das glückliche Momente. Innerlich wappnete man sich stets dagegen, auch auf Leichen zu treffen. Wenn das der Fall war, hörten wir mit dem Graben auf und es kamen erwachsene Helfer dazu. Die Leichen zu sehen war grauenvoll. Aber man musste funktionieren, musste den Schrecken mit sich selbst ausmachen. Wir mussten aufräumen! Es war so. Es war Krieg. Die geborgenen Toten wurden nebeneinander gereiht. Manche hatten keine Gliedmaßen mehr. Dann legte man ihnen die Arme oder Beine, die man fand, auf den Bauch.
Der Tod war für mich entsetzlich. Zerfetzte Leiber, aufgerissene Augen, aufgerissene Münder. Bloß nicht sterben, dachte ich – bloß nie sterben. Den ersten »normal«, also nicht im Krieg gestorbenen Menschen sah ich 1954 in Göttingen. Das war mein Kollege Siegfried Breuer. So kann der Tod also auch sein, dachte ich. So friedlich und schön.
Koblenz war eine Brückenstadt und damit ein strategisches Angriffsziel für die Engländer und ab dem Eintritt der Amerikaner in den Krieg auch für diese. Die Brücken wurden durch silberne Sperrballons geschützt, die von dünnen eisernen Seilen gehalten, höhenverstellbar bis an die sechstausend Meter hoch in den Himmel ragen konnten. Ihr Zweck war es, feindlichen Piloten den Anflug auf die Brücken und umliegenden Bodenziele zu erschweren, denn sie zwangen dazu, in größerer Höhe zu fliegen, was sich auf die Treffgenauigkeit auswirkte. Manchmal konnten die angreifenden Flugzeuge durch sie sogar zum Absturz gebracht werden, wenn die Piloten ihnen nicht mehr ausweichen konnten, zumal sie bei Nacht nicht sichtbar waren. Da die feindlichen Flieger in den letzten Kriegsjahren sehr oft angriffen, war das Aufsteigen der großen, mit Traggas gefüllten Ballons das Zeichen für einen baldigen Angriff, noch bevor wir Fliegeralarm bekamen.
Die Bombenangriffe der Amerikaner und Engländer hörten bald überhaupt nicht mehr auf. Am Ende des Krieges war Koblenz zu mehr als neunzig Prozent zerstört. Wir haben fast nur noch im Keller gelebt, denn andauernd gab es Fliegeralarm. Große Teile der Stadt lagen in Schutt und Asche. Doch auf wundersame Weise stand die Schwerzstraße, in der wir wohnten, noch. Aber wir ahnten, dass wir wohl bald als Nächstes dran waren und dass auch die Luftschutzkeller letztlich keine Sicherheit boten. Ich hatte ja selbst erlebt, dass die Menschen in ihnen verschüttet wurden und starben. Meine Freundin Meta Jost hatten wir aus so einem Keller ausgegraben. Sie sah aus wie ein Geist. Gesicht und Körper waren vom Staub der Steintrümmer wie bemehlt. Ihre Großmutter war tot, und Meta brachte kein Wort mehr heraus. Sie stand unter Schock und weinte um ihr Kaninchen.
Meine Mutter beschloss, Koblenz mit uns Kindern zu verlassen. Sie machte sich auf den Weg zur Steinschule, denn dort musste sie uns abmelden, um für die Reise Lebensmittelkarten zu erhalten. Kaum war meine Mutter losgegangen, erfolgte ein schwerer Luftangriff. Die Bomben schlugen genau im Gebiet der Steinschule ein, also dort, wo meine Mutter sich gerade aufhielt. Ich war sicher, dass ich sie nie wiedersehen würde. Nicht weit von uns entfernt hatte ein Kohlelager angefangen zu brennen. Die Luft war voller glühender Asche, und brennende Kohlenstücke landeten auf unserem Hausdach. Es drohte Feuer zu fangen. Außer meinem kleinen Bruder Gösta und mir war niemand mehr im Haus. Unsere Wohnung lag im obersten Stock. Also sind wir hinaus aufs Dach geklettert, um zu löschen. Gösta musste mir aus der Badewanne Wasser bringen – zu der Zeit sollten die Badewannen immer voller Wasser sein –, und ich habe mit langen Stangen, um die ich nasse Lappen wickelte, versucht, die Brandnester zu löschen.
Vom Dach aus sah ich meine Mutter auf der Straße um die Ecke biegen. Da bin ich fast ohnmächtig geworden, so glücklich war ich, dass sie noch lebte.
Sofort begannen wir unsere Habseligkeiten zu sortieren und zu packen. Man konnte seinen Besitz in der Festung Ehrenbreitstein deponieren, aber wir trauten dem System nicht. Daher ließen wir unsere Möbel in der Wohnung stehen und verstauten unsere persönlichen Dinge in einer Kiste im Keller. Nur mit Handgepäck und einem Köfferchen mit Silberbesteck verließen wir Koblenz. Das Besteck stammte aus dem Zietlower Haushalt meiner Großeltern und war der einzige Wertgegenstand, den wir aus unserer Wohnung mitnahmen. Wir hüteten es wie unseren Augapfel. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein »nur« versilbertes Besteck handelte. Das war aber nicht weiter schlimm, hatte es für uns doch vor allem einen ideellen Wert.
Mein Großvater väterlicherseits organisierte, dass ich nach Niesky auf die Internatsschule der evangelischen Brüdergemeinde kam. Die Schwester meines Vaters, Tante Agnes, arbeitete dort als Sportlehrerin. Ich wurde alleine in die Bahn gesetzt. Wenn ich mir das heute überlege, finde ich es unglaublich. Niemals hätte ich eines meiner Kinder alleine, mitten im Krieg, quer durch ganz Deutschland geschickt. Doch meine Eltern hatten das schon einmal getan und mich als Elfjährige zusammen mit meinem damals fünf Jahre alten Bruder »verschickt«, nach Königsberg zu Tante Grete, einer Cousine meiner Mutter, und Onkel Max, ihrem Mann. Dort blieben wir ungefähr drei Monate. Es war der Stalingradsommer 1942. Ich sehe meine Eltern noch gemeinsam am Bahnsteig stehen, um uns zu verabschieden. Mein Vater war kurz zuvor für ein paar Tage auf Urlaub gekommen. In dem rappelvollen Zug musste ich stehen. Bis Berlin sind wir noch begleitet worden, danach wurden wir uns selbst überlassen. Wir mussten umsteigen und uns durchfragen. Als wir endlich in Königsberg ankamen, nahm uns dort niemand in Empfang. Meine Tante hatte sich verspätet. Diese vierzig Minuten, die wir Kinder alleine, völlig übermüdet auf dem Bahnhof standen und nicht wussten, ob noch jemand käme, um uns abzuholen, waren eine harte Prüfung.
Ich war nun im Internat, und meine Mutter und mein Bruder landeten bei zwei weiteren Cousinen meiner Mutter in Leipzig, den Zwillingsschwestern Erika und Eva. Tante Erika war Kriegswitwe und hatte vier Kinder zu versorgen. Tante Eva hatte zwei Kinder. Ihr Mann, der Wirtschaftshistoriker Professor Friedrich Lütge, stand dem Kreisauer Kreis, einer bürgerlichen Widerstandsgruppe, nahe. Das wusste aber keiner, zumindest meine Mutter wusste es nicht.
Es war Juli 1944, die Front rückte immer näher und die beiden Schwestern machten sich auf nach Königsberg, um ihre alte Mutter zu holen. In der Zeit ihrer Abwesenheit führte meine Mutter dem Professor und den nun insgesamt acht Kindern den Haushalt. Als am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler scheiterte, war der Professor plötzlich verschwunden. Einige Kreisauer hatten sich der Widerstandsgruppe um den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg angeschlossen, nachdem Anfang 1944 einer der Gründer des Kreisauer Kreises, Helmuth James Graf von Moltke, verhaftet worden war. Es dauerte nicht lange, da stand die Gestapo vor der Wohnungstür, um den Professor zu verhaften, fand aber nur eine Frau und acht Kinder vor. Sie nahmen meine Mutter, die keine Ahnung hatte, wo sich der Professor aufhielt, kurzerhand mit und brachten sie in einen Keller zum Verhör. Sie hat, nach dem, was sie uns später erzählte, den Ernst der Lage gar nicht begriffen, sondern sich stattdessen lautstark darüber beschwert, dass eine grelle Lampe auf sie gerichtet war und dass sie, eine Dame, diesem grauenvollen Licht ausgesetzt wurde. Sie haben sie tatsächlich wieder ziehen lassen. Ich glaube, ihre Naivität hat ihr das Leben gerettet.
Der Professor tauchte erst kurz vor Kriegsende wieder auf. Im Auftrag der Besatzungsmächte wurde er zunächst Rektor der Universität Leipzig und nahm ab 1947 seine Lehrtätigkeit in München wieder auf.
Nachdem Tante Eva und Tante Erika mit ihrer Mutter aus Königsberg zurückgekommen waren, fuhr meine Mutter mit Gösta nach Kreuzburg in Ostoberschlesien zu ihrer Schwester Jette, die vor den Bombenangriffen aus Berlin geflohen und mit ihren drei kleinen Töchtern dort untergekommen war. Ihr Mann, mein sehr geliebter Onkel Heinrich, forschte als Ingenieur für Maschinenbau für die DVL, die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, weshalb er auch nicht eingezogen worden war. Einen Teil seiner Abteilung hatte man von Berlin nach Kreuzburg verlegt und in Paradies, dem heutigen Gościkowo, im dortigen Kloster untergebracht.
Am 4. Oktober 1944 brannte unsere Wohnung in Koblenz völlig aus. Erst vier Wochen später wurde mir die traurige Nachricht auf einer vorgedruckten Karte mit der Post überbracht. Wir hatten gerade eine Freistunde. Ich saß auf der Bank am Kamin und zerdrückte ein paar Tränchen. Johanna, ein Mädchen, mit dem ich mich angefreundet hatte, fragte nach dem Grund. Ich reichte ihr stumm die Postkarte. »Der 4. Oktober – das war doch die Nacht, in der du so geschrien hast«, stellte sie fest. Wir schliefen alle in einer Art Wintergarten, und ich hatte im Schlaf so laut geschrien, dass mich meine Zimmergenossinnen gerüttelt und geschüttelt hatten, weil ich mich einfach nicht beruhigen konnte. Ich hatte geträumt, ich stünde in Koblenz in der Tür unseres Wohnzimmers vor einem Flammenmeer. Zwischen den Fenstern hing ein großer Spiegel, ein Erbstück meiner Mutter. Er reichte vom Boden bis zur Decke und hatte ein silberhinterlegtes, geteiltes Spiegelglas. Der Rahmen war barock geschnitzt und mit Blattgold belegt. Ich sehe in diesem Spiegel, wie ich in der Tür stehe, sehe, wie ich weine und mir die Tränen übers Gesicht rinnen. Oder war es das Spiegelglas, das in der Hitze der Flammen langsam schmolz und gleich Tränen hinablief? Ich sehe mich auch im Kinderzimmer stehen und voller Entsetzen dabei zusehen, wie meine heißgeliebte Bibliothek verbrennt, über hundert Bücher, das Kasperletheater und das barocke Papiertheater von den Großeltern. In der Küche brannte das Büffet, eine besondere Kostbarkeit in meinen Augen, weil mein Vater es mit angeblich von Rembrandt bemalten und gebrannten Kacheln aus Holland beklebt hatte. Mein Vater hatte sie in mehreren Antiquitätenläden entdeckt und schwor darauf, dass sie echt seien.
Das war ein weiteres Mal, dass ich in einem Traum so lebhaft das sogenannte zweite Gesicht hatte, auch wenn ich nicht in die Zukunft sah, sondern zeitgleich im Geschehen war. Das begriff ich aber erst, als Johanna mich an diese Traumnacht erinnerte.
Später, als wir nach dem Krieg wieder nach Koblenz kamen, stand ich in den Trümmern unseres Wohnzimmers vor dem zerschmolzenen Spiegelglas aus meinem Traum. Von unseren Möbeln, unserer Einrichtung, war nur die Scherbe einer kleinen gelben Wandvase übrig geblieben. Diese Scherbe hängt als Erinnerung noch heute in meinem Esszimmer an der Wand.
Der Winter 1944 war bitterkalt. Das merkten wir auch im Internat. Meine fünfzehn Mitbewohnerinnen hatten jedoch alle warme Federbetten von zu Hause mitgebracht. Ich besaß nur eine dünne Decke und ging deswegen mit meinem Trainingsanzug ins Bett. Wenn ich am Morgen aufwachte, war mein Atem auf dem Kopfkissen gefroren.
Weihnachten stand vor der Tür, und das Internat wurde über die Weihnachtsferien geschlossen. Alle fuhren mit leichtem Gepäck nach Hause. Ich aber packte alle meine Sachen in meinen Koffer, denn ich hatte beschlossen, nicht mehr ins Internat zurückzukehren. Ich wollte bei meiner Mutter und meinem Bruder bleiben. Wo unser Vater war, wussten wir zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Also machte ich mich auf nach Kreuzburg. Als ich ankam, freute sich meine Mutter keineswegs, sondern war erbost, dass ich das Internat aufgekündigt hatte. Schließlich, meinte sie, wäre das Internat noch für ein Vierteljahr bezahlt. Ihre Reaktion verletzte mich sehr. Ich hatte das Gefühl, sie legte keinen Wert auf mich. Meiner Mutter kam es offenbar gar nicht in den Sinn, dass ich bei meiner Familie sein wollte – es war doch Krieg.
Kreuzburg lag achtzig Kilometer westlich der damaligen polnischen Grenze, und der Landrat, in dessen Haus wir mit Tante Jette und ihren drei kleinen Töchtern wohnten, riet uns: »Sobald es im Wehrmachtsbericht heißt, dass die russischen Panzer bei Tschenstochau durchgebrochen sind, müsst ihr von hier weg, denn dann stehen die Russen bald vor unserer Haustür.« Nur wenig später war es so weit, und wir mussten aus Kreuzburg fliehen.