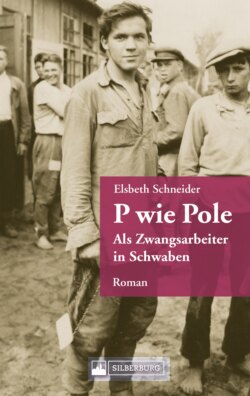Читать книгу P wie Pole. Ein Roman aus Schwaben - Elsbeth Schneider-Schöner - Страница 9
2
ОглавлениеVereinzelt fiel Licht durch die Ritzen des Güterwaggons; hatten die Augen sich erst an das Halbdunkel gewöhnt, konnte man die Menschen unterscheiden, die sich auf den Boden kauerten, flüsterten, stöhnten, weinten. In der Ecke der Latrineneimer, jetzt schon nach nur wenigen Stunden Fahrt voll bis zum Rand. Tomasz hockte an einer Seitenwand, eingezwängt zwischen einer jungen Floristin aus einer Warschauer Vorstadt und einem älteren Mann, der seit Beginn der Reise kein Wort gesprochen hatte. Es war so eng, dass man seine Beine nicht ausstrecken konnte, und Tomasz fühlte sich bald schon benommen, als hätte er zu viel getrunken. Die Angst erfüllte den Raum wie ein schlechter Geruch, dem man nicht ausweichen konnte. Mit jedem Atemzug nahm man sie auf und spürte, wie sie den ganzen Brustkorb für sich einnahm und dann ins Blut überging, um sich mit jedem Schlag des Herzens weiter im Körper auszubreiten und sich untrennbar mit der eigenen Substanz zu vermischen. Tomasz presste die Handflächen gegen die Bretterwand in seinem Rücken. Ich habe nichts mehr zu verlieren, sagte er sich. Sie können mir nichts mehr tun, ich brauche mich nicht zu fürchten. Aber die Angst interessierte sich nicht dafür.
Das unregelmäßige Ruckeln und Rattern des Zuges nahm Tomasz jedes Gefühl für die vergehende Zeit; als der Zug irgendwann unvermittelt bremste und anhielt, hätte er nicht sagen können, ob sie zwei oder zehn Stunden unterwegs gewesen waren. Draußen näherten sich Schritte, und die Waggontür wurde aufgerissen. Grelles Licht flutete herein.
»Los, raus hier, aber dalli! Scheißpause, los, los!« Die ersten taumelten nach draußen; Tomasz ließ sich zur Waggonöffnung drängen und verfluchte seine verkrampften Muskeln, als er hinaussprang und ungeschickt auf Händen und Knien landete. Der Zug stand im Nirgendwo, keine Stadt, kein Dorf, nicht einmal ein Haus war in Sicht, nur flache Steppe und vertrocknete Felder unter einem leeren Sommerhimmel. Fünfundzwanzig, dreißig Waggons, aus denen viel zu viele Menschen quollen und sich dann entlang des Bahndamms verteilten. Ein paar Frauen versuchten, sich mit ihren weiten Röcken vor zudringlichen Blicken zu schützen, andere hatten sich schon einfach irgendwo hingehockt, um ihre Notdurft zu verrichten. Die kleine Floristin war dabei, sah Tomasz, bevor er sich schnell abwandte. Sie hatte die Augen geschlossen, als könnte niemand sie sehen, wenn sie selbst auch nichts sah. Die meisten Männer stellten sich mit dem Rücken zum Zug und taten so, als wären sie allein. Eine Truppe von Wachleuten mit Gewehren hatte einen weiten Halbkreis um sie gebildet und beobachtete sie abschätzig; einer warf seine Mütze in die Luft und schoss darauf, alle übrigen lachten.
Gleich neben Tomasz stand ein Bursche von fünfzehn, höchstens sechzehn Jahren, ein hübscher Junge mit einem noch bartlosen Kindergesicht und hellblonden Haaren, die so weich aussahen, dass sie an ein Baby erinnerten. Der Junge sah sich mehrmals verstohlen um; er schien auf etwas zu warten, presste die Kiefer fest aufeinander, und Tomasz meinte zu spüren, wie dessen Muskeln bis zum Zerreißen angespannt waren und bereit, auf einen winzigen Impuls hin loszuschnellen. Er legte dem Jungen die Hand auf die Schulter und hielt ihn fest.
»Mach das nicht, Junge«, sagte er leise. »Die knallen dich ab, ohne mit der Wimper zu zucken.« Der Junge drehte sich wild zu ihm um und sah ihm ins Gesicht.
»Lass mich los, ich muss nach Hause! Meine Eltern haben keine Ahnung, wo ich bin! Ich muss hier weg!« Riesengroße blassblaue Augen, die Pupillen groß wie Kirschkerne; ein weicher Mund mit zitternder Unterlippe.
»Sicher. Nach Hause wollen wir alle.« Tomasz verstärkte seinen Griff. »Aber wenn du jetzt losrennst, kommst du nie nach Hause. Du hast keine Chance, dich zu verstecken. Die erschießen dich, bevor du hundert Meter weit gekommen bist. Sei vernünftig.« Ein weiterer Schuss ließ sie zusammenzucken; der Junge, der gerade noch versucht hatte, sich von Tomasz loszureißen, fing an zu zittern.
»Ganz ruhig, Kleiner … Es wird alles gut, hörst du? Alles wird gut! Du darfst nur keine Dummheiten machen …« Was rede ich da für einen Unsinn?, dachte Tomasz, während er den Jungen mit sich zog zu der Stelle, wo jetzt schwarzes Brot verteilt wurde und man mit seinem Becher Wasser aus einem Eimer schöpfen konnte. »Wie heißt du eigentlich?«
»Jan«, flüsterte der Junge. »Jan Dobiezcewski. Aus Lemberg.«
Jan, von allen Namen. Von allen Namen ausgerechnet dieser. Tomasz zog scharf die Luft ein, schloss für ein paar Sekunden die Augen, bis der Pfiff einer Trillerpfeife das Kommando zum Einsteigen gab. »Komm, es geht weiter … Jan. Komm.«
Jemand hatte die Geistesgegenwärtigkeit besessen, den Latrineneimer mit nach draußen zu nehmen und zu leeren. Der Eimer wurde als Erstes wieder eingeladen, dann kletterten die Gefangenen zurück. Tomasz ließ den Arm des Jungen nicht los und sorgte dafür, dass sie einen Platz nebeneinander fanden, so nah an der Waggontür wie möglich, wo man noch einen kleinen Luftzug spürte.
Der kurze Aufenthalt hatte die Lebensgeister der Deportierten angefacht und ihre Hoffnungen. Wenn man ihnen zu essen gab, konnte es ja wohl so schlecht nicht um sie bestellt sein, oder? Wozu sollte man das tun, wenn man sie nur umbringen wollte? Gespräche flackerten auf, munterer als zuvor, hier und da war sogar leises Lachen zu hören. Der Junge zitterte wieder; Tomasz legte ihm den Arm um die Schultern.
»Alles in Ordnung bei dir?«
»Ich – ja. Alles in Ordnung.«
Er hörte ihn schluchzen; wahrscheinlich schämte der Junge sich dafür. Tomasz konnte sich noch dunkel daran erinnern, für wie viele Dinge er sich geschämt hatte, als er in dem Alter gewesen war – ein zu schwacher Bizeps, zu spärlicher Bartwuchs, zu dünn, zu weich, zu verträumt. Es schien hundert Jahre her zu sein. Er drückte den Jungen leicht an sich.
»Und du bist ganz allein hier? Oder ist deine Familie in einem anderen Waggon?«
»Nein, meine Familie ist in Lemberg. Ich bin allein.« Selbst im fahlen Zwielicht des Waggons glänzte das Gesicht des Jungen von Tränen. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen.
»Ist ja gut, Janek«, sagte Thomas hilflos. »Ist ja schon alles gut. Sicher gibt es bald eine Gelegenheit, nach Hause zu schreiben und deinen Eltern Bescheid zu geben, wo du steckst. Vielleicht kannst du ihnen ja sogar ein bisschen Geld schicken. Ich habe gehört, dass man in Deutschland mehr verdient als hier.« Zumindest hatte das immer auf den Werbeplakaten gestanden, mit denen die Deutschen anfangs versucht hatten, polnische Arbeitskräfte ins Reich zu locken. Tomasz hatte nie daran geglaubt.
»Dann – dann denken Sie, man bringt uns zum Arbeiten nach Deutschland, Pan? Nicht ins Lager? Mein Onkel hat gesagt, in den Lagern …« Die Stimme brach ab.
Tomasz griff nach der feuchten Hand des Jungen und hielt sie fest. »Sag Tomasz zu mir, einverstanden? Ich denke, die wollen, dass wir für sie arbeiten. Ob das in einem Lager ist oder nicht …« Er ließ den Satz in der Luft hängen. Viele Deportierte lebten in Deutschland in Lagern, das wusste in Warschau jedes Kind. »Damit beschäftigen wir uns, wenn es so weit ist. Und im Lager bist du immerhin nicht allein. Kannst du ein bisschen Deutsch?«
»Wenig. Ich war auf dem Gymnasium, bis sie die Schulen geschlossen haben. Da habe ich es ein bisschen gelernt. Aber ich würde mir lieber die Zunge abbeißen, als diese Nazisprache zu sprechen.«
Tomasz seufzte. »Überleg dir das gut. Wahrscheinlich ist es ein Vorteil, wenn du Deutsch kannst.«
»Und du?«
»Ich spreche ganz gut Deutsch. Vor dem Krieg habe ich Germanistik und Philosophie studiert.« Tomasz spürte, wie der Körper des Jungen sich versteifte und ein Stück von ihm abrückte. Wahrscheinlich war dieses Kind überzeugt davon, jeder, der sich mit deutscher Geschichte, Philosophie und Literatur beschäftigt hatte, mit Kant, Goethe und Lessing, sei automatisch ein Kollaborateur.
»Ich bin im Widerstand! Bei den Partisanen!«
»Bist du wahnsinnig, das hier herauszuposaunen?! Behalt das für dich, kapiert? Hast du vergessen, wo du hier bist?« Immerhin hatte der Junge aufgehört zu heulen und hatte sogar die Fäuste geballt. Gut so. Im Flüsterton sprach Tomasz weiter.
»Und was hast du da gemacht, bei den Partisanen?«
»Nachrichten überbracht, Flugblätter verteilt … Und manchmal nachts haben wir Plakate überklebt oder andere Botschaften daraufgeschrieben.«
»Und das hast du in Warschau gemacht? Oder in Lemberg?«
»In Lemberg. Erst haben wir gegen die Russen gekämpft, dann gegen die Deutschen.«
Erleichtert stellte Tomasz fest, dass der Junge sich langsam beruhigte. »Wir? Du und deine Familie?«
»Nein. Meine Eltern wissen gar nichts davon. Wir, das ist meine Pfadfindergruppe. Wir haben uns der Untergrundarmee angeschlossen. Ganz viele Gruppen haben das getan, Sportvereine, kirchliche Jugendgruppen … Wir wollen ein freies Polen, stark, gerecht, unabhängig!«
Die Begeisterung war dem Jungen selbst jetzt noch anzuhören; Tomasz empfand so etwas wie Neid. Was für ein Alter, dachte er, in dem man in einer Minute ein heldenhafter Freiheitskämpfer sein konnte und in der nächsten ein Häufchen Elend, dem das Heimweh das Wasser in die Augen trieb. Erst dann fiel ihm auf, dass das mit dem Alter gar nichts zu tun hatte. Wie viele gestandene Männer und Frauen hatte er in den letzten Monaten unter dem Druck der Verhältnisse erst kämpfen und dann zusammenbrechen sehen? Und wieder aufstehen, darauf kam es an. Immer wieder aufstehen.
»Vergiss das«, sagte er etwas schroffer als nötig. »Diesen ganzen Helden- und Widerstandskram. Ab heute hast du nur noch ein Ziel: lebend zurück nach Hause zu kommen.« Der Junge murmelte etwas, das Tomasz nicht verstand. »Was hast du gesagt?«
»Bist du überhaupt ein Pole?, habe ich gefragt«, antwortete Jan hitzig. »Der Widerstand ist das Wichtigste überhaupt! Wie kann dir das egal sein?«
»Sprich nicht so laut, oder willst du gleich hier schon sterben?!« Am liebsten hätte Tomasz den Jungen geschüttelt, hätte ihn genommen und die ganze Naivität, den ganzen Idealismus und Leichtsinn aus ihm herausgeschüttelt. Die ganze Jugend, die es ihm so schwer machen würde zu überleben. »Wer sagt, dass es mir egal ist? Aber für alles gibt es eine Zeit. Und wenn du gerade in einem verdreckten Güterwaggon sitzt mit Bewaffneten rings um dich herum wie die Engelein um dein Bett, dann ist nicht die Zeit für Heldentum.« Auf diesen Jungen würde man aufpassen müssen, Gott im Himmel. Aber er, Tomasz, war nicht der Richtige dafür. Sicher nicht. »Was hast du in Warschau gemacht, als sie dich geschnappt haben? Oder bist du schon in Lemberg gefangen worden?«
»Nein, in Warschau. Ich habe einen Onkel dort, dem sollte ich Schuhe bringen, einen Koffer voll. Mein Vater ist Schuhmacher. Er wollte, dass mein Onkel die Schuhe in Warschau verkauft, weil es mehr bringt als zu Hause. Aber mein Onkel hatte keine Zeit, er arbeitet jetzt bei der Reichsbahn, beim Gleisbau. Deshalb bin ich selbst mit dem Koffer zum Kercelak gegangen, und da haben sie mich erwischt.« Er zog die Beine eng zu sich heran und umschlang sie mit den Armen. Genauso, dachte Tomasz, hat er bestimmt am Lagerfeuer gesessen, als er noch bei den Pfadfindern war, hat romantische Lieder gesungen und von Heimat und Heldentum geträumt.
»… wenn ich mich nur besser ausgekannt hätte, wäre ich abgehauen – in irgendeine Seitenstraße hinein, und zack! Ich wäre garantiert entkommen, garantiert.«
»Oder tot«, sagte Tomasz trocken. »In Warschau schießen sie auf Leute, die bei einer Razzia flüchten. Ist in Lemberg vielleicht anders.«
»Mein Freund Frantek …« Die Stimme war ganz leise, kaum noch zu hören jetzt. »Sie haben ihn erschossen, als er abends noch kurz mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren wollte. Einfach so. Und das Fahrrad haben sie mitgenommen.«
»Es tut mir leid.« Tomasz suchte nach tröstenden Worten. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie leid mir das tut. Und deshalb musst du alles versuchen, lebend zurückzukommen, hörst du? Dass deine Eltern so etwas nicht erleben müssen. Du musst so unauffällig sein wie möglich, tun, was sie dir sagen, gut arbeiten, einstecken. Und Deutsch sprechen, wenn es dir hilft. Davon, dass du’s nicht tust, geht der Krieg keinen Tag früher zu Ende.« Der Junge antwortete nicht. »Dein Vater ist Schuster, sagst du? Hast du bei ihm auch etwas gelernt? Warst du manchmal in der Werkstatt? Könnte nützlich sein.« Jan räusperte sich.
»Die letzten zwei Jahre habe ich ihm geholfen … als ich nicht mehr zur Schule gehen konnte. Aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin nicht besonders geschickt … Zwei linke Hände, sagt mein Vater immer. Aus mir wird nie ein Handwerker.« Er senkte die Stimme zu einem dramatischen Flüstern. »Ich werde Geistlicher. Der erste Pfarrer in meiner Familie.«
Tomasz hielt einen Seufzer zurück. Die Begeisterung für den Partisanenkampf und die alte Geschichte mit der anderen Wange schienen ihm nicht besonders gut zusammenzupassen, aber im Kopf eines Sechzehnjährigen mochte das anders sein.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie stolz meine Eltern darauf sind«, hörte er den Jungen sagen. »Ein Geistlicher in der Familie! Seit ich auf die Welt gekommen bin, haben sie jeden Złoty für meine Ausbildung zur Seite gelegt, den sie nicht unbedingt gebraucht haben.«
»Und du? Gefällt dir die Aussicht?« Der Junge straffte sich.
»Was meinst du damit? Es war meine eigene Entscheidung! Sie haben zwar immer darauf gehofft, aber letzten Endes muss man ja eine Berufung spüren, wenn man sein Leben Gott weihen will.«
»Und spürst du sie, diese Berufung?«
»O ja. Zum ersten Mal bei meiner Firmung, vor vier Jahren … Ein Gefühl, als stünde Gott selbst hinter mir und legte mir die Hand auf die Schulter, als wäre ich nach Hause gekommen …«
Tomasz war froh, dass es zu dunkel war, als dass Jan seinen Gesichtsausdruck hätte genau erkennen können. Seine eigene Beziehung zum lieben Gott hatte nach einer langen Zeit der Entfremdung und des gegenseitigen Desinteresses mit der Bombardierung Warschaus im September ’39 ihr jämmerliches Ende gefunden.
»Aha. Und wie ist es mit den Mädchen?«
»Hat mich nie interessiert. Höchstens als Kameradinnen bei den Pfadfindern …«
»Komm schon, du bist doch ein hübscher Bursche, da muss doch mal was gewesen sein!« Jan schüttelte den Kopf.
»Man muss auch Opfer bringen.«
In Tschenstochau gab es einen längeren Aufenthalt, bei dem alle Verschleppten in einem Gebäude in der Nähe des Bahnhofs erneut desinfiziert wurden, bevor man sie zurück in die Waggons trieb. Nach dieser zweiten Desinfektion hatte Tomasz keine Socken mehr – sie waren entweder in der Hitze und den Chemikalien des Ofens zu Staub zerfallen, oder jemand anderes hatte sie brauchen können. Aber wenigstens war Sommer, sagte er sich. Bis zum Winter würde er sich neue besorgen. Bis zum Winter wäre er vielleicht längst wieder zu Hause in Warschau.
Über Breslau, Berlin, Leipzig fuhren sie, fünf Tage und vier Nächte lang, ein Zug mit sechsundzwanzig Anhängern. Mehr als fünfzig Menschen waren in jedem einzelnen Waggon zusammengepfercht, in einem Raum ohne Fenster, Bänke, Decken oder Waschmöglichkeit. Gelegentlich hielt der Zug an, an einem Bahnhof, auf freier Strecke, aber nur zwei Mal jeden Tag öffneten sich die Türen, so dass die Verschleppten herausstolpern und inzwischen ohne jede Scheu oder Scham ihre Notdurft verrichten konnten; die Bewacher gaben Brot und Wasser aus, manchmal auch wässrige Kohlsuppe oder ein paar kalte Kartoffeln. Sie leerten den Kübel aus, der für Tomasz zum Sinnbild für die Schrecken dieser Fahrt geworden war, ein Eimer voller Mist und Dreck, der mit jeder Minute mehr Raum, mehr Atemluft für sich beanspruchte. Die Gegenwart des Kübels bewirkte, dass Tomasz sich selbst schmutzig und widerwärtig fühlte, dass er selbst in den Momenten, die er an der frischen Luft war, daran denken musste, wie seine eigene Kleidung, seine Haare, seine Haut stinken mussten; dass er sich schämte vor den geringschätzigen Blicken der Wachmänner und Wut empfand auf eine junge Frau, die sich während der Fahrt aus Ungeschick den Rock mit Kot beschmiert hatte. Bei einer dieser unberechenbaren Fahrtunterbrechungen sah Tomasz, wie ein paar Männer den steifen Körper einer alten Frau aus dem Nachbarwaggon hoben und am Bahndamm ablegten. Eine alte Frau mit langen dunklen Röcken und einer bestickten Jacke, mit abgearbeiteten Händen und dünnen weißen Haaren unter einem schlichten Kopftuch, gestorben an Altersschwäche, Angst und Gestank. Der eine oder andere zog sich bei dem Anblick die Mütze vom Kopf, die meisten aber nahmen den Vorgang kaum zur Kenntnis. Niemand hatte die Kraft und Energie, der Toten ein Grab auszuheben, und so lag sie noch am Bahndamm, als der Zug weiterfuhr. Immerhin hatte jemand ihr die Hände auf der Brust gefaltet und ein Kreuz aus zwei zusammengebundenen Zweigen zwischen ihre Finger gesteckt.
Bereits in der zweiten Nacht begannen die Wanzen über sie herzufallen, dreistes furchtloses Ungeziefer, für das es keine besseren Jagdgründe zu geben schien als die feuchte Wärme ungewaschener Körper. Der Junge war entsetzt, als er am nächsten Tag die rot geschwollenen Einstichstellen entdeckte, sobald sie zum ersten Mal aussteigen durften.
»Ich bin krank, Tomasz, schwer krank … Schau dir das an, überall diese Flecken! Und es juckt wie verrückt.« Nackte Panik stand in seinen Augen. »Glaubst du, es könnte Flecktyphus sein?« Jeder wusste, dass in den Lagern regelmäßig Flecktyphus ausbrach. Es war eins dieser Dinge, die man einfach wusste, ohne dass man hätte zurückverfolgen können, woher die Information eigentlich stammte. So wie man von Treblinka wusste oder von Auschwitz.
Tomasz nahm den Arm des Jungen und betrachtete ihn kritisch. »Mach dir keine Sorgen, Janek. Das sind bloß Stiche, Wanzen vermutlich.«
Jan sah ihn entgeistert an. »Das kann nicht sein«, sagte er. »Ich habe noch nie Ungeziefer gehabt! Meine Mutter nimmt jedes Frühjahr die Bettgestelle auseinander und wäscht sie mit Karbollösung ab, und in den Zimmerecken verbrennen wir Schwefel, und dann … Da gibt es keine Wanzen! Garantiert nicht.«
Tomasz hätte ihm am liebsten die Haarsträhnen aus der Stirn gestrichen wie einem kleinen Kind. »Bestimmt nicht«, sagte er. »Bei mir zu Hause gibt es auch keine. Es liegt nicht an dir oder an mir, sondern an diesem Scheißwaggon und daran, dass wir hier zu so vielen eingesperrt sind, immer noch die gleichen Klamotten am Leib haben wie an dem Tag, als sie uns geschnappt haben, und uns nicht waschen können. So etwas mögen die Wanzen, da kommen sie von allein. Ich hab auch ein paar Stiche am Bein.«
»Aber …« Dem Jungen standen die Tränen in den Augen, Tomasz sah schnell zur Seite.
»Du kannst Spucke drauf machen, dann juckt es nicht mehr so sehr. Und lange werden wir nicht mehr unterwegs sein, wir sind ja schon in Deutschland. Mit Sicherheit jagen sie uns wieder durch so eine Waschküche, bevor sie uns näher an sich ranlassen.«
Jan presste die Lippen zusammen. »Ich hasse sie«, flüsterte er. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich sie hasse!«
»Besser Wanzen als Fleckfieber«, sagte Tomasz und klopfte dem Jungen leicht auf die Schulter. »Komm, dahinten kriegen wir Wasser, aber nur, wenn wir nicht länger herumtrödeln.« Der Transport verwandelte sie in genau die Kreaturen, als die die Nazi-Propaganda sie immer schon dargestellt hatte: verdreckte, verlauste, geduckte Gestalten, mutlos, trostlos, hoffnungslos; demütige Sklaven, die dankbar waren für ein Stückchen trockenes Brot und einen Schluck Kohlsuppe und sich zu sehr schämten, um auch nur den Blick zu heben und sich in die Augen zu sehen. Selbst der Junge hatte seinen Trotz und seine Wut irgendwo unterwegs verloren, stellte Tomasz fest, als er Janek mit hängendem Kopf hinter den anderen her über den Bahnsteig trotten sah, die Schultern gebeugt wie ein alter Mann. »Bietigheim« stand auf dem Schild; Tomasz hatte den Namen noch nie gehört. Er beeilte sich, um Jan unter den Hunderten grauer Menschen nicht zu verlieren, die sich jetzt in Richtung Ausgang in Bewegung gesetzt hatten. Wie ruhig sie waren, dachte Tomasz. Außer den Kommandos der deutschen Wachen war kaum etwas zu hören – scharrende Füße, mal ein Husten, leises, furchtsames Gemurmel. Als sie das Bahnhofsgebäude verließen, konnten sie einige Hundert Meter entfernt die Wohnhäuser des nächsten Ortes ausmachen, so weit entfernt, dass man die Menschen nicht erkennen konnte, die dort auf der Straße herumliefen. Genauso wenig, wie diese Dorfbewohner die ankommenden Zwangsarbeiter erkennen konnten.
Durch ein lichtes Wäldchen marschierten sie eine Straße entlang und hatten schon nach wenigen Minuten das Lager erreicht, eine Gruppe niedriger Holzbaracken auf einem drahtumzäunten Gelände. Der beißende Geruch von Desinfektionsmittel quoll ihnen entgegen, stach in die Nase, brannte in den Augen, die sofort zu tränen begannen. Sie stolperten voran zu einem Seiteneingang, wo gerade ein Tor aufgeschwungen wurde. Ein Uniformierter stand gelangweilt daneben, musterte die Neuankömmlinge und machte sich einen Spaß daraus, mal dem einen, mal dem anderen einen Schlag mit seinem Gewehrkolben zu verpassen. Auch die Frau neben Tomasz wurde getroffen und schnappte nach Luft; sie wäre gestürzt, wenn er sie nicht am Arm gehalten hätte. Einen Augenblick lang, einen winzigen Augenblick nur überlegte er, ob er nicht protestieren sollte – er sprach doch gut Deutsch, die Sprache der Philosophen und Herrenmenschen, er hätte sagen können, dass es für den Angehörigen eines Kulturvolkes unwürdig war, eine entkräftete Frau aus Langeweile zu schlagen, unwürdig und beschämend – da war der Augenblick schon vorbei und er mit der Frau in seinem Arm in die Lagerwelt eingetreten.
Das Durchgangslager Bietigheim bestand aus zwei voneinander durch einen Zaun getrennten Bereichen, nämlich dem unreinen und dem reinen Bereich. Als Schleuse fungierte die sogenannte Entlausungsanlage. Sofort wurde die erste Gruppe in die Anlage hineingetrieben, während die anderen auf dem Appellplatz zu warten hatten, bis sie an der Reihe waren. Nur die wenigsten verstanden die auf Deutsch gebrüllten Anweisungen; die meisten hockten ergeben und apathisch auf dem Boden und ließen sich von den Wachen hin- und herschieben wie Gepäck.
»Hätte nie gedacht, dass ich mich auf die Entlausung freuen würde«, presste Janek zwischen den Zähnen heraus, als er sich neben Tomasz in eine Schlange einreihte, um endlich die Ankunftsration – ein Stück Roggenbrot mit Margarine – in Empfang zu nehmen. Der Junge reagierte stärker auf das Ungeziefer als die meisten anderen; statt der üblichen roten Punkte und Quaddeln entwickelte er großflächige, übel aussehende Schwellungen, die noch dazu erbärmlich juckten und ihn in den Nächten kaum zur Ruhe kommen ließen. Mehrfach war Tomasz davon aufgewacht, dass der Junge sich im Halbschlaf kratzte wie verrückt, und hatte versucht, ihn davon abzuhalten. Er warf einen Blick auf die andere Seite, die reine Seite des Zauns. Es war nicht schwer zu erkennen, dass das Lager hoffnungslos überbelegt war, dass vermutlich auch im reinen Bereich überfüllte Baracken auf sie warteten, aus denen Läuse und Wanzen sich nicht vertreiben ließen, mochte man auch jeden Tag die Insassen samt deren Kleidung desinfizieren. Ermutigend klopfte er Jan auf die Schulter.
»Geduld, Kleiner. Wenn wir erst hier raus sind, wird es besser.«
Janek sah ihn aus verklebten Augen an. »Was denkst du, wie lange das dauern wird?«
»Keine Ahnung. Aber ich glaube, die brauchen uns dringend zum Arbeiten, sonst hätten sie uns ja nicht hierhergeschleppt. Wahrscheinlich wollen sie uns so schnell hier durchschleusen wie möglich.«
Weil jeder nur ein Stück Brot bekam, ging es zügig voran, fast waren sie schon an der Ausgabestelle angelangt. Viele hatten ihr Brot schon aufgegessen, wenn sie zu ihrem Platz zurückkehrten.
»Ich habe eigentlich noch nie richtig gearbeitet …«
»Haben sie dich nicht eingezogen?«
»Doch, schon. Um die Arbeitspflicht kommt man nicht herum. Aber mein Vater kennt jemanden bei der Stadtverwaltung, der hat mir eine Aushilfsstelle gegeben, so dass ich wenigstens auf dem Papier etwas nachweisen konnte und eine Arbeitskarte hatte. Eigentlich hatte ich da aber nichts zu tun, sondern konnte anfangen, Altgriechisch zu lernen.«
Altgriechisch, was zum Teufel!, dachte Tomasz. Was für eine Vorbereitung auf das Leben als Hilfsarbeiter unter Tage oder wo auch immer! Er riss seinen Brotkanten in zwei Teile und nahm sich vor, ein Stück davon für später zu verwahren und den Rest so langsam zu essen wie möglich.
»Antreten, los, los!«
Tomasz schreckte von seiner Pritsche hoch. Seit drei Tagen waren sie jetzt im Lager, und er hatte sich noch nicht daran gewöhnt, ständig darauf gefasst zu sein, irgendeinem Befehl zu gehorchen. Ein Befehl rief die Deportierten in die Duschräume und hieß sie danach frierend und nackt darauf warten, dass ihre Kleidung aus der Entwesungsanlage kam, ein Befehl trieb sie durch die ärztliche Untersuchung, zum Lagerfotografen und zu der Stelle, wo ihre Fingerabdrücke genommen wurden wie von Kriminellen; ein Befehl klebte an der Ausländerkennkarte und erst recht an den fünf P-Abzeichen, die an der Kleidung anzubringen waren und jeden darüber informierten, dass der Träger ein polnischer Arbeiter war und somit jedem Deutschen zu Gehorsam und Demut verpflichtet. Tomasz besaß gar keine fünf Kleidungsstücke, um alle Abzeichen vorschriftsmäßig anzunähen; ein einziges hatte er an seiner eingelaufenen Jacke angebracht. Er zog sich die Schuhe an (noch ein, zwei Entwesungen, schätzte er, dann würden sie komplett auseinanderfallen) und lief mit den anderen Barackenbewohnern nach draußen auf den zentralen Platz. Niemand hielt sich freiwillig hier auf, denn von der Latrine, einem riesigen Loch in der Lagermitte mit Querpfählen darüber, auf denen man sitzen musste, um seine Notdurft zu verrichten, ging ein bestialischer Gestank aus, der Fliegen in großer Anzahl anzog. Wenigstens konnten sich auch die Lagerwärter, die entlang des Platzes Aufstellung bezogen hatten, dem Gestank nicht entziehen.
»Antreten!«
Sie stellten sich vor den Baracken auf wie befohlen; Tomasz schaffte es, sich neben Janek zu platzieren. Der Junge hatte in den letzten Tagen kaum ein Wort mit ihm gesprochen; die weißblonden Haare hingen strähnig um sein Gesicht, das immer noch von Ungezieferstichen angeschwollen war. Wieder und wieder hatte Tomasz versucht, ihn aufzumuntern und seinen Kampfgeist anzustacheln, aber Janek zog sich immer weiter in sich selbst zurück wie ein kleines Tier, das sich vor Feinden schützen will. Ein typisches Opfer, dachte Tomasz beunruhigt, ein Opfer, das durch seine Schwäche andere geradezu zu Gewalt einlädt.
»So, Junge, es geht los!«, flüsterte er Janek zu und hoffte, dass seine Stimme sich ermutigend anhörte. Janek reagierte nicht. »Brust raus, Bauch rein, komm schon, du weißt doch, wie das geht! Und egal, was sie von dir wollen, du musst versuchen, es zu lernen. Je mehr du kannst und je besser du arbeitest, desto mehr werden sie dir zu fressen geben, glaub mir.«
Janek sah ihn unsicher an. »Und du? Du hast doch studiert, hast du gesagt.«
»Immerhin hatten meine Großeltern einen Hof, da habe ich früher jeden Sommer verbracht. Wenn mich einer danach fragt, ob ich Erfahrungen in der Landwirtschaft habe, dann sage ich Ja. Und du auch.«
»Aber …«
»Hier geht es nicht darum, die Wahrheit zu sagen oder fair zu sein oder edel. Es geht nur noch darum, lebend wieder rauszukommen, lebend, mit allen zehn Fingern und allen Zähnen und in der Lage, danach wieder ein normaler Mensch zu sein, verstehst du? Wenn sie dich fragen, ob du Deutsch kannst, dann sagst du Ja. Wenn sie dich fragen, ob du sensen und melken und dreschen kannst, dann sagst du Ja! Und wenn sie dich fragen, ob Hitler ein großer Mann ist und der gottgewollte Führer der Welt …«
»Dann sage ich Ja?«
Tomasz lachte leise und gab dem Jungen einen leichten Klaps.
»Dann hältst du die Klappe. Vergiss nie, dass du ein Mensch bist, auch wenn sie versuchen, etwas anderes aus dir zu machen.«