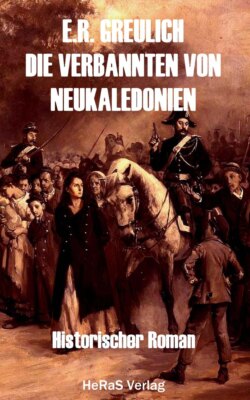Читать книгу Die Verbannten von Neukaledonien - E.R. Greulich - Страница 6
DRITTES KAPITEL
ОглавлениеVom Unglück, nicht füsiliert worden zu sein (Aus dem Tagebuch des Paschal Grousset)
Gibt es einen verlässlicheren Freund als das Tagebuch? Wer brächte so viel Langmut für Abrechnungen mit sich und den andern auf; wer hätte so viel Geduld für die Bekenntnisse, Gedanken- und Erinnerungen eines Abenteurers wider Willen? Ich, Paschal Grousset, -Pamphletist und verhinderter Romancier, Zeitungsschreiber und Kommunard, würde ersticken, könnte ich nicht schreiben. Dieses zerflederte Bändchen ist mein einziges Kapital, gut für etliche Novellen und Romane. Allerdings würde enttäuscht sein, wer einen chronologischen Abriss vom Entstehen und Untergehen der Pariser Kommune erwartete oder, den Bericht eines Barrikadenkämpfers. Ich habe nicht mit der Waffe in der Hand gekämpft. Was ich bei Verhaftung, Verurteilung und Verbannung erleben musste, lässt mich das nachträglich bedauern. Das Grundthema meiner Aufzeichnungen ist sehr persönlicher Art, in und zwischen den Zeilen ist häufig zu lesen: Manon. Bei meiner Verurteilung stand sie in Gedanken neben mir und flüsterte beschwörend: Kein Trauern über tote Zeit! Nutze sie, deine Flucht zu betreiben. Für immer ohne dich, Paschal, kann ich nicht leben.
Ich, ein Mann von siebenunddreißig, balle nachts manchmal die Fäuste in ohnmächtiger Wut. Durch Manon wurde mir schmerzhaft bewusst - und die Einsamkeiten während der Verbannung vertieften das Gefühl: die Erde wäre ein toter Planet, gäbe es die Liebe nicht.
Weil ich die höchsten Höhen erleben durfte, fluche ich denen, die uns trennten, und denke manchmal, was wäre mir erspart geblieben, wäre auch ich an der Mauer der Föderierten erschossen oder mit den Kameraden in der Ebene von Satory umgebracht worden. Auf die Barrikade zu gehen ist tapfer, wie viel Tapferkeit aber gehört dazu, eine Niederlage durchzustehen? Nur Hoffnung auf Vergeltung hält die meisten deportierten Kommunarden in Neukaledonien aufrecht. Unser Herz gehört dem vergewaltigten Paris, dem betrogenen Frankreich, wer uns aus dem Mutterboden riss und über zehntausend Meilen weit hinter die Wasserwüste des Stillen Ozeans fortschaffen ließ, wie groß muss dessen Furcht vor uns sein. Die kleinen Wachsoldaten und Beamten der korrupten Verwaltung verachten wir, unser Hass gilt den Schlächtern in Uniform und Zivil. Sage niemand, aus mir spreche nur die Verbitterung des Geschlagenen. Wir sind historisch im Recht, also auch moralisch. Der Fortschritt wäre keine ethische Kategorie, gäbe es nicht den ständigen Kampf der Fortschrittlichen gegen das Gestern. Die Gewalt des Gestern schlägt zu, wenn aus dem Traum Wirklichkeit zu werden droht.
Kaum glaublich, dass ich den Versailler Söldnern in Paris selbst entkommen konnte, bald darauf aber dennoch zum Heer ihrer Gefangenen gehörte. Vierzigtausend Verhaftete, soll man sie erschießen oder amnestieren? Beides wurde von seriösen Zeitungen vorgeschlagen. Die Regierung, ständig assistiert von ihrer servilen Nationalversammlung, wählte für einen Teil der Gefangenen den goldenen Mittelweg: langsamer Tod vermittels Deportation. Über hundert höhere Offiziere erhielten den Auftrag, achtzehn Kriegsgerichte zu bilden. Die Versailler Kriegsgerichte brachten Tausenden das Schaudern bei. Exakt funktionierten sie, eine zuverlässige Maschinerie, bis der letzte Angeklagte verurteilt war. Deportation, angedroht als Strafe für den "Angriff auf die Regierung", wurde zum Synonym für Trostlosigkeit. Für einfache Deportation hatte man die Ile de Pins ausersehen, die Halbinsel Ducos für Deportation nach einem befestigten Platz. Insel wie Halbinsel gehören zum französischen Kolonialbesitz Neukaledonien, für den nun auffällig die Trommel gerührt wurde. In offiziellen und offiziösen Publikationen hieß es, die Deportierten würden ein reiches Land betreten, in relativer Freiheit leben, lohnende Arbeit bekommen, sie könnten dort Wohlstand und Glück finden. Sofern sie es wünschten, würde man ihre Familien auf Staatskosten nach Neukaledonien schaffen; falls sie noch ledig seien, würden sie bei der Familiengründung unterstützt. Der parlamentarische Berichterstatter zum Gesetz über den Vollzug der Deportationen, Monsieur de Haussouville, begrüßte vor der Versailler Nationalversammlung in dieser Zwangsauswanderung die Anfänge eines neuen französischen Reiches an den Gestaden des Stillen Ozeans.
Verurteilt zur Deportation nach einem befestigten Platz - der Halbinsel Ducos -, wurden wir in Viehwaggons gepfercht und kamen nach tagelanger, qualvoller Eisenbahnfahrt in Brest an. Von dort brachte man uns zum Fort Boyard, einem Turmbau, der, auf einer Sandbank errichtet, nur bei Flut mit Booten zu erreichen ist und schon lange ohne Besatzung war. Wir gehörten zum ersten Transport und kamen an einem kalten Oktobertag an, mit uns der Gefängnisdirektor und die kleine Garnison der Wachsoldaten. Zu Trupps von je zehn Mann trieb man uns in die Kasematten. Es gab keine Schlafgestelle, keine Matratzen, nicht einmal etwas Stroh für unsere maladen Körper. Lediglich alte, verrostete Kanonen standen herum. Weder lässt es sich auf einem Kanonenrohr schlafen, noch vermag man damit Suppe zu löffeln, die uns in einem Trog gebracht wurde. Wir weigerten uns, wie die Schweine zu essen, und hungerten bei unserer kargen Ration Schiffszwieback. Nach zehn Tagen zahlte sich unsere Beharrlichkeit aus. Der Gefängnisdirektor hatte in Versailles angefragt und die Erlaubnis erhalten, uns Löffel auszuhändigen, da dieselben nicht als Waffen zu betrachten seien.
Alle eingehende Post war selbstverständlich geöffnet. Nur einmal jeden Monat war es gestattet, einen Brief an Familienangehörige zu schreiben. Unsere Korrespondenz wurde zensiert und nicht selten zurückgehalten. Doch jeder Brief, der endlich zu uns gelangte, bedeutete Wärme und Licht im kalten Kerker. Wir litten unter der Kälte noch mehr als unter der Enge. Die Abteilungen in den Gitterkäfigen der Kasematten waren samt und sonders überbelegt, heftig ersehnten wir jeden Tag die halbe Stunde frische Luft, und die Beine vertreten auf dem Plateau des Forts, obwohl es auch dort so eng war, dass wir im Kreisgang dicht hintereinander laufen mussten. Nach drei Monaten bekamen wir Matratzen, die meisten von uns litten inzwischen an Rheuma. Wieder nach drei Monaten, im März zweiundsiebzig, erfuhren wir von unserer baldigen Abreise und dass jeder ein Gnadengesuch einreichen könne. Wir vereinbarten, diese Art Milde zu ignorieren. Nun wurde, aus dem Kann ein Muss. Jeder hatte einzeln vor dem Gefängnisdirektor zu erscheinen, um die persönlichen Gründe für sein Gnadengesuch darzulegen, dass dann von der Versailler Gnadenkommission geprüft werden sollte. Was wir vermutet hatten, erwies sich als wahr. Es handelte sich um ein neues Manöver, ausgeheckt für die Öffentlichkeit: Seht, wir haben sogar eine Kommission eingesetzt, die jede Bitte um Gnade prüfen wird! Gerechter geht es nicht!
Als ich zum Gefängnisdirektor Pinoy gerufen wurde, war ich entschlossen, mich nicht provozieren zu lassen. Dann stand ich in seiner Kanzlei, und es fiel mir schwer, zu begreifen, dass dieser joviale, ja fast leutselige Monsieur derselbe war, der seit einem halben Jahr versuchte, uns durch tausenderlei Schikanen seelisch und körperlich zu zermürben.
Mit freundlicher Geste wies er auf einen Stuhl, ein Stück von seinem Schreibtisch entfernt und zündete sich gelassen eine Brasil an. "Nun, Grousset, Sie haben sicherlich schon über Gründe für Ihr Gnadengesuch nachgedacht?"
Ich verneinte.
Pinoy legte ein Blatt Papier bereit und tunkte die Feder ins Tintenfass. „Wir werden es also nachholen."
"Ich denke, es wird nicht nötig sein, Herr Direktor."
Er tat, als habe er nicht gehört, sprach halblaut meine Personalien vor sich hin und schrieb sie auf das Blatt. Er hat deine Akte aufmerksam studiert, dachte ich und ließ ihn gewähren. Bei dem Wort verheiratet sah er mich fragend an. Ich nickte und sagte: "Mit Manon Grousset, geborene Printemps." Ich musste lügen, denn nur weil sie sich als meine Ehefrau ausgegeben hatte, war mir vor kurzem Manons Brief ausgehändigt worden, der erste und einzige bis jetzt. Das kostet mindestens vierzehn Tage Dunkelarrest, befürchtete ich, als er fragte: "Weshalb hatten Sie bisher angegeben, Sie seien ledig?"
Ich tat verlegen. "Es war mir peinlich, Herr Direktor. Sie wissen, ein Mann, dem die Frau weggelaufen ist, spielt eine klägliche Rolle. Inzwischen hat sie es sich überlegt und möchte wieder mit mir zusammenleben."
„Großartig!" Pinoy begeisterte sich. "Triftiger Grund für ein Gnadengesuch."
Er hatte den heftigen Wunsch, mit recht vielen Gnadengesuchen aufzuwarten, deshalb seine Samtpfötchen, und darum durchschaute er auch meine schwache Ausrede nicht, vielmehr, er wollte sie nicht durchschauen. Mir konnte es recht sein, denn das ließ mir die Hoffnung, auch fernerhin Briefe von Manon ausgehändigt zu erhalten. Es sei denn, Pinoy würde auf den Schwindel zurückkommen, falls ich festbliebe. Das aber musste ich. Ich war es mir schuldig, mir und den Kameraden, denn ich war einer von denen, die getrommelt hatten: Kein Gnadengesuch!
Ich wiederholte meinen Satz. "Es wird nicht nötig sein."
Pinoy schaute drein wie ein Kind, dem man gesagt hat, Weihnachten fällt aus. "Sie scherzen, Grousset. Sie behaupten doch nicht im Ernst, es sei unnötig, ein Gnadengesuch einzureichen. Erst recht nicht, wenn es Ihnen die Strafbehörde nahelegt."
"Wenn ich schon um etwas bitten würde, Herr Direktor; dann um Gerechtigkeit."
"Wann gab es je Sieger, die man ungestraft verleumden durfte, sie seien ungerecht?" Pinoy sagte es lächelnd, aber in seinem Blick war Heimtücke.
„Ich bin auf keinen Streit darüber aus, Herr Direktor", sagte ich sanft, "das mir zudiktierte Strafmaß genügt mir vollauf."
"Sie können es eventuell' mildern durch ein Gnadengesuch."
"Ich bin verurteilt zur Deportation an einen festen Platz, wenn ich daran erinnern darf, Herr Direktor. Stattdessen verbringe ich bereits sechs Monate in einem mittelalterlichen Kerker. Mein Verbringungsort ist die sonnige Halbinsel Ducos. Über diese feuchten Kasematten inmitten von Meer und grauem Nebel steht nichts in meinem Urteilsspruch.“
"Sie wünschen die wohlwollend gewährte Gelegenheit für ein Gnadengesuch umzuändern in eine Beschwerdestunde. Grousset?" Pinoy fragte es giftig.
"So kurz vor der Abreise sähe ich wenig Sinn in einer Beschwerde, Herr Direktor. Meine Bemerkung war mehr philosophischer Art und bezog sich auf das Problem Urteil und Ausführung."
"Scheren Sie sich zum, Teufel, Sie - Sie Philosoph!" Er brüllte es derart, dass ich zusammenzuckte. '"Ihr werdet das bereuen, ihr Hanswürste mit der Tapferkeitsmarotte! Dörrt nur erst in der südlichen Sonne wie ausgenommene Klippfische! - Raus!"
Unsanft packten mich die zwei Wachsoldaten; als sie das Gitterviereck aufgeschlossen hatten, vergaß keiner von beiden, mich mit einem Tritt zu bedenken. Über Pinoys Ärger mit der Gnadenkampagne seiner Regierung geriet die Geschichte mit meiner angeblichen Ehefrau in Vergessenheit. Ich hatte schon mehrere Briefe an Manon geschrieben, war aber bisher ohne Antwort geblieben. Als mich dann unerwartet jener Brief von Manon erreichte, fragte ich mich, wie sie meinen Aufenthalt erkundet haben mochte. Später erfuhr ich, dass sie in den Zeitungen von vier Gefangenendepots gelesen hatte, die auf den Reeden von Brest und Les Trousses eingerichtet seien, nämlich im Schloss von Oleron, in der Zitadelle des Saint-Martin-de-Re, im Fort Quelern und im Fort Boyard. Von den drei vorgenannten hatte Manon ihren Brief an mich zurückbekommen, also adressierte sie ihn nun nach Fort Boyard. Ich antwortete sofort, aber diesen Brief hat sie wohl nie erhalten.
Die Mitteilung von unsrer baldigen Abreise war ein fauler Trick gewesen, um uns für die Gnadengesuche zugänglicher zu machen. Als wir endlich, auf Tauglichkeit für die Überfahrt geprüft wurden, lag bereits ein Jahr in den Käfigen hinter uns.
Die sogenannte Tauglichkeitsuntersuchung ähnelte den bekannten Komödien mit Militärärzten, nur geschah sie hurtiger. Der Gemütsmensch, Marinearzt Dr. Chanal, legte nur einmal kurz das Ohr an die Brust jeden Mannes, um dann dem Schriftführer zuzurufen: "Gut zur Abreise!" Während dieser Prozedur hatte er sogar noch Zeit, jeden zu fragen, ob er selbst sich auch tauglich fühle: Verneinte jemand, erfolgte der besagte Ruf des Dr. Eisenbart um so sicherer. Uns verging das Lachen, als Dr. Chanal den Kameraden Corcelles ebenfalls auf diese Art behandelte. Corcelles litt an Schwindsucht und vermochte sich kaum auf den Beinen zu halten, er war von uns zur Untersuchung getragen worden. Ein jüngerer Arzt der Kommission bekam Mitleid und flüsterte mit Dr. Chanal, um einen Reiseaufschub zu bewirken. Der wurde unwirsch: "Ach was, die Haifische müssen auch was zu fressen kriegen!" Drei Wochen später ging der Wunsch des Haifischfreundes in Erfüllung. Corcelles starb und fand sein Grab im Meer.
Eine Seefahrt stellt sich in Volksliedern und Gassenhauern meist als amüsant dar. Wir wurden sehr bald gegenteilig belehrt. Wenigstens kamen wir nicht aus der Gewohnheit, zwischen Gittern hausen zu müssen. In den sogenannten Batterien, dem Zwischendeck der Fregatte 'Danae' befanden sich vier eiserne Riesenkäfige für je hundertfünfundsiebzig Mann. Unser Reisegepäck bestand aus einem kleinen Leinwandsack mit abgetragenen Kleidungsstücken und einer Hängematte, die nur nachts aufgehängt werden durfte. Wir hingen so dicht wie Fliegende Hunde auf Affenbrotbäumen, und je heftiger die Schiffsbewegungen waren, desto heftiger stieß man gegen die Körper seiner Nebenmänner. Das Essen war karg, aber gut gesalzen, das Trinkwasser so rar wie das Waschwasser, am rarsten war frische Luft. Die durften wir täglich eine halbe Stunde genießen, und das enge Plateau des Forts Boyard wuchs in der Erinnerung zum riesigen Tummelplatz. Denn jetzt war kein Gedanke mehr an Spaziergang. Wenn es regnete, hielten wir die weitgeöffneten Münder dem kühlen Nass entgegen, es war wie ein Trost des Himmels.
Vor der Abreise hatte man uns Briefpapier ausgehändigt und versprochen, die Briefe noch von Fort Boyard abzusenden. Als wir in Brest die Fährboote verlassen hatten und durch das Hafengelände marschierten, steckten die Briefe noch immer in unsern Taschen. An Gruppen von Hafenarbeitern wurden wir vorbeigetrieben, ihre Gesichter drückten keine Sympathien für unsere Wächter aus. Ich knüllte den Brief an Manon und ließ ihn dem Arbeiter, eines Entladungstrupps vor die Füße rollen, dessen Augen hasserfüllt auf unsere Bewacher blickten. Der mit dem aufgepflanzten Bajonett neben mir hatte etwas bemerkt, doch der Schauermann setzte derart herausfordernd seine Sohle auf das Papierknäuel, dass der Scherge es für geraten hielt, nichts gesehen zu haben.
Beim Verlassen von Fort Boyard hatten wir geglaubt, das Schlimmste sei nun vorüber, doch auf dem Schiff begruben wir diese Illusion. Der Lieblingssport des Kommandanten der 'Danae', des Kapitäns zur See Rion de Kerprigent, bestand darin, jeden Tag einige der schwächsten Gefangenen zu schwerster Schiffsarbeit zu kommandieren. Da nichts von Zwangsarbeit in unseren Urteilen stand, weigerten sich eines Tages die Kameraden Malzieux, Bauer und Cipriani, der Aufforderung des Kapitäns Folge zu leisten. Er ließ sie im untersten Schiffsraum in Eisen legen. Erst bei unserer Ankunft, nach vierundzwanzig Tagen, sahen sie das Sonnenlicht wieder. Sie hatten gelebt von brackigem Wasser und, Schiffszwieback, Malzieux war achtundsechzig Jahre alt.
Wir hatten den Dreien abgeraten, auf diese Art Widerstand zu üben, doch für sie stand die Menschenwürde höher als unsere pragmatischen Überlegungen, und da sie nun in der Backofenhitze des Schiffsbauchs schmachteten, litten wir mit ihnen. Es wurden Pläne geschmiedet, sie zu befreien. Wir hätten dazu das Schiff in unsere Gewalt bringen müssen. Keiner von uns scheute ein Risiko, wir wussten auch, dass es hundertprozentige Sicherheit für das Gelingen einer Überrumpelung nicht gibt. Mit der Sensibilität des grausamen Feiglings spürte de Kerprigent, was unter uns vorging. Er bemühte sich ins Zwischendeck und erklärte: Immer wenn die Insassen eines Käfigs an Deck seien, werde er die drei andern Käfige mit Wachsoldaten umstellen lassen. Falls auf Deck der Versuch einer Meuterei beginne, würde er Schnellfeuer auf die vollen Käfige befehlen.
Der Sadist hatte uns unsere Grenzen gezeigt, dementsprechend war die Stimmung. Aber mehr oder weniger hielt die Hoffnung auf 'das gelobte Land' alle aufrecht. Bei der Ankunft im Hafen von Nouméa gingen 689 Deportierte von Bord, 'nur' 11 waren an den Strapazen der 157tägigen Seereise gestorben. Allerdings hatten nur wenige die Fahrt heil überstanden. Fast alle litten an Asthma, Herz- und Magenkrankheiten, an Rheumatismus und Skorbut. Beim Wort Skorbut muss ich an jenes 'Dementi' der Thiers-Regierung denken, das lautete: "Die Nachrichten, welche von der englischen Presse über die Überfahrt der 'Orne' mitgeteilt wurden, sind in allen Punkten ungenau, denn weit entfernt davon, 400 Skorbutkranke zu haben, zählte dieses Schiff derer kaum 170."
Bei der Ankunft auf der Reede von Nouméa hatte ich das Glück, zu denen zu gehören, die sich eben auf Deck befanden. In langer Krümmung streckt sich die Halbinsel Ducos ins Meer und bildet so eine natürliche Hafenbucht für die Hauptstadt Nouméa. Eine schmale flache Landenge verbindet die Halbinsel Ducos mit Neukaledonien. Selbst ein Laie erkennt die militärstrategischen und schifffahrtstechnischen Vorteile dieses französischen Vorpostens in den australischen Gewässern. Jedem Experten des Strafvollzugs musste Ducos als Verbannungsort ideal vorkommen. Deutlich sah man den Unterschied in der Vegetation. Die Küste Neukaledoniens bis an Nouméa heran erinnerte in ihren vielen Grüntönen an einen botanischen Garten. Dagegen wirkte Ducos trist. Das Braungrau vulkanischen Gesteins war dominierender Farbton des etwa hundertfünfzig Meter hohen Höhenzugs. Quer dazu erhoben sich kleinere langgestreckte Hügel, getrennt durch Regenwassereinschnitte, weiter unten waren sie mit grüngelbem Gras bewachsen, und von dort fiel das Land sanft ab bis zum Meer. Die Regenwasserschluchten verbreiterten sich zum Strand hin und bildeten sumpfige Oasen, bestanden mit Schilf- und Binsengewächsen, wogegen am Rand Sumpfbäume wuchsen. Außer den kargen Baum- und Buschgruppen entlang des Strandes waren weiter hinauf kleine Gehölze und auch einzeln stehende Niaoulibäume zu erkennen, jene weißstämmige und wohl bekannteste Art Eukalyptusbäume.
Nachdem wir ausgeschifft waren, wurden wir ins Lager getrieben. Die Behausungen am Hang waren zur einen Hälfte ausrangierte Militärzelte für je zwölf Mann, zur andern Hälfte Bretterbaracken. Nach dem Gesetz durfte ein Deportierter sich die Wohnung selbst bauen. Da er aber weder Handwerkszeug noch Material bekam, brauchte es überdurchschnittlicher Geschicklichkeit und Erfindungsgabe, wollte er trotzdem nicht auf ein "eigenes Heim" verzichten. Ein Deportierter, durfte auch, entsprechend dem Gesetz, nach fünf Jahren Ducos verlassen und zur Hauptinsel übersiedeln, falls sein Antrag genehmigt wurde. Die Prozedur war umständlich, quälend langsam und völlig von der Laune des Gouverneurs abhängig, erfuhren wir später. Ich gedachte keine fünf Jahre zu warten und war gewillt, mich früher und ohne Erlaubnis zu verabschieden. Das hatte ich Manon und mir geschworen, und ich gedachte nicht, den Schwur zu brechen.
Die Nahrung wurde jeden Morgen ausgegeben: 250 Gramm ranziger Speck, 750 Gramm Zwieback, 100 Gramm gedörrte Bohnen und 16 Gramm Kaffee. Zur Abwechslung gab es manchmal für den ranzigen Speck intensiv riechendes Pökelfleisch, für den eisenharten Zwieback butterweiches schimmliges Brot. Die Bohnen besaßen auch nach drei Tagen des Weichens in Wasser noch ihre felsenfeste Konsistenz, wir kamen schließlich darauf, sie zwischen zwei Steinen zu zermahlen. Da wir nicht einen Span Holz geliefert bekamen, gab es bald rings um das Lager auch nicht die Spur von Brennmaterial. So befanden wir uns in zivilisatorischer Hinsicht auf dem Lebensniveau der Papuas, wir aßen das meiste Essbare roh.
Der Wassermangel gehörte zu den schlimmsten Übeln. Da war kein Bach, nicht die kleinste Quelle. Ohne das Meer ringsum und die Regenzeit wäre Ducos eine Wüstenei gewesen - es gab ohnehin noch zahlreiche Einöden, weiter oben, mit nacktem Fels und unfruchtbarem Sand. Das Trinkwasser brachte man in Fässern auf Booten von Nouméa, es war selbst für die Wachsoldaten und Verwaltungsbeamten teurer als französischer Landwein. Doch wer möchte sich, nicht ab und zu einmal waschen, von der Kleiderreinigung zu schweigen. Später, in der Regenzeit, legten wir primitive Auffangbecken an und lebten einige Tage in Saus und Braus, wuschen uns morgens und abends, doch in der darauffolgenden Hitze wurde das köstliche Himmelsnass schnell faulig.
In dem bald mehrere tausend Insassen zählenden Verbannungslager befanden sich Männer der nützlichsten Berufe. Es gab Maurer, Zimmerleute, Schmiede, Schreiner, Drechsler, Steinsetzer, Klempner, Schlosser, nicht zu vergessen Mechaniker, Buchdrucker, Goldschmiede und Graveure. In Ducos befand sich eine Auswahl französischer Arbeiterintelligenz, der Idealfall für eine Kolonie. Und wir waren von fast krankhafter Sehnsucht nach Arbeit geplagt. Darum nahmen alle außer den, Kranken und Invaliden die anfangs gebotene Arbeit an: Straßen- und Wegebau, Erdarbeit an Gräben und Wällen für einen Franc je Tag. Das war etwas mehr als die Hälfte dessen, was die eingeborenen Plantagenarbeiter auf der Insel bekamen. Wir hätten auch für fünf Centimes gearbeitet, denn dieser Hundelohn war die einzige Möglichkeit, sich einige Selbstverständlichkeiten des zivilisierten Europa zu verschaffen, wie Seife, Tabak, ein Fläschchen Wein oder Rum sowie zusätzliche Nahrungsmittel. Der Wohlstand währte nur einige Monate, dann wurden vom zuständigen Marineministerium die Zahlungen für sämtliche begonnenen Arbeiten gestrichen. Das graue Elend von Neukaledonien begann, an der Verurteilung zum Nichtstun litten die Deportierten mehr als unter dem Fortfall der Entlohnung.
Ein Lichtblick in dieser Misere waren die Frauen von Ducos. Achtzehn Kommunardinnen, von Boulevardgazetten und honorigen Zeitungen als "Petroleusen" diffamiert, waren wie wir verurteilt worden zur Deportation nach einem festen Platz. Meist waren sie als Samariterinnen in Lazaretten tätig gewesen. Das betrachtete man als Angriff auf die Regierung. Viele Monate verbrachten sie im Zentralgefängnis von Auberive, und schließlich erfuhren sie, dass man sie nach einer Niederlassung freigelassener Galeerensträflinge deportieren wollte. Sie drohten, sich zu töten, sollte dieser Gerichtsbeschluss nicht geändert werden. Der energische Protest hatte Erfolg, und so landeten sie auf Ducos. Seitdem wohnen sie in einer separaten Baracke. Wenn man weiß, dass zu ihnen Frauen gehören wie Louise Michel und Natalie Lemel, dann wird man glauben, dass es bei den achtzehn Kommunardinnen vorbildlich zugeht in Bezug auf Disziplin, Lauterkeit und Zuversicht. Stets haben sie ein ermutigendes Lächeln und gute Worte bereit, ihr Beispiel beeinflusst die Stimmung im Lager positiv, Seitdem die Frauen da sind, ist meine Sehnsucht nach Manon wahrlich nicht kleiner geworden. Wie würde es sein, wäre sie hier? Stände mir die Entscheidung darüber zu, sie herzuholen, was würde ich tun? Kann man einer verwöhnten Frau wie Manon dieses Leben zumuten? Fast alle Kameraden mit Ehefrauen oder Freundinnen in der Heimat verneinen das. Kaum einer, der nicht betont, eine Frau müsse unter derartigen Umständen krank werden, früh altern, und bei solchem Dasein verdorre langsam auch die Liebe. Ich musste den Männern recht geben, meine Hochachtung vor den achtzehn Tapferen wuchs, und wenn ich an eine kränkliche, zu früh gealterte Manon dachte, schämte ich mich meines Egoismus, der sie gern hier gehabt hätte. Es gab nur die Flucht, um bald wieder mit ihr vereint zu sein. Ich musste es als Trost nehmen, dass fast alle Deportierten der Meinung waren, sie könnten ihren Frauen dieses Leben nicht zumuten. Die Thiers-Regierung war nicht der Meinung. Ständig bemüht, dem französischen Volk zu beweisen, wie die Deportierten mit Wohltaten überschüttet wurden, hatte man noch Schäbigeres ausgeheckt als die Komödie mit den Gnadengesuchen. Obwohl sie es nicht beantragt hatten, erhielt eine Anzahl Deportierter die Mitteilung, ihre Familie sei auf dem Weg zu ihnen. Bestürzt und ratlos verlangten sie von der Gefangenenverwaltung, Genaueres zu erfahren, doch die schwieg sich aus.
Nachdem die Frauen und Kinder, marode von der monatelangen Seereise, aus dem Handelsschiff "Fenelon" ausgeschifft waren, erfuhren wir des Rätsels Lösung. Die Zentralverwaltung des Marineministeriums in Paris hatte an die tausend Frauen von Deportierten vorgeladen. Ein Beamter hatte ihnen ein bezauberndes Bild von Glück und Wohlstand in Neukaledonien vorgezaubert. Natürlich würde man sie mit einem modernen Dampfschiff befördern, und gleich nach ihrer Ankunft bekämen sie Wohnung nebst einem Stück Land zugeteilt sowie ein kleines Kapital an Werkzeugen, Haustieren und Sämereien. Eine Übersiedlung sei der beste Weg, die Lage des verurteilten Gatten zu verbessern. Fünfundsiebzig Frauen erlagen den Sirenenklängen, bei den anderen hatte sich das Misstrauen nur vertieft, und sie weigerten sich, einen entsprechenden Antrag zu unterschreiben.
Die unglücklichen Frauen, die aus Sehnsucht und in bester Absicht zugestimmt hatten, wurden in Le Havre auf der "Fenelon" mit, einem Transport Prostituierter zusammengepfercht, die, um eine angedrohte Verurteilung in Frankreich abzuwenden, zugestimmt hatten, freigelassene Galeerensträflinge einer Strafkolonie zu heiraten. Den Preis für diese Ungeheuerlichkeit, ausgedacht für die Mildtätigkeitspropaganda des Ministerpräsidenten Thiers, mussten völlig schuldlose Geschöpfe bezahlen. Als die "Fenelon" auf der Reede von Nouméa Anker warf, fehlten neun Kinder. Sie waren an den Zuständen während der fünfmonatigen Schiffsreise gestorben. Die Zusage von Wohnung, Land, Werkzeugen und Haustieren wurde von den Beamten der Verwaltung als Phantasterei der Frauen abgetan. Auf eine Petition der Betroffenen an den Statthalter, einen standesstolzen adligen Gouverneur, erwiderte dieser, er habe niemandem etwas versprochen, also schulde er auch keinem etwas, nicht einmal ein Rückreisebillett, falls die enttäuschten Damen beabsichtigten, ins Heimatland zurückzukehren.
Man behandelte die Frauen auf Ducos wie Sträflinge. Gerade die fleißigsten wollten dem Elend tatkräftig begegnen, indem sie versuchten, in Nouméa irgendeine Arbeit zu finden, als Bürogehilfin, Köchin, Dienstbotin oder auf Gehöften und Plantagen rings um die Hauptstadt. Dies stand ihnen als unbestraften Bürgerinnen Frankreichs frei, es gab kein Gesetz, das es untersagt hätte. Dennoch wurde es ihnen schwer gemacht. Für jeden Besuch Nouméas wurde eine schriftliche Eingabe verlangt, auf die hin dann ein Passierschein bewilligt - oder auch abgelehnt wurde. Ohne einen solchen Schein setzte niemand die Frauen über, weder die Kaufleute und Händler, die mit ihren Booten Ducos versorgten, noch die Matrosen der Wachboote und Marineschaluppen. Wie aber sollten die Frauen eine Arbeitsstelle bekommen, wenn ihr tägliches Erscheinen derart in Frage gestellt war.
Welch ein Glück, dass Manon keine verehelichte Grousset ist, ging es mir des Öfteren durch den Sinn. Ganz sicher hätte sie, wie die meisten vorgeladenen Ehefrauen den Schwindel durchschaut, dennoch bin ich mir nicht sicher, ob ihre Sehnsucht nicht größer als jeder Vorbehalt gewesen wäre und sie sich den fünfundsiebzig Frauen angeschlossen hätte.