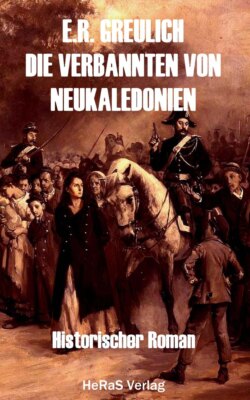Читать книгу Die Verbannten von Neukaledonien - E.R. Greulich - Страница 7
VIERTES KAPITEL
ОглавлениеTausend gegen zwei
Bootsmann Gaston Brissac hatte sich mit dem Boot schnell vom Kai entfernt, doch je näher er der "Plymouth" kam, desto langsamer wriggte er. Weniger wütend als sorgenvoll, dachte er, was mache ich mit Kenton? Käpt'n Darnbridge wird den Stänker drei Tage bei Wasser und Brot einsperren, und Kentons Rachsucht macht mir das Leben schwer.
Kenton gab Lebenszeichen von sich. Er richtete sich auf und schüttelte den Kopf, als hätte er Wasser in den Ohren. Brissac kam eine Idee. "Der Käpt'n wird wissen wollen, weshalb ich dich mit gebundenen Händen an Bord bringe."
"Du wirst ihm den ganzen Schiet erzählen, und ich gehe in den Bunker." Kenton spielte den Fatalisten. "Macht nichts, der Smutje wird mich hinterher schon herausfuttern. Ein paar Tage ausruhen ist auch was wert."
"Ja", bestätigte Brissac, "aber im Arrestbunker ist es heiß und stickig, die Hölle."
"Hölle hin, Hölle her. Dort habe ich Zeit zu überlegen, was ich mit dir mache, wenn wir uns allein begegnen."
Brissacs Stimme klang versöhnlich. "Wenn du nicht so verbohrt wärst, könnten wir uns Ärger ersparen."
Kenton witterte einen Vorteil. "Nämlich?"
Der Bootsmann hielt das Ruder still, leicht schaukelte die Schaluppe auf den Wellen. Brissac räusperte sich. "Wenn du versprichst, nicht mehr gegen mich zu stänkern, könnte ich vergessen, wozu du dich hast hinreißen lassen. Von mir würde der Käpt'n nichts erfahren, und natürlich müsstest auch du das Maul halten."
Vor Kurzem handfest belehrt, dass es nicht immer ratsam ist, seinen Hass deutlich kundzutun, ließ sich Kenton Zeit zum Überlegen. Schließlich fragte er: "Welche Garantie hab ich, dass du Wort hältst?" "Wenn du schwörst, nehme ich dir die Fessel ab", schlug Brissac vor.
Kenton bequemte sich zu einem brummigen "All right!" und sagte, während Brissac ihm die Handgelenke befreite: "Ich schwöre."
An Bord wurden die beiden vom Zweiten Offizier Simsdale in Empfang genommen, der anordnete, Kenton solle noch einmal zum Kai rudern und den Ersten Offizier Guillol abholen. In Kenton begann es zu brodeln: Gern hätte er dem schweigsamen Simsdale mit dem gutmütigen Schafsgesicht Schmähworte an den Kopf geworfen, doch er wusste, es war ein Befehl des Kapitäns.
Brissac beschaffte ein Ersatzruder, und Kenton zeigte sich ehrlich überrascht. "Hätte nicht gedacht, dass du so kameradschaftlich sein kannst."
Erstaunt über das Lob, erwiderte Brissac: "Auf See braucht einer den andern."
Schweigend legte Kenton wieder ab. Ein Satz ohne jeden Hohn, ohne jeden Vorwurf. Es stieß ihm auf wie nach einer verdorbenen Sauce. Er war in den Londoner Elendsquartieren von Whitechapel aufgewachsen, und nur weil er früh genug gelernt hatte, um sich zu schlagen, war er am Leben geblieben. Mit wildem Instinkt hasste Kenton die generösen Gentlemen, die mildtätigen Ladies. Er hatte eine uneingestandene Sehnsucht, selbst generös zu sein, und wusste, wie unmöglich das für einen seiner Herkunft war. Er hasste alle, die über ihm standen, denn die wollten nur treten, entweder auf smarte oder auf brutale Art. Auf die smarte Tour versuchte es der Bootsmann. Kenton fluchte vor sich hin. Ich brauche deine Episteln nicht, wenn ein Kahn kentert, ist die Moral ohnehin im Eimer. Ich will nichts geschenkt von diesem Jesus mit der Brigantenfresse, ich werde es ihm heimzahlen. Ein Gedanke machte ihn heiß. Das Stinktier Guillol steht doch auf Kriegsfuß mit dem Alten, und den Brissac hat er auch gefressen. Wenn ich dem Ersten die Geschichte aufs Butterbrot schmiere, beißt der bestimmt an. Der setzt sonst was in Bewegung, dass die beiden Coyoten geschnappt werden, denn damit haut er den Alten und auch den Bootsmann in die Pfanne.
Kenton verlangsamte sein Tempo beim plötzlichen Bedenken. Zu schade, Guillol ist auch ein Scheißfranzose, eigentlich kann man ihm den Spaß nicht gönnen - ach Schiet, ist eigentlich schön, wenn eine Krähe der andern doch ein Auge aushackt, wenn ein Franzose gleich zwei Landsleute an den Galgen bringt.
In Hochstimmung versetzt durch die eigene Pfiffigkeit, legte sich Kenton wieder ins Zeug. Nachdem er das Boot an der Kaitreppe vertäut hatte, wartete er ungeduldig. Was werden die beiden Strolche getan haben? Wahrscheinlich sind sie sofort hinausmarschiert aus Nouméa. Nach Nordwesten oder Südosten? Berittene Polizei wird sie auf jeden Fall einholen. Und wenn sie sich im Urwald verbergen? Der Gedanke machte Kenton unruhig, und er fluchte, dass Guillol sich so viel Zeit ließ, noch könnte man die beiden in oder bei Nouméa einfangen.
Als der Erste endlich auftauchte, wirkte er weniger streng als sonst, wahrscheinlich hatte er einige Gläser Champagner gekippt, und überhaupt schien er bei diesem Landgang auf seine Kosten gekommen zu sein. Beinahe jovial fragte er: "Nun, Kenton, wie bekommt Ihnen der Extradienst, den ihnen der Kapitän zudiktiert hat?"
"Glänzend, Sir", Kenton tat, als sei er bester Laune. "Es ist schon der zweite Törn. Beim Ersten habe ich ein Ding erlebt, das Sie mir bestimmt nicht glauben werden."
"Reden Sie schon", sagte Guillol reserviert.
Haarklein berichtete Kenton, was sich mit den angeblichen Schiffbrüchigen zugetragen hatte.
Guillol tat gelassen, doch die Indizien dünkten ihn eindeutig. Er kannte die Abneigung des Kapitäns gegen die Thiers-Regierung. Anstatt die beiden Verbrecher der Polizei zu übergeben, half ihnen der Alte bei der Flucht. Es passte zu Darnbridge. Auch, dass er seinem Protektionskind Brissac die Angelegenheit anvertraut hatte. Und wenn der Bootsmann seinen Widersacher Kenton so billig davonkommen ließ, dann nur, damit alles fein begraben blieb. Jetzt musste gehandelt werden. "Kehren Sie um", befahl Guillol.
Kenton folgte der Anweisung nur zu gern.
Auf der Kaitreppe sagte Guillol: "Bestellen Sie Mister Simsdale, ich hätte bei Konsul Barroche etwas vergessen, er soll in zwei Stunden wieder ein Boot schicken." Er machte eine unmissverständliche Geste. "Zu wem auch immer, Kenton, kein Sterbenswort von dem, was Sie mir mitgeteilt haben. - Kapiert?"
„Yes, Sir!" Kenton legte ab. Muss der Lackaffe mir nicht erst klarmachen, räsonierte er, würden sie auf der "Plymouth" erfahren, welchen Gefallen ich ihm getan habe, ich kriegte es außer mit Darnbridge und Brissac auch mit allen andern zu tun. Bei diesem Gedanken wich seine Hochstimmung beklommener Nachdenklichkeit. Dein kluges Köpfchen hat den hochnäsigen Guillol fein in Trab gesetzt, was aber, wenn es schiefgeht? Kenton legte die Ruder ein und wischte sich Schweiß von der Stirn. Fangen sie die beiden nicht, werde ich es büßen müssen. Der Erste wird durchblicken lassen, wer ihm die Geschichte aufgetischt hat. Dann habe ich keine gute Zeit mehr auf der "Plymouth".
Guillol schlug den Weg zum Haus des Konsuls ein in der Hoffnung, dort könnte noch jemand wach sein. Zwar hatte er auf der erlesenen Gesellschaft heute Abend den ersten Mann Neukaledoniens, Albert de Cavalleux, kennengelernt, aber er wagte nicht, ihn nachts in seiner Residenz aufzusuchen. Der General war Statthalter und Kommandierender der französischen Streitmacht auf Neukaledonien in einer Person. Guillol schmeichelte noch nachträglich der ausgezeichnete Eindruck, den er offenbar auf de Cavalleux gemacht hatte. Ein nützlicher, wenn auch leicht errungener Erfolg, denn sie waren ja gleicher Gesinnung. De Cavalleux, überzeugter Royalist, fand die Thiers-Regierung noch zu schlapp, er war im Jahr einundsiebzig um seine Ablösung eingekommen. Thiers hatte ihm dann einen Orden verliehen mit der Bitte, in Neukaledonien auszuharren. Bald würde sich Ducos mit gefangenen Kommunarden füllen, und da bedürfe es eines besonders ergebenen und umsichtigen Mannes, der im Notfall hart durchzugreifen sich nicht scheuen würde. Das hatte dem General eingeleuchtet, wie Guillol dem Gespräch entnahm, und de Cavalleux's Kummer bestand im Augenblick darin, dass diese Anbeter des Aufruhrs noch keinen Aufstand auf Ducos ausgeheckt, ihm bisher keinen Anlass geboten hatten, mit eisernem Besen dazwischenzufahren.
Stets um Selbstkontrolle bemüht, wehrte sich Aristide Guillol gegen seine euphorische Stimmung. Der Gedanke, irgendwer könne, ihn für einen Drückeberger halten, bereitete ihm Unbehagen. Das Dokument war ihm heilig, das besagte, er sei auf eigenen Wunsch als Offizier der französischen Marine in Ehren entlassen worden. Für fünf Jahre hatte er auf der "Plymouth" angeheuert, es war die beste Gelegenheit gewesen, der Misere zu entfliehen, die begonnen hatte, als er Annabelle Majeure kennenlernte. Sie war die einzige Tochter des reichsten Fischers von Saint-Nazaire jenem Hafenstädtchen, welches zehn Kilometer entfernt von der Marineschule des Kriegshafens Toulon liegt, in der Guillols Laufbahn begann. Vater Majeure besaß ein halbes Dutzend Fischkutter. Der früh Verwitwete las Annabelle jeden Wunsch von den Augen ab, doch in einem war er unnachgiebig: Der Künftige seiner einzigen Tochter müsse Seemann sein, damit er ihm dereinst das Steuerruder aus den alt gewordenen Händen nehmen könne. Guillol hatte es früh genug von Annabelle erfahren, sonst hätte ihn das Mädchen nach der ersten Nacht nie wieder gesehen. Die Aussicht, bald reich und Kommandeur einer kleinen Fangflottille zu sein, bewog ihn, sich mit Annabelle zu verloben. Es war nicht leicht gewesen, einen ehrenhaften Abschied zu bekommen. Staat und Kirche hatten einen gewissen finanziellen Anteil an der bisherigen Karriere des strebsamen jungen Mannes, und wer verliert gern einen ergebenen Paladin? Guillols Eltern - der Vater Flickschuster in Toulon - waren arm wie die Kirchenmäuse. Als sie in seinem sechsten Lebensjahr kurz nacheinander das Zeitliche segneten, wurde er von wohlhabenden Verwandten aufgenommen, die ihm eine solide Schulbildung angedeihen ließen. Sie waren einverstanden, als er bat, nach dem Gymnasium die Marineschule besuchen zu dürfen, es schien ihm die sicherste Art, voranzukommen. Da Guillol die meisten Klassen mit Auszeichnung absolvierte, hatte es neben der kärglichen Verwandtenunterstützung auch bescheidene Zuschüsse von Seiten des Domvikars, der ehrwürdigen Kirche Saint-Francis-de-Paule in Toulon gegeben. Der gütige Monsieur Vikar hatte nicht nur die Aufnahme Guillols in die Marineschule unterstützt, sondern auch dafür gesorgt, dass er dort, als Stipendiat auf eigene Füße gestellt, seinen Verwandten nicht mehr zur Last fiel. Das war einerseits befreiend, andererseits unbequem. Erst mit fünfundzwanzig Jahren, als er sich die Epauletten eines Leutnants mit der entsprechenden Löhnung erdient hatte, konnte er sich erlauben, ab und zu seriöse Restaurants aufzusuchen, Umschau unter den Töchtern des Landes, zu halten. Da nun war ihm Annabelle über den Weg gelaufen. Sie war verwöhnt, selbstbewusst und trotzdem vom ersten Augenblick an verliebt in den schneidigen Marineoffizier. Drei Jahre waren sie verlobt gewesen. Guillol stand nun im Rang eines Oberleutnants, der Brautvater drängte auf Heirat. Es war eine harte Entscheidung. Guillol fühlte sich als Patriot und treuer Anhänger des dritten Napoleon. Für sein persönliches Fortkommen aber musste man leider selbst sorgen, denn das Vaterland ließ sich damit viel Zeit. Die Aussicht, im Greisenalter vielleicht einmal Admiralsschnüre zu tragen, empfand der ehrgeizige junge Offizier als die Taube auf dem Dach, Annabelle mit ihren Erbaussichten als den Spatz in der Hand. So quittierte er den Dienst, reichte das Aufgebot ein, und Saint-Nazaire bereitete sich auf eine glanzvolle Hochzeit vor. Ein Orkan brachte verheerendes Unglück über die malerische Stadt. Zu den auf See Umgekommenen gehörte auch der alte Majeure mitsamt den Besatzungen seiner sechs Fischkutter. Als sei das für ihn ein Signal gewesen, verschwand der Prokurist Majeures mit dem Barvermögen der alteingesessenen Fang- und Handelsfirma. Über Nacht wurde Annabelle zum armen Mädchen. Wohl gab es da noch Immobilienbesitz, doch der war hypothekenbelastet und warf wenig ab. Guillol besann sich rechtzeitig auf seinen Wahlspruch: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Er musterte auf der "Plymouth" an. Die sieben Meere waren das beste Versteck vor einem Mädchen, das energisch auf Heirat bestand.
Guillol hatte auf ein falsches Pferd gesetzt, und es galt, die Fäden neu zu knüpfen. Sein Ziel war eine Stellung im gehobenen Dienst des Marineministeriums. Die Seefahrt selbst war ihm verleidet, seine Untergebenen mussten es büßen, wobei Guillols Intelligenz ihn davor schützte, Formfehler zu begehen. Noch nie hatte er einen Mann auch nur angerührt, dennoch hassten die Schiffsleute seinen Zynismus, fürchteten seine Strenge.
Erwartungsvoll bog er in die langgestreckte Straße ein, an deren Ende das Haus des Konsuls lag. Reicher, armer Bartoche, spöttelte Guillol in Gedanken, solltest du schon schlafen, muss ich dich aus dem Bett holen.
Sie hatten sich zufällig auf dem Hafenamt getroffen, anfangs Floskeln über das Wetter und die Zeitläufte gewechselt und jeder vom anderen das Gefühl gehabt, er könnte ihm irgendwann einmal nützlich sein. Cecil Bartoche hatte das Gespräch bald auf das Fest zum vierzigsten Geburtstag seiner Gattin Mabel gelenkt, zu dem die Spitzen der Gesellschaft von Nouméa eingeladen seien. Er würde sich freuen, auch Guillol als Gast begrüßen zu dürfen.
Bartoche hatte nicht übertrieben. Sogar der Herr Gouverneur nebst Familie hoffte, auf dem Ballabend des reichen Landsmanns und australischen Wahlkonsuls die Provinzlangeweile totzuschlagen. Das Erscheinen des unbekannten Seeoffiziers Guillol in jener erlauchten Gesellschaft war eine kleine Sensation gewesen. Der General hatte ihn, kaum dass Guillol allen Gästen vorgestellt worden war, mit Beschlag belegt. Es konnte ihm nur recht sein, de Cavalleux war eine wertvolle Bekanntschaft für jemanden, der hochfliegende Pläne hegte. Weniger recht war es der Tochter des Gouverneurs, Daphne. Als die ersten Takte Tanzmusik erklangen, trat sie zu den beiden Plaudernden und machte den Herrn Papa liebenswürdig darauf aufmerksam, dass auch er zumindest zwei Tänze zu absolvieren habe, einen mit der Dame des Hauses, einen mit seiner Gattin. Eine unausgesprochene Aufforderung auch an Guillol, geistesgegenwärtig bat er Daphne um den ersten Tanz. Es war nicht der Letzte, sie verstand geschickt, es so einzurichten, dass Guillol nur mit Mühe zu den Anstandstänzen mit den andern Damen kam. Konkurrentin Daphnes war deren Mutter, Adrienne, die aussah wie die reifere Schwester der impulsiven Gouverneurstochter. Sie sprach viel über Daphne, von deren menschlichen Vorzügen, ihren, Handfertigkeiten und Fähigkeiten, und über das, was sie bei einer Heirat vom Elternhaus mitbekäme. Scherzhaft flocht die kluge Mama ein, dass ihr natürlich ein sympathischer Eidam lieber wäre als ein unsympathischer, und der umschwärmte Seeoffizier geriet ins Schwitzen, wörtlich wie bildlich. De Cavalleux mochte ein nützlicher Leuchtturm sein, dessen Licht ihm womöglich irgendwann den Weg ins Marineministerium weisen würde, doch in den beiden Damen brannte ein Feuer, an dem man sich die Finger verbrennen konnte. Daphne versuchte später, Guillol zu einem Rendezvous zu provozieren. Er redete sich heraus, er werde ihr Botschaft zukommen lassen, sowie er wieder Landgang bekomme. Anfangs hatte sich Guillol über so viel Damengunst gewundert, angesichts einiger lediger Offiziere aus dem Stab des Generals, die als Heiratskandidaten bestimmt mehr zu bieten hatten. Bemerkungen, die ihm andere Damen beim Tanz zuflüsterten, klärten dann das Rätsel. In diesem Krähwinkel Nouméa fühlten sich die temperamentvolleren Damen um den Hauptreiz ihres Lebens gebracht: das Dasein in Glanz und Bewunderung, in der abwechslungsreichen Metropole Paris. Auch Daphne konnte nichts Besseres passieren, als von dieser tristen Insel weggeheiratet zu werden, und Guillol vermutete, das Rendezvous sei als Falle gedacht. Sollte der Herr Papa sie beide 'zufällig' zusammen treffen, dann bliebe kaum anderes, als sich zu erklären. War es nicht äußerst verlockend: Einheirat in die Königsfamilie? Obendrein war die Königstochter hübsch und nicht hässlich wie im Märchen. Daphne besaß Klugheit, Bildung und eine passable Mitgift. Guillol hatte es bedacht und nochmals bedacht, und auch jetzt überlegte er. Das Leben war eine Mathematikaufgabe mit zu vielen Unbekannten, sein Pech mit Annabelle hatte es ihn gelehrt. Die de Cavalleux werden hier in Neukaledonien versauern. Sie wollen es nicht wahrhaben, doch sie wissen es. Aber meine Ziele sind nur in Paris zu verwirklichen, wusste Guillol, und nie würde der Papa die Tochter mit ihrem Gatten in das Sündenbabel gehen lassen, das man dem General mit einem Orden versiegelt hatte. De Cavalleux war sich klar darüber, dass dann die Gattin öfter bei der Tochter weilen würde als bei ihm im trostlosen Nouméa. Fast alle diese Leute waren tropenmüde, und jeder versuchte dem Dilemma auf seine Weise zu entrinnen. Auch Albert de Cavalleux' Antrag auf Ablösung war das kaschierte Bemühen gewesen, sich an ein besseres Ufer zu retten. Die Flucht der beiden Deportierten dürfte das gefundene Fressen für ihn sein. Jetzt kann er den aufgespeicherten Tatendurst stillen. Agil und unternehmungslustig macht er keine Ausnahme von allen pensionierten und abgeschobenen hohen Militärs, die stets meinen, dass sie die verlorenen Schlachten der anderen gewonnen hätten. Er ist fest überzeugt, wäre er im Mutterland gewesen und hätte auch nur ein Armeekorps zu befehligen gehabt, der Krieg mit Preußen-Deutschland hätte einen anderen Ausgang genommen.
Als Guillol sich dem Hause der Bartoches näherte, sah er, dass die kleinen Fenster hinter den Ziergittern im Erdgeschoß noch erleuchtet waren. Wahrscheinlich verkonsumierten die Domestiken jetzt die Reste des Festmahls. Wenn der Herr schläft, dachte Guillol, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Er zog den bronzenen Klingelgriff unter dem maurisch-spanischen Torbogen. Ein Bediensteter öffnete, führte ihn in die Halle, deren Interieur an die Häuser des spanischen Adels erinnerte, und bat ihn, in einem mit Schaffell bespannten Sessel Platz zu nehmen.
Im Gegensatz zum Abend hatte Guillol jetzt Muße, sich umzuschauen. Zwar wirkte die Halle beinahe spartanisch, trotzdem roch es, hier nach Reichtum. Insgeheim rümpfte Guillol die Nase über den wendigen Bartoche, einen Pragmatiker, der stets wusste, wie er den Mantel hängen musste. Das Beste an ihm war seine Gattin Mabel, blond, schlank, intelligent, einst eine umschwärmte Dame der australischen High-Society. Wie Guillol erfahren hatte, war ihr Vater Besitzer von mehreren Fleischfabriken und Tausenden von Rindern.
Als Bartoche erschien, begrüßte er den späten Gast mit erstaunt-besorgtem Gesicht und bat ihn in sein Arbeitszimmer. Nachdem Guillol berichtet hatte, entschied der Konsul: "Wir gehen beide zum General." Er werde sich sofort ankleiden und bitte um wenige Minuten Geduld.
Guillol hatte mit Wenn und Aber gerechnet, mit einerseits und andererseits. Aus welchen Beweggründen auch immer, Bartoche hatte eben bewiesen, dass er Gespür besaß.
Auf dem Weg zur Residenz des Gouverneurs zerstreute er Guillols Bedenken, de Cavalleux könne ungehalten sein. "Sie werden Gelegenheit haben, seine Reaktionsfähigkeit zu bewundern. Obwohl er an der Spitze steht, ist er von allen Offizieren hier der fähigste."
Das dunkel daliegende Gebäude wirkte keinesfalls einladend. Unbekümmert setzte Bartoche den vergoldeten Türklopfer in Bewegung, bis ein gähnendes Faktotum öffnete und den beiden Männern mit einer Öllaterne ins Gesicht leuchtete. Der Verschlafene wurde überaus diensteifrig, als er den Konsul erkannte.
"Wecken Sie den General", herrschte ihn Bartoche an. "Sagen Sie ihm, zwei Kommunarden sind von Ducos geflohen. Monsieur Guillol und ich wollen ihm Einzelheiten mitteilen."
In erstaunlich kurzer Zeit kam der Mann mit der Laterne zurück und geleitete sie in ein Kabinett, das trotz seiner Möbel im Louis-quatorze-Stil einen wohnlichen Eindruck machte.
Kurz nach den beiden Männern trat de Cavalleux in das Gemach, wobei er die letzten Knöpfe seiner seidenen Hausjacke zuknöpfte. Er begrüßte Bartoche und Guillol ohne ein Anzeichen von Unmut und bat, Platz zu nehmen. Aus einer Vitrine nahm er Gläser sowie eine Karaffe mit erlesenem Jerezlikör, goss daraus ein und bat mit kaum verhohlener Ungeduld zu berichten.
Schweigend hörte er Guillol zu, während er sich das Knebelbärtchen strich. Er mochte sechzig Jahre zählen, seine agile Art ließ ihn jünger erscheinen. Während sich Guillol um klare, knappe Formulierungen bemühte, huschte ihm durch den Kopf, dass des Generals Haupt- und Barthaar zu schwarz war, um echt zu sein, er will nicht alt aussehen. Auch in zehn Jahren dürfte er noch nicht jene knöcherne, stocksteife Unnahbarkeit erworben haben, hinter der pensionierte Generale gern ihre Senilität verbergen.
Guillol hatte geendet, der Gouverneur sprang auf, ging mit elastischen Schritten hin und her. "Auch mir scheinen die Indizien eindeutig. Binnen kurzem werden wir wissen, ob unsere Vermutungen zutreffen. - Entschuldigen Sie mich einen Augenblick." Er verschwand, Guillol und der Konsul hörten ihn im Parterre Anweisungen erteilen.
Er kam zurück, goss aufgeräumt noch einmal ein und hob das Glas. "Trinken wir auf eine frisch-fröhliche Jagd, meine Herren. Von jetzt an läuft alles präzise wie ein Uhrwerk. Meine Leute können endlich ihre eingerosteten Knochen in Trab bringen. Wie es auch ausgehen mag, Ihnen gebührt Dank, Guillol. Sie haben gehandelt wie ein Offizier bester alter Schule. Ich werde es Ihnen nicht vergessen."
Sie tranken die Gläser leer, und de Cavalleux verabschiedete die späten Besucher mit der Versicherung, sie hätten das Ihrige vollauf getan, nun beginne das Seine.
Es war alles schneller gegangen, als Guillol kalkuliert hatte. Bartoche begleitete ihn zum Hafen, das Boot von der "Plymouth" war noch nicht zu sehen. Gemächlich spazierten sie am Kai auf und ab. Kein Lufthauch wehte, in der Stille der Morgendämmerung wirkten die Masten, Krane und Davits, als seien sie beim Einschlafen des Abendwinds für immer erstarrt.
"Jetzt fehlt uns nur noch Eins zum Glück", spöttelte Guillol, "dass man die Strolche recht schnell fängt."
"Die kommen nicht weit." Der Konsul sagte es fest überzeugt, er musste Optimismus nicht vortäuschen. "Ob de Cavalleux dem Deutsch-Französischen Krieg eine andere Wendung hätte geben können, würde ich nicht beschwören, aber die beiden Ausbrecher bringt er todsicher zur Strecke. Deren Schicksal war besiegelt, als Sie, Monsieur Guillol, den Verdacht schöpften."
Die Zuversicht Bartoches stimmte Guillol froh. In einem kurzen Augenblick des Überschwangs, den er gleich darauf gern zurückgenommen hätte, gestand er: "Ich würde gern in Paris festen Fuß fassen, eine Empfehlung von General de Cavalleux könnte mir dabei sehr helfen."
Bartoche, weder Royalist noch Parteigänger Thiers, hielt es für klug, beizupflichten. Es war ihm zur zweiten Natur geworden, sich mit den jeweils an der Macht Befindlichen zu arrangieren. Guillol zählte er zum Typ der kommenden Männer. Er hatte miterlebt, wie geschickt der dem Gouverneur um den Bart gegangen war, wusste, welchen Stein im Brett er jetzt bei de Cavalleux hatte. Deshalb versicherte er Guillol seiner Wertschätzung, er könne sich jederzeit an ihn wenden, falls er ihn brauche.
Das Boot tauchte aus dem Dunst auf, der über dem Hafenwasser waberte. Die Herren verabschiedeten sich, Guillol sprang in die Schaluppe, die kurz darauf hinter grauen Schwaden verschwunden war.
Leise pfeifend wandte sich Bartoche der Stadt zu, am liebsten hätte er sich die Hände gerieben. Mabel hatte Zweifel gehabt, ob es richtig gewesen war, diesen unbekannten kleinen Schiffsoffizier einzuladen, und auch der befriedigende Ausgang des Festes hatte ihre skeptische Einstellung gegen Guillol nicht ganz beseitigt. Jetzt würde die Teure Augen machen, wenn er vom Ruhmesglanz Guillols berichtete und vom Teil, besagten Glanzes, der auch auf ihn fallen und das Verhältnis zu den de Cavalleux beträchtlich verbessern würde.
Um sechs Uhr, wie befohlen, fanden, sich ein halbes Dutzend höherer Offiziere im Regierungspalast ein, dem schneeweißen, nicht einmal geschmacklosen Bau, vom Volksmund Pantheon genannt, weil jene, die hier bisher residierten, auch nicht mehr getan hatten, als die berühmten Toten des Pantheons in Paris nach ihrer Beisetzung hatten tun können.
Kopfschüttelnd, ungnädig warteten die Träger glanzvoller Uniformen im Audienzzimmer. Was bedeutete die Alarmierung zu nachtschlafender Zeit, wenn sie nur hier herumstanden und warten mussten? Endlich erschien der General und überzeugte sich mit einem Blick, dass sein Stab vollzählig beisammen war. Er befand sich in schneidigster Laune und in seinem "Kampfanzug", Schärpe und Degen fehlten, der oberste Knopf am Kragenspiegel war nicht geschlossen. Nach knappem Gruß führte er die Herren in den pavillonartigen Anbau, in den von drei Seiten Licht einfiel und in dessen Mitte ein riesiger Sandkastentisch stand, Diagonal durch den Sandkasten erstreckte sich das Relief der Insel Neukaledonien, die in ihrer länglichen Form an ein scharf gebackenes französisches Weißbrot denken ließ. Der General stellte sich an die Stirnseite des Tisches und räusperte sich kurz. "Meine Herren! Heute Nacht bekam ich die Nachricht, dass zwei Häftlinge von Ducos geflüchtet sind. Auf meine Recherchen musste mir der Kommandant des Lagers gestehen, dass es sich um zwei besonders gefährliche Leute handelt, die zum vertrauten Kreis von Louise Michel gehören. Es sind dies der ehemalige Marineoffizier Roger Kervizic und der Journalist Paschal Grousset, fanatische Kommuneanhänger, die von Glück sagen können, dass sie General Galliffet nicht in die Hände gefallen sind." De Cavalleux machte eine Pause, um seinen Witz vorzubereiten. "Allerdings hätten wir dann, jetzt nicht das Vergnügen, die gerupften Vögel einzufangen."
Pflichtschuldigst lachten die um den Sandkasten Versammelten, der General zwirbelte gutgelaunt die Enden seines Bärtchens, dann fuhr er fort: "Wir sollten weder die füchsische List noch die persönliche Einsatzbereitschaft der Entwichenen unterschätzen. Kervizic ist ein hochbegabter, draufgängerischer Halunke, als Seemann besonders prädestiniert für halsbrecherische Unternehmen. Ihm würde ich auch zutrauen, dass er sich mit einem Floß aufs offene Meer treiben lässt in der Hoffnung, von einem vorüberkommenden, Schiff aufgenommen zu werden. Der berühmte günstige Wind hat uns zugetragen, dass die beiden eine andere Fluchtart gewählt haben, vom Hafenkai aus haben sie den Weg durch Nouméa genommen." Mit seinen federnden, geschmeidigen Schritten ging der General in eine Ecke, nahm dort ein feingearbeitetes Billardqueue in die Hand und trat mit diesem Zeigestock wieder an den Sandkasten. "Jetzt beginnt unsere Arbeit, meine Herren, Sie kennen die Binsenweisheit zur Genüge, eine Schlacht wird durch akkurate Planung gewonnen.“ Er wandte sich an den dienstjüngsten Offizier; "Oberleutnant Barchaise, was würden Sie unternehmen, die Ausbrecher in kürzester Zeit einzufangen?"
Wie aus der- Pistole geschossen kam die Antwort: "Ich würde einen Zug Dragoner auf der Waldchaussee nach Quen in Trab setzen.“
"Begründung?"
Der Oberleutnant trat an das Relief, de Cavalleux gab ihm den Zeigestock. Barchaise legte einen Augenblick den Finger an die Nase. "Politische Fanatiker flüchten nicht, um irgendwo ein Robinsonleben zu führen. Sie wollen nach Europa, um weiter zu schüren. Also brauchen sie ein Schiff. Schiffe gibt es nur in Häfen. Der nächste Hafen ist Quen. Denn sie waren nicht dumm genug, wie wir bereits hörten, es in Nouméa zu versuchen, und ...“
"Sie waren es, Oberleutnant Barchaise", unterbrach der General den jungen Offizier. "Sie sind Kapitän Darnbridge von der 'Plymouth' um Asyl angegangen. Doch der schlaue Engländer hat glücklicherweise abgewinkt, sonst hätte er uns das lehrreiche Planspiel hier verdorben."
Wieder lachten die Herren pflichtgemäß, nur der nach dem General ranghöchste Offizier, Generalmajor de Castris, sagte kühl, ohne dass der Spott in seinen Worten zu überhören war: "Also doch nicht so hochbegabt, der Halunke."
Mit leiser Schärfe fragte de Cavalleux: "Spricht es nicht für Kervizic, dass er zunächst einmal das Nächstliegende wagte? Wäre dieser Darnbridge ein Mann seiner Couleur, dann könnten wir die beiden Ausbrecher jetzt schon abschreiben. Auch der pfiffigste Hafenpolizist findet auf solch einem Segelkahn nichts, was der Kapitän nicht wünscht."
De Castris trat den Rückzug an. "Ergo: Tollkühnheit muss nicht in jedem Fall Dummheit bedeuten. Es scheint ratsam, auch jene Varianten zu durchdenken, die, oberflächlich betrachtet, nach Dummheit aussehen."
"Ausgezeichnet", pflichtete de Cavalleux bei und wandte sich wieder an Barchaise. "Da die beiden in Nouméa abgeblitzt sind, wenden sie sich dem nächstliegenden Hafen zu, sie pilgern nach Quen. - Einverstanden?"
Barchaise nickte eifrig. "Das war meine Überlegung."
"Wenn sie nun aber mit Ihren Dragonern rechnen und den Strandweg nehmen?"
Abermals ein wenig zu schnell verkündete Barchaise: "Dann sollte man den Zug teilen. Ein Trupp die Waldchaussee, der andere am Strand entlang."
Ein unterdrücktes, mitleidiges Lachen der Herren war nicht zu überhören.
"Kennen Sie den Strand, Oberleutnant?" fragte de Castris väterlich. "Da ist ein Pferd ein Hindernis, keine Hilfe."
„Ich korrigiere mich", sagte Barchaise leise und beschämt. "Außer Berittenen muss man wohl auch Fußsoldaten in Bewegung setzen.
"Weiß der Teufel, ja!" Der General sagte es wie ein Lehrer, der froh ist, endlich eine einigermaßen befriedigende Antwort aus einem Schüler herausgebracht zu haben. "Um unsern braven Barchaise nicht länger ins Schwitzen zu bringen, eine Frage an alle: Wie stehen wir da, wenn die beiden sich anstatt nach Südosten nach Nordwesten gewandt haben, um in Koumac ein Schiff zu bekommen?"
Colonel Dutombray schüttelte energisch den Kopf. "Unwahrscheinlich, höchst unwahrscheinlich." Er nahm Barchaise den Zeigestock aus der Hand und fuhr mit dessen Spitze die Strecke auf dem Relief ab. "Das sind beinahe dreihundert Kilometer. Von Nouméa nach Quen sind es dagegen nur gut fünfzig." Seine Stimme bekam einen höhnischen Klang. "Bei aller Wertschätzung für die strategischen Qualitäten des Meuterers Kervizic, er wird die Strecke zu seiner vermeintlichen Befreiung nicht um das Sechsfache verlängern, nur um einem eventuellen Schachzug von unserer Seite aus zu begegnen."
"Trotzdem!" entfuhr es dem Oberleutnant Barchaise, "unser Gespräch über Dummheit und Tollkühnheit bedenkend, sollte man Einheiten der Garnison von Paita auf Nouméa in Marsch setzen. Hat Kervizic den Weg nach Koumac gewählt, dann läuft er denen direkt in die Arme."
"Bravo, Oberleutnant!" rief de Cavalleux. '"Das habe ich als erstes veranlasst. Die Kuriere nach Paita dürften die dreißig Kilometer bereits bewältigt haben, und eben zu dieser Stunde beginnt der Großteil der Garnison von Paita, Chaussee, Wald und Strand nach Nouméa hin durchzukämmen."
In den Mienen der Offiziere stand Anerkennung für die rasche Maßnahme des Chefs.
Der General hatte den Zeigestock wieder an sich genommen. "Ich sprach von durchkämmen, meine Herren! Die Galgenvögel zu fangen hat etwas von der Suche nach der Stecknadel im Heu. Der Urwald ist der Heuhaufen. Beste Gewähr für sicheres Gelingen bieten möglichst viele Augen."
"Heißt also", Colonel Dutombray setzte den Gedankengang des Generals fort, "mit Ausnahme der unerlässlichen Wachmannschaften den letzten Mann der Garnison Nouméa für die Sache einzusetzen. Das wären, meiner oberflächlichen Schätzung nach, mit den Suchtrupps von Paita an die tausend Leute."
"Genau das!" De Cavalleux ging zu einem kleinen Tisch in der Ecke, brachte Karten und Zettel, die er an die Offiziere verteilte. „Hier sind die Aufgaben jeder Einheit präzise festgelegt. Stimmen Sie sich ab, meine Herren, ständige Tuchfühlung untereinander ist unerlässlich, Auf breiter Front, am Strand und bis einen Kilometer links der Chaussee, wird sich das Fußvolk auf Quen zu bewegen, wie die Treiberkette einer Hasenjagd. Dieser Kette kann niemand entkommen, wenn Sie sich exakt an die Koordinaten halten. Die berittenen Einheiten werden eingesetzt für die Überwachung der Chaussee, für Kurierdienste, ferner als Vorausabteilung nach Quen, um den Weg der beiden auch von vorn abzuriegeln."
Oberleutnant Barchaise, ermutigt durch die lobenden, Worte des Generals, fragte wie ein braver Schüler: "Und in Nouméa selbst? Wenn die beiden nun frech genug sind, noch in der Hauptstadt ...?"
Der General unterbrach Barchaises Frage lächelnd: "Auch daran wurde gedacht. Polizeichef Quissard bereitet bereits eine Großrazzia vor. Schon jetzt würde keine Maus mehr hinauskommen aus Nouméa." De Cavalleux ließ den Deckel seiner goldenen Repetieruhr aufspringen. "In einer Stunde, meine Herren, Appell! Zehn Minuten später befindet sich die Garnison auf dem Ausmarsch! - Ich danke Ihnen. - Guten Morgen!"
Nunmehr allein in dem hellen Raum, überlegte der General. Waren die Strolche klug genug, die nachts für sie noch ungefährliche Chaussee zu benutzen, dann haben sie jetzt einen Vorsprung von etwa zehn bis fünfzehn Kilometern. Doch das Tageslicht treibt sie in den Wald oder an den Strand. Sie brauchen Nahrung, sie müssen ihren Durst stillen. Alles das hält auf. Womöglich sammeln sie Kräfte für die Nacht und schlafen am Tage. Allerspätestens zehn Kilometer vor Quen muss die Treiberkette sie eingeholt haben.
Zufrieden mit der Stabsbesprechung und erst recht mit seiner exakten Planung, bereitete sich der General auf den Appell vor, knöpfte den obersten Uniformknopf zu, legte die Schärpe um und gürtete sich mit dem Degen.