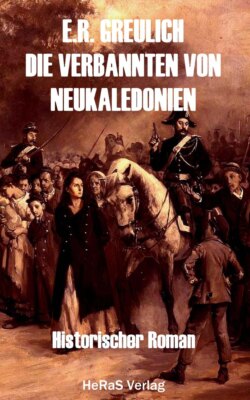Читать книгу Die Verbannten von Neukaledonien - E.R. Greulich - Страница 8
FÜNFTES KAPITEL
ОглавлениеRätsel um Manon (Erste Fortsetzung aus dem Tagebuch des Paschal Grousset)
Aus der eigenen Haut zu schlüpfen, sich unnachsichtig selbst zu betrachten sollte zumindest versuchen, wer ein Tagebuch führt. Die Nase ist zu lang, der Mund zu breit, und mein großer Adamsapfel erinnert an den des Arlecchino. Mittelgroß, dunkelhäutig, schwarzes Haar, brünetter Teint, ein Durchschnittsfranzose und kein schöner Mann. Kaum volljährig, war ich mir des Vorteils dieser Hässlichkeit bereits bewusst, da die Frauen schöne Männer zwar anhimmeln, aber sie sind von ihrer Treulosigkeit überzeugt. Ob schön oder hässlich, wichtiger ist die Macht des Wortes, besonders Frauen gegenüber. Das ist meine Erfahrung, und als geborenem Pariser machte mir das Talent des überzeugenden Redens manches zu leicht. Es war wohl auch der Grund, das Medizinstudium an der Sorbonne vorzeitig abzubrechen und mich dem Journalismus in die Arme zu werfen.
Schon früh sammelte ich Erfahrungen mit reifen Frauen und frühreifen Mädchen. Ich genoss die Liebeleien und glaubte nicht an die berühmte große Liebe. "Romeo und Julia" empfand ich als bezaubernde Dichtung, die Unbedingtheit dieser Liebe dagegen als wirklichkeitsfremde Überhöhung. Von der unsterblichen Liebe hatte ich immer nur gelesen, bei Homer und Petrarca, Dante Alighieri, dem schreibmächtigen Monsieur de Balzac und bei dem armen, begnadeten Henry, der einmalig und poetisch über Herzensmelodramen zu spotten verstand. Manche behaupten, jene Seite der Dichtkunst Heines sei zynisch, ich bestreite es, weil ich mich dann ebenfalls einen Zyniker nennen müsste. Als Medizinstudent hatte ich Zyniker sterben sehen, sie waren nicht gut gestorben. Mit diesen Zeilen wird mir klar, dass ich mich instinktiv gegen jeden Zynismus wehre. Wahrscheinlich haben das die Frauen gespürt. Ich bewunderte an ihnen all das, was ihre Weiblichkeit ausmacht, und bemühte mich, mit meinen Liebsten nicht abschätziger umzugehen als mit mir selbst, nicht einmal mit ihren Tränen, wenn es ans Adieu sagen ging. Ich versuchte es mit dem Appell an die Gerechtigkeit. Aus freien Stücken befreundeten wir uns. Wo steht geschrieben, so etwas müsse bis in alle Ewigkeit gehen? In den Augen meiner Bekannten galt ich als abgefeimter Junggeselle, und anstatt beschämt zu sein, schmeichelte es meinem Selbstbewusstsein. So war das mit mir, bis ich Manon traf.
Es ging ihm bis ins Mark, liest man oft über die Liebe auf den ersten Blick. Unsere Geschichte begann prosaischer, denn Manon stand zu weit entfernt, um meinen Blick überhaupt wahrnehmen zu können. In den Tagen am Ende des April einundsiebzig, im Frauenklub auf dem Boulevard Rochechuart, begegnete ich ihr zum ersten Mal, als dort eben über die Gleichstellung der sogenannten illegitimen mit den legitimen Frauen der Nationalgardisten debattiert wurde. Manon sprach mit Verve für die "Illegitimen", besonders für die mit Kindern, die nicht einen Sou nach dem Tod des gefallenen Vaters erhielten, und sie nannte es ein Unrecht an Fleisch und Blut derjenigen, die ihr Leben für die Kommune hingaben. Es war, als seien die Frauen jahrhundertelangem Dornröschenschlaf entrissen worden. Ich sollte etwas zu dem Thema für Vermorels "Ami du Peuple" schreiben. Die feurige Louise Michel hatte ich mehr als einmal sprechen hören, ebenso die kluge Natalie Lemel und eine Reihe anderer gescheiter Weibsbilder. Keine hatte mich so beeindruckt wie Manon. Nicht nur wegen ihrer entzückenden Figur und des ebenmäßigen Gesichts. Sie sprach mit der Technik der Schauspieler, die eine Stimme so wohlklingend und weittragend macht. Manon bot das Bild bezaubernder Weiblichkeit, die mit beiden Beinen auf der Erde steht. Das schreibt sich jetzt so hin, damals spürte ich nur mit geheimem Prickeln, wie mich ihre körperliche Anmut anzog, dagegen einiges in ihrer Rede abstieß. Ich hatte so gut es ging mitstenographiert. Manche ihrer Sätze waren druckreif. Als sie zum Schluss kam, hatte ich Mühe, mich durch die lauschende Menge in ihre Nähe zu schlängeln. Mit Grazie raffte sie ihren Rock, als sie die Stufen des Podiums herabstieg, um sich dem Ausgang zuzuwenden. Erst auf der Straße holte ich sie ein. "Sie waren wunderbar, Mademoiselle Dupriaux."
Lächelnd nahm sie das Kompliment zur Kenntnis, aber ihr Gesicht zeigte Distanziertheit. "Meinen Sie Form oder Inhalt meiner Rede?"
Ich wich aus, indem ich mich vorstellte und bemerkte, dass ich über ihren Diskussionsbeitrag im "Ami du Peuple" schreiben würde. Dann fragte ich übergangslos: "Weshalb sieht man eine so überzeugende Schauspielerin auf keiner Pariser Bühne?"
Sie blieb einen Augenblick stehen und sah mich nachsichtig an. "Die eigenständige Auffassung einer Schauspielerin von Dichtern und ihren Stücken ist in den Augen vieler Theaterleute Hochverrat. Ist Büchners 'Woyzeck' denn nur das blutige Schauerdrama eines Verlorenen oder nicht auch dramatische Anklage gegen eine Gesellschaft, die so etwas gebiert?"
Sie sah mich fordernd an, ihre grauen Augen waren jetzt von blitzendem Blau. Von der mäßigen Übersetzung des "Woyzeck" hatte ich kaum mehr im Gedächtnis als den Mord an der Geliebten durch den armen Halbkretin. Deshalb sagte ich, wobei ich sie treuherzig anlächelte: „Ich glaub schon, dass es schwierig ist, mit Ihnen zu arbeiten."
Enttäuschung huschte über ihr Gesicht, dennoch erklärte sie tapfer: "Ich weiß, dass ich unbequem bin."
Diese Offenheit einem Fremden gegenüber war staunenswert, Nicht nur, um ihr etwas Gutes zu sagen, erklärte ich ehrlichen Herzens: "Wäre ich Spielleiter, ich würde mir die Bürde aufladen und mich mit Ihnen zusammenstreiten, fest überzeugt, am Tage nach der Uraufführung spräche Paris von einer großartigen Schauspielerin."
Sie sah mich zweifelnd an, ob dies wohlfeile Schmeichelei oder meine wahre Überzeugung sei, wurde sich nicht schlüssig und scherzte: „Hat sich erst ganz Frankreich der Kommune angeschlossen, dann beginnt das menschliche Jahrhundert, also auch das Jahrhundert menschlicher Kunst. Dann nehme ich Sie beim Wort."
"Ich bin kein Spielleiter, Mademoiselle."
"Ein Mann der Zeitung ist mehr. Sie können Intendanten mit der Frage provozieren, warum sie es mit der Dupriaux nicht einmal versuchen."
"Ausgezeichneter Plan", pflichtete ich bei, "falls ein Wunder geschieht und Frankreich sich seiner Hauptstadt anschließt."
Ihre Augen konnten nicht nur blitzen, jetzt blickten sie verschleiert in geheimer Sorge. Wie ich wusste sie aus den Zeitungen, dass die Versuche, in Marseille, Lyon, Toulouse, Saint-Etienne und einigen anderen Städten Kommunen zu errichten, in den meisten Fällen schon wieder gescheitert waren. Sie wusste wie ich, dass Paris verzweifelte Anstrengungen machte, die Unterstützung des ganzen Landes zu erhalten, dass man zu diesem Zweck sogar Emissäre vermittels Montgolfieren aus Paris ausfliegen ließ. Das Schicksal unserer Kommune war so unsicher wie das dieser Heißluftballons und der Gondelinsassen, die zufrieden sein mussten, wenn sie heil über den Belagerungsring der Versailler hinwegkamen. Aber Manon gehörte zu jenen Menschen, die bei aller Gescheitheit eine immense Kraft des Glaubens einzusetzen haben. Eine wunderbare Charaktereigenschaft, doch für den praktischen Tag hinderlich. Trotzdem fand ich es rührend und liebenswert, wie sie in ihrem Schwanken zwischen Hoffen wollen und Wissen sollen angstvoll fragte: "Sie glauben nicht daran?"
"Mir scheint es eine noch größere Illusion als jene, die Sie von der Gleichstellung der Illegitimen mit den Legitimen hegen", antwortete ich.
"Ah, schau an, wieder ein Monsieur mit schlechtem Gewissen.“
Sie hatte es zwar scherzend gesagt, aber unter ihrem forschenden Blick war mir nicht sehr wohl in meiner Haut, und ich antwortete ausweichend: "Moralisch gebe ich Ihnen recht, doch was ist Moral ohne materiellen Rückhalt? Woher soll die Kommune das Geld für die illegitimen Witwen und Waisen nehmen?"
Manon überlegte nicht lange. "Fragte man zuerst die Buchhalter, ist das moralisch Richtige schon abgesetzt von der Tagesordnung. Doch macht man es zum Gesetz, dann kümmern sich die Buchhalter auch um den materiellen Rückhalt."
Das war nicht nur praktisch gedacht, sondern auch glückliche Prophetie. Denn schon wenige Tage später, am 28. April, veröffentlichte das Zentralkomitee der Kommune jenes Dekret "Über die Aufhebung des Unterschieds zwischen den sogenannten illegitimen Frauen und Müttern und Witwen von Nationalgardisten hinsichtlich der Entschädigung." Es zeigte, wie ernst die Verantwortlichen der Kommune die Meinung der Frauen nahmen und wie andrerseits die Frauen eine immer größere Rolle im Leben der Kommune spielten.
Ich merkte, dass sie sich verabschieden wollte, deshalb sagte ich rasch, trotz der bewegten Zeitläufe, in denen viele Restaurants eher Versammlungsräumen und Debattierklubs glichen, würde sich wohl ein ruhiges Bistro finden, um noch bei einem Vin Rouge etwas zu plaudern.
Dagegen stehe die Pflicht, sagte Manon und wies mit der Spitze ihres zierlichen Schirms schräg über den Damm auf ein Gebäude. Dort befinde sich die Abendschule vom Komitee des elften Arrondissements, wo sie Rhetorik und Französisch unterrichte. Zwar hätte ich mich ihr anschließen können, denn die Abendschulen der Kommune standen jedem offen, doch befürchtete ich, sie würde mich für allzu aufdringlich halten. Ich drückte mein Bedauern aus: "Wie schade, zu gern hätte ich noch das Vergnügen Ihrer Gesellschaft genossen. Darf ich Sie um ein Wiedersehen bitten?"
"Besser nicht", erwiderte sie, "wie ich Sie einschätze, würden Sie des Geplauders mit einer braven verheirateten Frau rasch überdrüssig."
„Sie sind verheiratet?"
Meine Überraschung war echt, denn Manon trat derartig selbstverständlich emanzipiert auf, dass kein Gedanke an einen Gatten aufkam.
"Weil ich für die Ledigen eine Lanze gebrochen habe, hielten Sie mich für ledig?"
Ich schwieg etwas zu lange, betroffen nicht von der Berechtigung, sondern vom Spott ihrer Frage. Dann hatte ich mich gefangen. "Meine Begeisterung für die Lanzenführerin ist umso größer. Wer derart für die anderen eintritt, dem glaubt man seinen Idealismus, sieht man doch nicht wenige, die an der reinen Flamme nur das private Süppchen kochen."
"Werden Sie nicht pathetisch. Ich versuche, meine Überzeugung mit meinen Mitteln zu vertreten. Tun Sie Ähnliches nicht mit Ihrer Feder?"
Ihre Art verführte dazu, ebenfalls offen zu sein. "Ich habe manche Zeile der Eitelkeit zuliebe geschrieben. Mehr dunkle Seiten meines Charakters möchte ich auf offener Straße nicht enthüllen, gewähren Sie mir das Geschenk eines Wiedersehens.“
Ihre Absage war so freundlich wie bestimmt: "Monsieur, Paris war nie voll größerer Unrast, da scheint es klug, sich nicht auch noch privat Unruhe zu verschaffen."
"Unruhe ist die Mutter des Fortschritts!" entgegnete ich. Ein Versuch, wenigstens noch mit ihr im Gespräch zu bleiben, doch sie huschte schnellfüßig über den Damm, querte das Trottoir und war schon im Eingang jenes Gebäudes verschwunden.
Eine derart konsequente Abfuhr hatte ich noch nicht erlebt, zornig schlenderte ich meiner Behausung zu. Durch den Misserfolg kam mir nicht mit einer Silbe das Wort Liebe in den Sinn, auch nicht, dass mir eben widerfahren war, was Skribenten allzu flugs unentrinnbares Schicksal nennen.
Freunde behaupten von mir, auf der Habenseite meines Charakters stehe die Fähigkeit, einem Unglück schnell mit Plänen auf den Leib zu rücken. Ich halte tatsächlich nichts von Lamentationen, weil sie auf andere nur einen komischen Eindruck machen.
Nach einer Nacht, die mehr mit Überlegungen ausgefüllt war als mit Schlaf, stand mein Entschluss fest, alles daranzusetzen, um Manon zu gewinnen. Offensichtlich war sie keinesfalls davon überzeugt, dass es lohne, sich mit mir abzugeben. Wie sie später gestand, betrachtete sie mich als geistreichen, oberflächlichen Dandy, und es hatte ihr Spaß bereitet, mich wie einen begossenen Pudel stehenzulassen. Bedenklich fand sie auch, mit welcher Nonchalance ich die Dinge der Allgemeinheit betrachtete. Gut einen Monat war es erst her, dass der Volksaufstand die verräterische Thiers-Regierung in die Flucht getrieben und das Zentralkomitee der Nationalgarde die Macht in der Hauptstadt übernommen hatte. Paris glich einem kochenden Riesenkessel, es steckte voller Energien, Meinungen, Tätigkeiten. Am 18. April hatten die Versailler Truppen die Offensive gegen Paris begonnen, am 21. April die Nationalgardisten unter Dombrowskis Kommando bei Clichy Erfolge errungen. Es waren eine Reihe wichtiger Dekrete erlassen, beispielsweise über die Schulgeldfreiheit und über die Requirierung leerstehender Wohnungen. Und in diesen Tagen entscheidender Ereignisse vergeudete der Journalist Paschal Grousset kostbare Zeit beim Flirten mit einer verheirateten Frau!
Zum Glück wusste ich an jenem Morgen nicht, wie Manon mich damals einschätzte, und beflügelt schrieb ich meinen Artikel für den "Ami du Peuple". Manon geriet stark in den Vordergrund, obwohl ich nach einigen Recherchen, Befragungen und Versammlungen nur in den Frauenklub gegangen war, um das Ganze abzurunden. Das Porträt einer schönen Frau, die innerlich beseelt ist von ihrer Sache, wurde eine, die Pariser bewegende, Arbeit. Da ich Manon weder heroisiert noch idealisiert hatte, sondern Charme, Verstand und Esprit als Attribute einer fortschrittlich engagierten Frau darstellte, kam sie auf diese Weise ins öffentliche Gespräch.
Ich hütete mich, Manon sofort nach dem Erfolg des Artikels unter die Augen zu kommen, um nicht dazustehen wie ein beflissener Schüler, der Lob und Dank für die brave Arbeit in Empfang zu nehmen hofft. Stattdessen bemühte ich mich, soviel wie möglich über sie zu erfahren. Das war nicht schwierig, denn selbst auf Plakaten und Werbezetteln waren Spuren ihres Wirkens zu verfolgen. So wie sie am 13. April im Amphitheater der Medizinschule den Prolog zu der Veranstaltung gesprochen hatte, auf welcher der berühmte Maler und Präsident der Kunstkommission der Kommune, Gustave Courbet, eine Gewerkschaft der Maler und Bildhauer gründete, so rezitierte sie zu den verschiedensten Anlässen, sang Chansons, trug Manifeste vor oder übernahm die Conference für öffentliche Veranstaltungen.
Die Dupriaux wohnten in der Rue Tronchet, einer ruhigen Nebenstraße, die in den Boulevard Haussmann mündet und kaum eine Viertelstunde entfernt liegt vom Theatre des Italiens. An diesem Musentempel war Armand Dupriaux Intendant. Merkte denn der Trottel nicht, welch eine Begabung seine Frau war.
Da ich des Öfteren auch Theaterkritiken schrieb, bekam ich leicht Kontakt zu Schauspielern. Von einem Gerard Lesnour erfuhr ich, dass Manon vor fünf Jahren als Zweiundzwanzigjährige ihr vielversprechendes Debüt im Theatre des Italiens hatte. Bezaubert von Begabung und Anmut der jungen Elevin, hatte sich Armand Dupriaux in sie verliebt. Manon spielte die Celimene in Molieres "Le Misanthrope", die Aufführung hatte Erfolg. Als das Stück nach zwölf Monaten abgesetzt wurde, gab es keine Rolle mehr für Manon am Theatre des Italiens. Die beiden hatten geheiratet, und Dupriaux erklärte, sie hätten es nicht nötig, sich dem Vorwurf der Vetternwirtschaft auszusetzen, da man Manon nach diesem Erfolg in jedem Pariser Theater mit Kusshand engagieren würde. Er hätte es besser wissen müssen, denn welcher Spielleiter hat nicht seine bitteren Erfahrungen mit verwöhnten Intendantengemahlinnen als Schauspielerinnen wie auch mit deren Ehegatten, die gegen jede Aufführung Stimmung machen, welche der geschätzten Gattin nicht den erwarteten Ruhm bringt.
"Inzwischen könnten die Pariser Theaterdirektoren allerdings bemerkt haben", sagte ich, "dass solche Befürchtungen bei Manon Dupriaux nicht zutreffen."
"Sie übersehen", antwortete Lesnour, "wer längere Zeit nicht die Bühne betritt, der wird vergessen."
Da ich Manons Aktivitäten kannte, sagte ich ein wenig spöttisch: "An manchen Tagen betritt sie sogar zweimal die Bühne."
Lesnour gab den Spott zurück. "Bühne oder Tribüne? Man schätzt Madame Dupriaux als Rednerin, Deklamatorin, politische Chansonette, aber wer weiß heute noch, dass sie das Zeug zur großen Schauspielerin hat?"
Ich fragte Lesnour, wie er Monsieur Dupriaux einschätze. Lesnour, kaum älter als dreißig Jahre, schien recht versiert im Theaterfach. "Von der Persönlichkeit unseres Intendanten geht eine gemütvolle Ruhe aus, seine Ausgeglichenheit überträgt sich auf das ganze Theater. Er verabscheut übersteigerten Ehrgeiz und mag keine spektakulären Bühnenexperimente. Dagegen liefert er solide Handwerksarbeit und weiß sehr viel über Schauspielkunst. Zum Beispiel, wie man stets mit dem Rücken an die Wand kommt. Noch eine Kunst beherrscht er ausgezeichnet: nicht aufzufallen. Mit einem Wort, Monsieur Dupriaux ist ein französischer Mustermensch und weiß Gott glücklicheren Naturells als die teure Gattin."
Um mich zu revanchieren, sagte ich Lesnour, er besitze die bemerkenswerte Gabe der Menschenbeobachtung.
Je mehr ich erfuhr, desto mehr Rätsel gab mir Manons Leben auf. Wie vermochte sie auch nur einen Tag mit diesem Dupriaux zu leben? Weshalb hatte sie sich damals seiner albernen Maxime nicht widersetzt, mit der er ihr Talent eingesargt hatte? Warum verschaffte sie sich nicht selbst dankbare Rollen?
Wenn Manon mich verdächtigte, ich vergeude Zeit beim Flirten, so stimmte das nicht. Nur weil sie mich so beeindruckte, hatte ich sie angesprochen. Die Tage der Kommune drückten meinem Leben ihren Stempel auf, meine Nächte waren selten länger als sechs Stunden, gern hätte ich zwei Köpfe und vier Hände gehabt. Von den Kollegen der fortschrittlichen Pariser Zeitungen war ich in die Kunstkommission der Kommune delegiert worden, zu viele Probleme, die gelöst werden sollten, nahmen unsere Zeit in Anspruch. Der Vorsitzende, unser guter Gustave Courbet, hatte das Talent, eine Kompanie Publizisten zu beschäftigen. Oft genug bat er mich um ein journalistisches Donnergrollen gegen lederärschige Bürokraten, oder er animierte mich, säumigen Kommandeuren wegen ihres Autoritätsschwunds den Marsch zu blasen. Seine Bitten hatten Gewicht, denn er selbst war seinem berühmten Pinsel untreu geworden, um nur noch für die Angelegenheiten der Kommune da zu sein. So schrieb ich wöchentlich allein für ihn zwei, drei Artikel, die er mir vorher als Paukenschläge, Fanfarensignale, Trompetenstöße umriss. Je schärfer diese Pamphlete ausfielen, desto zufriedener war Courbet, und es lässt sich vorstellen, dass ich mir Freunde erwarb und noch mehr Feinde. Auf die Art eingespannt und stets bekannter werdend, wurde ich von Redaktionen und Herausgebern bedrängt, und ich fragte manchmal, ob sie nicht eine Zaubermühle wüssten, in die oben das Thema hineingesteckt werden könnte und unten die fertige Glosse, das Feuilleton oder der Kommentar herauskäme. Dabei waren die Forderungen der Kollegen nur zu berechtigt. Ein Heer reaktionärer Schreiberlinge überschrie unser Häuflein Progressiver, die Presse im direkten oder indirekten Dienst der Versailler überflutete das bedrängte Paris mit Verleumdungen, Gerüchten und Panikmache. Es gab zwar eine erkleckliche Anzahl fortschrittlicher Publikationen, wie "La Montagne" von Gustave Marotteau; "Le Cri du Peuple" von Jules Valles, "Le Vengeur" oder "La Commune". Blättchen, und Blätter schossen wie Pilze ans Tageslicht, doch ihre Auflagen waren niedrig, und so plötzlich, wie sie erschienen, verschwanden sie meist wieder. Wir lernten den Effekt gezielter Lügen hassen. Unsere Wahrheit war monumental, ehern und unbezwingbar, aber ihre Stimme war zu leise, sie kam nur langsam voran und deshalb meist zu spät. Die Lügen der Boulevard-Journaille und der sogenannten seriösen Tageszeitungen, finanziert vom Bank-, Handels- und Industriekapital, waren flink wie Kakerlaken und zahlreich wie die Termiten, sie unterminierten das Gebäude der Kommune, höhlten die Moral aus und zerfraßen die öffentlichen und privaten Beziehungen. Mit fast selbstmörderischer Großmut sah die Kommune diesem Treiben zu, und als endlich am 18. April vier der reaktionärsten Gazetten verboten wurden, geschah das einen Monat zu spät. An besagtem Verbot glaube ich ein indirektes Verdienst beanspruchen zu dürfen. Ich hatte ein bissig-realistisches Porträt des Advokaten Jules Favre geschrieben - nunmehr Außenminister der Versailler Regierung und serviler Diener seiner selbstherrlichen Exzellenz Thiers -, worin ich daran erinnerte, dass Favre noch am 17. September 1870 öffentlich erklärt hatte, Frankreich werde nicht einen Fußbreit Landes und nicht einen Stein seiner Festungen abtreten. Am nächsten Tag traf sich derselbe Favre zu Geheimabsprachen mit Bismarck, was ihn dann geradezu prädestinierte, Monate später mit dem "eisernen" Kanzler darüber zu kuhhandeln, wie man gemeinsam der Kommune den Garaus machen könne. Der schlagfertige Zeichner Pilotelle ließ sich von meiner Abrechnung mit Favre zu einer seiner wirksamsten Karikaturen anregen. In wohlwollender Pose steht der einstige Kartätschenprinz, Preußenkönig Wilhelm I., vor dem devot niedergeknieten Favre, der ihn um Hilfe gegen die Kommune anfleht.
Leider wurden dann erst am 5. Mai weitere sieben Gazetten, die Volksverhetzung betrieben, verboten. Es war eine verwirrende Zeit, und es geschahen verrückte Dinge; und es war eine großartige Zeit, und es geschahen großartige Dinge.
Obwohl ich mir den Krampf ins Handgelenk schrieb und mit tausend Dingen beschäftigt war, kreisten meine Gedanken um Manon. Tagelang hatte ich nach meinem Artikel auf ein Lebenszeichen von ihr gehofft, ob nun ein kleines Billett mit einem Dankeswort oder einen Brief voller Vorwürfe. Nichts dergleichen, ich erlebte schmerzhaft, wie einen Gleichgültigkeit treffen kann. Ich hatte Sehnsucht nach ihrer Anmut wie nach ihrer sprühenden Lebendigkeit, ging aber trotzdem zu keiner der Veranstaltungen, in denen sie auftrat. Ich fürchtete mich vor einer abermaligen Abfuhr und war überzeugt, dass nur kleine, vorsichtige Schritte mich dem ersehnten Ziel näher brächten. Manon schien mir viel zu gefestigt in sich, als dass sie von netten Höflichkeiten und geistreichen Komplimenten nachhaltig beeindruckt werden könnte.
Wie nicht selten im Leben und in der Literatur kam mir der Zufall zu Hilfe, Männer der Wissenschaft mögen mich für die miserable Definition von Ursachen, Zusammenhängen und Schnittpunkten schelten, aber ich ertappe immer wieder auch erlauchte Geister, wie sie für unerwartete Geschehnisse, überraschende Situationsänderungen und scheinbar, unbegründete Lösungen das schöne alte Wort Zufall benutzen.
Gustave Courbet, der unermüdliche Vorsitzende unserer Kunstkommission, kannte kein Erlahmen, wenn es um die Abschaffung inhumaner und die Erarbeitung humaner Gesetze ging, und besonders beharrlich betrieb er das in Bezug auf alles, was Kunst und Künstler betraf.
In jenen Tagen hatte er angeregt, wir sollten ein Dekret zur Übergabe privater Theater an die Künstlerkollektive ausarbeiten. Es Muss nicht, betont werden, wie begeistert vor allem die Betroffenen reagierten. Waren die Zustände an den städtischen und staatlichen Bühnen schon erbarmungswürdig, was sich die Schauspieler der privaten Thespisbuden bieten lassen mussten, spottete jeder Beschreibung. Der Weg vom Gedanken zur Tat scheint mir ein ewiges Problem der Menschheit. Man bedenke, wie die nützlichsten Erfindungen Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte warten mussten, bis sich die Leute endlich ihrer bedienten. Schlimmer ist es noch mit den nützlichen, das heißt menschlichen Gesetzen. Viele große Denker und alle Umwälzungen haben Brauchbares an Regeln des Zusammenlebens hervorgebracht. In diesem Zusammenhang denkt man als Franzose fast automatisch an unsere Große Französische Revolution. Noch achtzig Jahre später musste die Commune in vielen Punkten durchzusetzen versuchen, was damals, entweder versäumt oder wieder von der Reaktion rückgängig gemacht worden war. Wenn man das bedenkt, haben wir mit Sturmgeschwindigkeit gearbeitet. Das Dekret wurde am 20. Mai einundsiebzig erlassen.
Doch bevor es soweit war, mussten wir entwerfen, verwerfen, umformulieren, neu formulieren, was anregend und aufmunternd sein kann, meist aber ermüdend ist. Kaum hatten wir unsere Arbeit begonnen, da fiel der Name: Madame Dupriaux. Ein bekannter Schauspieler, ein Rezensent und ein Bühnenmaler, äußerten gleichzeitig den Gedanken, unser Arbeitskreis wäre unvollständig ohne die Mitwirkung Madame Dupriaux. Nicht darauf gefasst, plötzlich ihren Namen zu hören, war ich beinahe erschrocken über Manons Beliebtheit. Mich selbstgefällig in dem Gedanken zu sonnen, dass ich nicht unbeteiligt an dieser Popularität sei, war keine Zeit, es galt, den berühmten Wink des Schicksals zu nützen. Betont sachlich unterstützte ich den Vorschlag mit der Feststellung, es arbeiteten ohnehin zu wenige Frauen in diesem Ausschuss mit. Ich erbot mich, Madame Dupriaux unsere Bitte zu überbringen. Lachend wurde zugestimmt, man sah heitere Gesichter und raunende Münder. Einige der Scherzworte fing ich auf, die gutmütigen Spötteleien liefen darauf hinaus, unsere Körperschaft könne keinen besseren Bittsteller schicken als mich. Um das Thema vom Tisch zu bringen, machte ich einige Verfahrensvorschläge. Eine hitzige Debatte entspann sich, und ich hatte Zeit zum Nachdenken. Ganz Paris schien überzeugt, ich sei der Geliebte Madame Dupriaux'. Zum ersten Mal empfand ich derart deutlich, wie undifferenziert die Mehrheit der Leute denkt: Dieser Grousset muss doch mit ihr schlafen, warum sonst sollte er die Dupriaux derart ins Rampenlicht rücken? Alle Pariser billigten mir zu, was ich nach ihrer Auffassung verdient hatte, doch die Hauptperson hatte mir nicht einmal zum Dank eine freundliche Zeile geschickt. In einem günstigen Moment entschuldigte ich mich mit einer wichtigen Verabredung und verließ die Tagung.
Gern hätte ich eine Droschke genommen, ich hatte es plötzlich eilig, doch die Droschkengäule waren längst den Weg allen Pferdefleisches gegangen, in Paris wurde wegen der Belagerung selbst Hunde- und Katzenfleisch als Delikatesse gehandelt. Es hieß, zu Fuß gehen macht einen ruhigen Kopf, doch in meinem Schädel rumorte es, immer heftiger. Endlich hatte ich einen Grund, das Haus der undankbaren Person zu betreten, und ich hoffte inbrünstig, dass sie anwesend, der Gatte dagegen abwesend sei.
Es schien leider umgekehrt zu sein. Das Haus der Dupriaux in der Rue Tronchet wirkte trostlos. Allenthalben hatte Verwahrlosung Besitz ergriffen von dem schmalen Gebäude, das, eingeklemmt zwischen andern, mit Türmchen und Erkerchen eine Villa vortäuschen sollte. Nirgends fand sich ein Türklopfer oder Klingelzug. Die Tür zu dem verandaartigen Vorraum stand halb offen, ich trat ein, das Halbdunkel des kleinen Vestibüls machte mich ratlos. Als ich mehrmals vergeblich gerufen hatte, klopfte ich mit dem Knauf meines Stockes gegen die Vestibültür und rief lauter. Aus der dunkelsten Ecke des Raumes, der mit künstlichen Marmorfliesen ausgelegt war, fragte eine etwas schleppende Männerstimme: "Sie wünschen?"
"Einen schönen guten Tag", sagte ich und nannte meinen Namen in der Hoffnung, der Mann würde etwas nähertreten.
Er tat es nicht, fragte nur sichtlich desinteressiert: "Und weiter?"
"Ich komme im Auftrag der Kunstkommission und wünsche Madame Dupriaux zu sprechen. Eine dringliche öffentliche Angelegenheit."
"Aber wir sind kein öffentliches Haus, und Madame ist nicht zu sprechen."
Meine Augen hatten sich an das Halbdunkel gewöhnt, sein breites blasses Gesicht schwamm als weißer Fleck in dem Dämmerlicht. Er stand in einer halboffenen Tür, hinter der die Küche zu sein schien. Ich gedachte ihm seine Unverschämtheit zurückzuzahlen. "Einem Bediensteten stehen solche Entscheidungen nicht zu. Hier ist meine Karte, und nun fix, unterrichten Sie Madame von meinem Hiersein."
"Was unterstehen Sie sich. Manon Dupriaux ist meine Frau."
"Ah, hocherfreut, Monsieur!" Ich lüftete meinen Hut.
"Verlassen Sie sofort das Haus!"
"Ich hatte ohnehin nicht vor, mich hier einzumieten. Sowie ich mit Madame gesprochen habe, soll Ihr Wunsch in Erfüllung gehen."
"Machen Sie, dass Sie fortkommen!" Seine. Stimme überschlug sich ein wenig.
Befand Madame sich im Haus, dann musste der Krach sie herbeilocken. Deshalb provozierte ich weiter. "Einem Gläubiger gegenüber wären Sie wohl höflicher, Monsieur. Leider bin ich nur Theaterrezensent. Sicherlich wollen Sie mir vorspielen, wie ungehobelt selbst ein gebildeter Mensch sein kann."
"Das ist ja zum Verrücktwerden!" Sein Aufschrei fiel zusammen mit einem harten Knall und dem Geräusch splitternden Porzellans, er musste eine Schüssel oder einen Teller auf die Fliesen geworfen haben. Seine Stimme kippte ab ins Falsett. "Heißt Kommune denn Rechtlosigkeit des Hausherrn? Welches Dekret schreibt vor, die Nerven gutwilliger Bürger zu ruinieren? Ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, nein, nein, nein!"
In seinem Ton klang echte Verzweiflung. Ich murmelte entschuldigend: "Weshalb verschließen Sie nicht die Tür, wenn Sie nicht gestört sein wollen?"
Jemand kam die Treppe herunter, ich erkannte Manons ernstes Gesicht. Auf dem letzten Absatz blieb sie stehen und sagte so eindringlich wie vorwurfsvoll: "Ich bitte dich, Armand!" Sie stieg die letzten Stufen herab und fragte mich wie einen Fremden: "Sie wünschen, Monsieur?"
Dupriaux verschwand und warf die Küchentür hinter sich zu, ich wiederholte, was ich schon ihm gesagt hatte.
Sie maß mich mit einem Blick, der wie ein unsichtbares, tadelndes Kopfschütteln war, öffnete den schmalen Flügel der einzigen Doppeltür und sagte abweisend höflich: "Bitte, treten Sie näher, Monsieur."