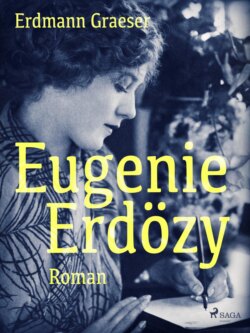Читать книгу Eugenie Erdözy - Erdmann Graeser - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V.
ОглавлениеFräulein Eugenie Erdösy war am nächsten Sonntage — wie immer an diesem Tage — nach der Hedwigskirche in die Frühmesse gegangen. Im buntfarbenen Dämmerlicht, Weihrauchduft, bei den Worten des Geistlichen und dem Gesang der Andächtigen versank die Welt da draussen, sie wurde das Kind, das daheim in Nagy-Kanisza im Gotteshause gekniet, in frommem Erschauern der Gottesnähe, Herz und Seele voll inbrünstigem Verlangen nach dem Heiland. Und ihre Gedanken flogen dann nach dem Elternhause, den Weinbergen des Vaters, die jetzt der Bruder bewirtschaftete, sie dachte an die Traubenlese dort, und das Verlangen wurde übermächtig in ihr, noch einmal dieses Heimatglück auskosten zu können.
Als sie dann nachher Unter die Linden kam, beglückte sie die klare Luft und der warme Sonnenschein — sie fand sich wieder in das Grossstadtleben, schritt behaglich im Zuge der Vormittagsspaziergänger dahin, oftmals erkannt und begrüsst von Besuchern des Theaters.
„Hallo — Nanon!“
Eine bekannte Stimme ertönte hinter ihr. Sie wandte den Kopf und blieb überrascht stehen.
„Jessas — der Schweighofer Felix — sieht man dich also auch wieder einmal!“ Sie streckte dem berühmten Kollegen die Hand entgegen.
„Servus, Jenny!“ Er beugte sich tief herab zum Handkuss und blickte sie dann an, strahlend von guter Laune. „Schön siehst du aus — wie ein Marzipanpupperl, so süss! Schau, Nanon, jetzt gehen wir ins ‚Bauers‘ — ich spendier’ dir eine Schokolad’, und wir plauschen a bissel. Komm’, zier’ dich nit!“
„Tu ich ja gar nicht — hab’ grad’ selber denkt: Möchst jetzt an Kavalier haben — und da bist du da, wie vom Himmel gefallen. Aber lang’ hab’ i nit Zeit, dass du’s gleich weisst!“
Sie stiegen in die erste Etage, wo die Zeitungsleser sassen, und setzten sich an die Fensterseite.
„So sag’, was machst, Felix? Aber überflüssige Frag’ — die Kritik lobt dich ja in den Himmel!“
Er schnitt eine Grimasse. „Übel wird mir, wenn ich’s lese — aber da ist halt nix mehr zu ändern! Ein grosser Künstler hätte ich werden können, wenn man mich nicht gezwungen, immer wieder in diesen elendigen Schmarrn zu spielen!“
„Du bist a grosser Künstler, Felix, das weisst doch, die ganze Welt kennt dich!“
„Du frozzelst — aber sprechen wir nicht davon. Hast du was aus Wien gehört — was machen die da?“
Und nun schwelgten sie beide in lustigen Erinnerungen an die dortigen Bühnenkünstler.
„Glücklich sind wir gewesen — a schöne Zeit war’s — aber ich bleib auch hier nicht lange am Friedrich-Wilhelmstädtischen, hab’ schon Kontrakt gemacht, hab’ von Neujahr ab ein Gastspiel wieder beim Steiner!“
„Gratulier’. Du Glücklicher!“
„Möchst’ nicht auch fort — nach der Kaiserstadt?“
„Wie gern! Aber die Blanka will, dass ich ein Jahr wenigstens hierbleiben soll — doch es gefallt mir nit in der ‚Walhall‘ — zuviel Klatsch und Neid!“
„Lass’ dir nix ankommen, Jenny, schüttle es ab, wie der Pudel die Flöhe!“
Ein Säbelklirren liess beide aufblicken. Schweighofer war aufgestanden und schüttelte dem Dragonerleutnant die Hand. „Grüss Gott, Herr Graf — was treibt Sie ins Café — sollten doch in der frischen Tiergartenluft traben. Gestatte, Jenny — ein guter Bekannter von meinen Morgenritten — Graf Storkow — meine Kollegin Eugenie Erdösy!“
„Ich kenne Gnädigste von der Bühne und bin beglückt, sie nun auch persönlich kennenzulernen!“
„Also, kommen Sie, Herr Graf, so — vis-à-vis der Gnädigen, dass Sie nicht gleich Feuer fangen können!“
„Wenn Sie gestatten!“
Jenny, die sich im ersten Erschrecken verfärbt, wich seinem Blicke aus.
„Wie ich beneidet werden würde, dass ich mit zwei so berühmten Künstlern —“
„Bitt’ schön, Herr Graf, wir brauchen ka Zuckerl, strengen sich’s Ihnen nit unnütz an, wir sein ganz natürlich! Wo haben’s gesteckt so lange Zeit? Hab’ Sie doch an Ewigkeit nicht mehr im Tiergarten noch im Theater gesehen?“
„Ich hatte Urlaub, bin erst kurze Zeit wieder in Berlin —“
„Auf der Jagd gewesen?“
„Ja — Rebhühner! Aber das war nicht der Grund — musste mich wieder mal ein bisschen um das Gut kümmern. Papa hat das Interesse an der Landwirtschaft verloren und lässt den Bruder schalten und walten. Aber der liebe Fritz hat Liebesgedanken — also, ich war mal wieder nötig!“
„Möchte auch einmal so ausspannen können — so ganz und gar ein anderer Mensch werden.“
„Ich fahre zu Weihnachten wieder hin — lade Sie herzlich ein. Papa wird sich’s zur grossen Ehre anrechnen, wenn ich Sie mitbrächte!“
„Dank’ schön, Herr Graf — sehr, sehr lieb; aber da bin ich in Wien, hab’ dort Engagement angenommen. Sprach gerade mit der Gnädigen davon. Was, Jenny, wenn’s dir hier nit gefallt, kommst nach — der Steiner nimmt dich mit Kusshand!“
„Das werden Sie uns nicht antun!“ Es klang wie eine flehende Bitte, und Schweighofer blickte ihn ganz betroffen an.
„Jenny — hörst du nit? Sing a Loblied auf unser Wien!“
„Dann müsst’ ich Berlin schlecht machen — und das will ich nit!“ Zum erstenmal hatte sie Storkow voll angesehen, und unter dem Blick dieser grossen, schönen Augen hatte dieser ein Entzücken empfunden, das ihn verwirrte.
Aber auch ihr erging es seltsam — zum erstenmal sahen sie sich ja beide im strahlenden Morgenlicht, und sie war betroffen von dem leuchtenden Blau seiner Augen, der rassigen, feingeformten Nase in dem frischbraunen Gesicht.
„Berlin ist meine Vaterstadt — Wien kenne ich leider nicht“, sagte Storkow. „Es heisst immer, wir hätten keine Kultur, und doch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Wiener, die sich hier erst einmal richtig eingelebt, nicht wieder mit der Donaustadt tauschen würden. Ich glaube, es kommt auf die Kreise an, in denen man hier leben muss, um Berlin liebzugewinnen!“
„Ja — gewiss! Aber die Luft ist hier zu scharf — sie entstellt, verstehn’s mich recht, Herr Graf!“
Aber er verstand sie nicht gleich, doch Schweighofer kam ihm zu Hilfe. „Die Luft fürs Herz — meint die Jenny, nicht für die Lunge. Und nun werden Sie denken, ich red’ a schön’ Ballawatsch zusammen; denn ein Herz braucht ka Luft! O doch — es hat Kämmerlein, sehen’S, lieber Graf, und die müssen auch mal ausgelüft’t werden. Kennen’S nicht das schöne Lied:
’s Herz ist ein spassig Ding ...“
Wehmütig summte er die Melodie vor sich hin.
„Trotzdem“, sagte Storkow, „hier schlagen Ihnen alle Herzen entgegen — das müsste Ihnen doch wohltun — —“
Schweighofer sah ihn kritisch an. „Ja — — die Berliner sind herzige Leut’! Für alles, was nit in ihrer Stadt gewachsen ist, haben’s eine sehr grosse Schwäche. Aber, wie ist’s, Jenny, die Schokolad’ ist nix wert, — soll ich was anderes bestellen?“
„Danke — nein, ich muss ja gehen — die Blanka kann’s nicht vertragen, wenn ich mich verspäte. Ich geh’ jetzt also — dank’ dir schön, Felix, hoffentlich führt uns der Zufall wieder einmal so zusammen!“ Sie griff nach ihrem Gebetbuch und den Handschuhen und erhob sich.
„Aber, nein, Jenny, — hast ja noch lange Zeit!“
„Lassen sich die Herren nicht stören — ich muss heim. Ist ja viel später geworden, als ich gedacht hab’! Vor der Türe nehm’ ich gleich einen Fiaker!“
„Oh, du mei! In Berlin einen Fiaker“, lachte Schweighofer.
„Dürfte ich Ihnen nicht behilflich sein, Gnädigste?“
„Danke, das macht der Herr Portier mit seiner Trillerpfeife — also adieu — adieu —!“
Sie hatte beiden die Hand gereicht und war rasch der Treppe zugeschritten.
Die Herren hatten wieder Platz genommen, und Storkow fragte jetzt so nebenbei: „Fräulein Erdösy war in der Kirche — sie ist Katholikin?“
„Ja — die Messe hat sie nie versäumt, auch in Wien nicht.“
„Ich bewundere sie aufrichtig — nicht nur als Künstlerin!“
„Ich bin gerad’ nicht stockblind“, sagte Schweighofer. „Aber, wenn ich mir einen guten Rat erlauben darf — die Jenny schlagen’s Ihnen aus dem Kopf, — reissen Sie alle Hoffnungen aus Ihrem Herzen. Die Jenny ist anders — die hat ein Ziel — und wird’s erreichen. Selbst für eine Grafenkrone gibt sie das nicht auf! In Wien nannten wir sie die Lilie!“
„Diese Dame, von der sie vorhin sprach, ist eine Verwandte?“
„Ah — nein! Die Blanka Mertini, wissen’S das nicht, Herr Graf? — ist bekannt als eine vorzügliche Lehrerin. Die hat halt a Narren an der Jenny gefressen — so ist das!“ Er hatte sein Zigarettenetui geöffnet und bot an; aber Storkow lehnte lächelnd ab.
„Nein — ich rauche nur Zigarren — wenn ich mir erlauben dürfte —“, er hielt ihm die geöffnete Ledertasche hin.
„Bauchgrimmen krieg’ ich, wenn ich die schwarzen Dinger sehe — wundere mich, dass man so etwas rauchen kann. Ja, wenn’s eine Virginia wär’!“
Storkow lachte laut auf. „Ich wundere mich wieder, wie man an so einem Strohhalm nuckeln kann, und alle Augenblicke geht die Giftnudel aus!“
„Muss alles verstanden sein — man muss erst dahinter kommen!“
Und dann glitt das Gespräch auf anderes — auf Pferde, auf die Morgenritte im Tiergarten, auf die Reitbahn in der Luisenstrasse.
Aber plötzlich blickte Schweighofer nach der Uhr und sagte ganz betroffen: „So spät schon — kann das stimmen? Ja, dann muss ich auch fort, hab’ ja eine Verabredung! Also, lieber Graf, war mir eine besondere Ehr’ — meine Hochachtung — —“
„Ich gehe ja auch, — Kellner, zahlen!“
Vor dem Café nochmaliges Händeschütteln — dann schlenderte Storkow nach der Behrenstrasse, um bei Siechen Mittag zu essen. Die jungen Offiziere seines Regiments hatten dort ihren Sonntags-Stammtisch, vielleicht, dass er v. Plesser antraf.
Das Lokal war gefüllt — alle Tische besetzt, auch der kleine in der Ecke, der sonst für die Dragonerleutnants reserviert war. Freilich nur ein Herr sass dort — ein Zivilist, der wohl sehr bald gehen würde.
„Gestatten?“
„Bitte sehr!“
Storkow nahm Platz — bestellte sein Essen. „Niemand hier gewesen, Franz?“
„Nein, Herr Graf!“ Und der Kellner flüsterte ihm bedauernd zu, dass er bei dem unerwarteten Andrangs heute den Tisch nicht habe freihalten können.
Während Storkow die Speisekarte las, fühlte er den forschenden Blick des fremden Herrn auf seinem Gesicht. Indigniert und hochmütig sah er ihn deshalb an; aber der Herr lächelte verbindlich und fragte: „Ich irre mich wohl nicht — die Familienähnlichkeit ist ja unverkennbar — habe ich die Ehre mit Graf Storkow?“
„Und mit wem habe ich das — Vergnügen?“
„v. Hilken — Justizrat! Ich bin der Rechtsbeistand der Gräfin Cäcilie Storkow.“
„Meiner Tante — aber das ist doch eine alte Dame — ich wundere mich, dass Sie da eine — wie sagten Sie? — eine Familienähnlichkeit mit mir erkennen wollen.“
„Und doch ist sie vorhanden — als Notar bin ich in die Familienverhältnisse des Hauses Storkow eingeweiht, kenne nach Photographien den Herrn Bruder Ihrer Tante — also Ihren Herrn Vater, und habe bei allen den gleichen Familienzug gefunden. Übrigens stehe ich auch mit dem Herrn Oberst in Briefwechsel.“
„Sie werden keine grosse Freude daran haben“, sagte Storkow spöttisch. „Aber — es ist mir interessant, Sie nun auch persönlich kennenzulernen, Herr Justizrat!“
„Und mir, dass ich Ihre Bekanntschaft gemacht habe; denn neulich abend wurde von Ihnen gesprochen — ein wundervoller Rosenstrauss war die Veranlassung!“
Storkow, der gerade bei der Suppe war, liess erstaunt den Löffel sinken — starrte den Justizrat an.
„Und wo war das, wenn ich fragen darf?“
„In meinem Bekanntenkreis — bei der Musikpädagogin Blanka Mertini. Fräulein Eugenie Erdösy hatte die Blumen mitgebracht!“
„Ich bin ein grosser Verehrer der jungen Künstlerin —“, suchte Starkow verlegen zu erklären.
Der Justizrat nickte und sagte: „Aber, Herr Premierleutnant, lassen Sie das Essen nicht kalt werden.“ Denn der Kellner hatte eben den Hasenrücken mit Rotkohl serviert. „Ich habe schon gegessen — Sie sind hungrig!“
„Das tut nichts — die Unterhaltung ist mir lieber als das ganze Essen —“
„Nein — das könnte ich wirklich nicht verantworten, zumal ... Also, ich lese den ‚Kladderadatsch‘ und rauche meine Zigarre inzwischen.“
Während Storkow dann ass — hastiger, als es sonst seine Art war —, überlegte er, ob er etwas von der Begegnung mit Fräulein Erdösy sagen sollte; denn ein Gefühl warnte ihn davor. Der Justizrat erweckte in ihm ein gewisses Unbehagen — dieser elegante, selbstsichere Herr hatte etwas in seinen grauen Augen, das plötzlich nadelscharf werden konnte. Jetzt freilich sah er vergnügt darein; die Karikaturen des politischen Witzblattes schienen ihn ausserordentlich zu amüsieren.
Und als dann der Kellner abgeräumt hatte, kam Herr von Hilken wie aus einer ganz anderen Welt, schien völlig vergessen zu haben, wovon sie vorhin gesprochen hatten. Ausserdem wurde er von kommenden und gehenden Gästen oft gegrüsst und abgelenkt, so dass er offenbar auch die Lust verloren hatte, eine Unterhaltung zu führen.
Doch — Storkow hatte die Zähigkeit und das Draufgängertum seiner Familie und sagte: „Herr Justizrat, Sie wollten mir doch etwas von Fräulein Erdösy erzählen?“
„Nicht, dass ich wüsste, Herr Premierleutnant. Aber — ja doch, Sie haben recht — wir sprachen ja von dem Rosenstrauss. Er stand auf dem Teetisch — in einer weissen Porzellanvase — königliches Porzellan, ein Prachtstück — aber während einer Unterhaltung — wir sprachen von dem niederträchtigen Klatsch, dem die Theaterdamen vogelfrei ausgeliefert sind — zog Fräulein Erdösy plötzlich einen Revolver aus der Kleidertasche und zerschmetterte durch einen Schuss die Vase — der ganze Tisch war überflutet — die Blumen lagen zwischen den Scherben!“
Sie sahen sich beide sekundenlang scharf in die Augen.
„Oper“, sagte Storkow lächelnd, „denn was hatte ihr die Vase getan?“
„Es war ein vermeintlicher Verleumder, den sie über den Haufen schoss!“
„Ich kann mir nicht denken, dass jemand Fräulein Erdösy zu verleumden wagt“, sagte Storkow in ehrlicher Empörung.
„Nun, es gibt Männer, die auf Tugend oder Untugend eines Mädchens wetten — aber damit nicht genug: wenn sie verloren haben, weil die Tugend siegte, machen sie ihrem Ärger dadurch Luft, dass sie den Wetteinsatz zurückfordern mit der Begründung, dass die Dame in Wahrheit gar nicht auf die Probe gestellt worden sei, weil — durch eine Intrige — die Versuchung gar nicht an sie herangekommen sei.“
„Herr Justizrat — Sie haben Ihre besonderen Gründe, mir das zu erzählen?!“
„Ja, Herr Graf, weil ich bitten wollte, im Interesse der jungen, unter meinem Schutze stehenden Künstlerin derselben etwas weniger Aufmerksamkeit schenken zu wollen. Alles, was zu Klatsch und Verleumdung Anlass geben könnte, muss vermieden werden, und das Ansprechen Fräulein Erdösys auf der Strasse — zur Nachtzeit — kann ihr schaden!“
Storkow war blass geworden. Einen Augenblick schwankte er, wie er sich verhalten sollte; denn dass er hier von einem Zivilisten für eine scheinbare Taktlosigkeit eine Zurechtweisung bekam, war ja nicht abzuleugnen. Zugleich aber fühlte er, dass der Justizrat doch nur zum Schutz für das Mädchen eintrat, für das er eine so tiefe Neigung gefasst hatte, und diese Erwägung gab den Ausschlag.
Und so sagte er: „Ich habe mir schon selbst Vorwürfe gemacht, Herr Justizrat. Verkennen Sie mich aber nicht. Sie wissen doch selbst, dass die Liebe jedes Hindernis nimmt — ich wollte Fräulein Erdösy doch nur bitten, mir eine Möglichkeit der Annäherung auf gesellschaftlichem Wege zu geben.“
„Und?“ fragte Herr von Hilken.
„Sie sah keine!“
„Weil sie keine sehen wollte — weil sie ... darf ich ganz offen sprechen, Herr Graf? Also, weil sie sich zu hoch einschätzt, um sich in eine aussichtslose Liebschaft einzulassen! Und — verübeln Sie es mir — dem so viel Älteren — nicht, dass ich auch Ihnen etwas Gutgemeintes sage: Ich kenne Ihre Familie, die Anschanungen, die da herrschen. Dem Herrn Oberst, Ihrem Herrn Vater, würde diese Schwiegertochter vom Theater nie willkommen sein. Wollen Sie zugunsten Ihres Bruders Fritz enterbt werden — und das würde doch der Fall sein, wenn Sie gegen den Willen Ihres Herrn Vaters eine Ehe schlössen?!“
„Ich danke Ihnen, Herr Justizrat! Vielleicht war es gut, dass uns der Zufall heute hier zusammengeführt hat. Ich hatte nicht so weit gedacht wie Sie.“
Mit einem Händedruck hatte sich Storkow bald darauf verabschiedet. Daheim dann, allein in der stillen Wohnung, hatte er die grosse Photographie „Fräulein Eugenie Erdösy als Nanon“, die er in einer Kunsthandlung gekauft, aus dem Rahmen genommen, in einen Umschlag gesteckt und im Schreibtisch verschlossen.
Er begriff jetzt selbst, dass der Traum ein Ende haben musste.