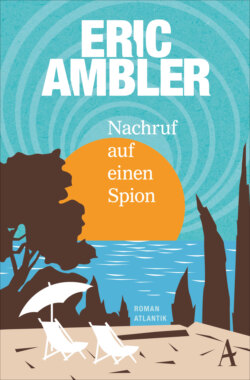Читать книгу Nachruf auf einen Spion - Eric Ambler - Страница 3
1
ОглавлениеAm 14. August, einem Dienstag, traf ich, aus Nizza kommend, in St. Gatien ein. Am Donnerstag, dem 16. August, um 11.45 Uhr wurde ich von einem Kriminalbeamten festgenommen und in Begleitung eines Polizisten auf das Kommissariat gebracht.
Diese beiden Sätze zu schreiben fiel mir nicht schwer. Ich starrte auf das Blatt Papier und überlegte, welche Wirkung diese Worte auf mich haben würden. Vor nicht allzu langer Zeit hätte mein Herz schon bei ihrem Anblick schneller geklopft, ich wäre hinausgelaufen, um unter Menschen zu sein, um den Staub der Straße einzuatmen und mich zu vergewissern, dass ich nicht allein war. Doch jetzt kann ich sie niederschreiben, ohne dass sie mich berühren. Man vergisst schnell. Oder liegt es daran, dass man die Realität immer nur bruchstückhaft, ausschnittweise wahrnimmt, dass eine Linie, die einem heute als kurzer Strich erscheint, sich tags darauf als Teil eines vollständigen Kreises herausstellt? Schimler würde dem zustimmen. Aber er ist nach Deutschland zurückgekehrt, und ich glaube nicht, dass ich ihn je wiedersehen werde. Die anderen vermutlich genauso wenig. Einer von ihnen schrieb mir vor ein paar Wochen einen Brief, der mir von der neuen Direktion des Hôtel de la Réserve nachgeschickt wurde. Er sprach von den »angenehmen Stunden«, die er in meiner Gesellschaft verbracht habe, und bat mich abschließend um ein Darlehen von ein paar hundert Francs. Der Brief steckt, noch immer unbeantwortet, in meiner Tasche. Wenn ich tatsächlich angenehme Stunden in der Gesellschaft dieses Mannes verbracht habe, so erinnere ich mich nicht daran. Ich habe auch kein Geld, das ich ihm leihen könnte. Das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Geschichte schreibe. Der andere Grund … Aber urteilen Sie selbst.
Die Eisenbahnlinie von Toulon nach La Ciotat verläuft mehrere Kilometer lang dicht neben der Küste. Sooft der Zug aus einem der vielen Tunnels auftaucht, die sich auf dieser Strecke aneinanderreihen, sieht man für kurze Zeit das strahlendblaue Meer unterhalb der Gleise, die roten Felsen, die weißen Häuser in den Pinienwäldern. Es ist, als würden einem in großer Hast bunte Lichtbilder vorgeführt. Dem Auge bleibt keine Zeit, Einzelheiten wahrzunehmen. Selbst wenn man von St. Gatien weiß und nach dem Ort Ausschau hält, sieht man nur das leuchtendrote Dach und die blassgelben Mauern des Hôtel de la Réserve.
Von St. Gatien und seinem Hotel hatte mir ein Bekannter in Paris erzählt. Die Zimmer des Réserve seien komfortabel, es liege schön, die Küche sei épatant und der Ort selbst noch nicht »entdeckt«. Für vierzig Francs pro Tag mit Vollpension könne man dort angenehm leben.
Vierzig Francs waren ziemlich viel Geld für mich, doch nach zwei Tagen im Réserve machte ich mir über diesen Luxus keine Gedanken mehr. Im Gegenteil, ich wünschte, ich hätte meinen dreiwöchigen Urlaub von vornherein dort verbracht, statt auf dem Rückweg nach Paris nur Zwischenstation zu machen. Das Réserve war eines von diesen kleinen Hotels.
St. Gatien liegt malerisch auf der windgeschützten Seite der kleinen Landzunge, auf der das Hotel steht. Die Häuser sind, wie die meisten Fischerdörfer am Mittelmeer, weiß, hellblau oder rosarot getüncht. Felsige Anhöhen, deren pinienbestandene Hänge auf der anderen Seite der Bucht steil ins Wasser abfallen, schützen den kleinen Hafen vor dem Mistral, der manchmal heftig aus Nordwest weht. Der Ort hat 743 Einwohner, die zum größten Teil von der Fischerei leben. Es gibt zwei Cafés, drei Bistros, sieben Geschäfte und, etwas weiter außerhalb an der Bucht, eine Polizeistation.
Vom Ende der Terrasse, auf der ich an diesem Morgen saß, waren das Dorf und die Polizeiwache jedoch nicht zu sehen. Das Hotel steht auf dem höchsten Punkt der Landzunge, und die Terrasse erstreckt sich an der Südseite des Gebäudes. Hinter der Terrasse geht es etwa fünfzehn Meter steil hinunter. Die Zweige der Pinien, die weiter unterhalb wachsen, berühren die Balustrade. Aber weiter draußen, in Richtung Landspitze, steigt das Gelände wieder an. Zwischen den trockenen grünen Büschen schimmert rötliches Felsgestein. Ein paar windzerzauste Tamarisken mit ihren knorrigen Ästen heben sich vor dem Tiefblau des Meeres ab. Bisweilen spritzt unten bei den Felsen eine weiße Gischtwolke hoch. Es ist schön und friedlich.
Es war schon ziemlich heiß, und im Garten zirpten die Grillen. Wenn ich den Kopf etwas bewegte, sah ich durch das Terrassengeländer den kleinen Badestrand, der zum Hotel gehörte. Zwei große bunte Sonnenschirme waren im Sand aufgepflanzt. Unter einem schauten zwei junge, tiefbraune Beinpaare hervor, ein männliches und ein weibliches. Leises Gemurmel verriet mir, dass noch andere Gäste, für mich nicht zu erkennen, sich im schattigen Teil des Strands aufhielten. Der Gärtner, Kopf und Schultern durch einen breitkrempigen Strohhut vor der Sonne geschützt, malte gerade einen blauen Streifen auf ein kleines, kieloben aufgebocktes Boot. In diesem Moment bog ein Motorboot um die Landzunge und näherte sich dem Strand. Bald erkannte ich am Ruder die schmale, schlaksige Gestalt unseres Hoteldirektors. Der andere Mann trug eine grobe Segeltuchhose und war vermutlich ein Fischer aus dem Ort. Vermutlich waren sie seit Morgengrauen unterwegs. Vielleicht würde es Rote Meerbarbe zum Mittagessen geben. Draußen auf dem Meer sah ich einen Dampfer des Niederländischen Lloyd auf seinem Weg von Marseille nach Villefranche.
Ich dachte daran, dass ich am Abend des nächsten Tages meinen Koffer packen und am Samstag früh mit dem Bus nach Toulon fahren und dort in den Zug nach Paris einsteigen würde. In Arles war es sicher schon sehr heiß, auf den unbequemen Lederbänken des Dritte-Klasse-Abteils klebte man fest, und alles bedeckte eine Schicht von Staub und Ruß. In Dijon würde ich müde und hungrig sein. Ich durfte nicht vergessen, eine Flasche Wasser mitzunehmen, in die ich vielleicht einen Schuss Wein geben könnte. Ich würde mich auf die Ankunft in Paris freuen. Aber nur kurz. Ich dachte an den langen Fußweg vom Bahnsteig des Gare du Lyon bis zur Metro. Mit dem schweren Koffer. Richtung Neuilly bis zur Place de la Concorde, umsteigen, von dort weiter Richtung Mairie d’Issy bis Gare Montparnasse. Umsteigen, weiter Richtung Porte d’Orléans bis Alésia. Den Ausgang hoch. Montrouge. Avenue de Chatillon. Hôtel de Bordeaux. Und am Montagmorgen Frühstück am Tresen des Café de l’Orient, wieder zur Metro, Denfert-Rochereau bis Etoile, dann zu Fuß die Avenue Marceau hinunter. Monsieur Mathis würde mich schon erwarten. »Guten Morgen, Monsieur Vadassy! Gut schauen Sie aus! In diesem Semester übernehmen Sie den Grundkurs Englisch, Deutsch für Fortgeschrittene und den Grundkurs Italienisch. Ich selbst werde Englisch für Fortgeschrittene unterrichten. Wir haben zwölf neue Studenten. Drei Geschäftsleute und neun Restaurantiers (er sagte nie Kellner). Alle haben sich für Englisch eingeschrieben. Für Ungarisch gibt es keine Interessenten.« Wieder ein Jahr.
Aber noch lagen die Pinien und das Meer vor mir, die roten Felsen und der Sand. Ich streckte mich. Eine Eidechse huschte über die Terrasse. Jenseits des Schattens, den mein Stuhl warf, hielt sie plötzlich inne, um sich zu wärmen. Ich sah ihre pulsierende Kehle. Ihr Schwanz bildete einen eleganten Halbkreis, dem sich die diagonale Fuge zwischen den Fliesen wie eine Tangente anschmiegte. Eidechsen haben einen erstaunlichen Sinn für geometrische Formen.
Beim Anblick dieser Eidechse fielen mir meine Fotos wieder ein.
Ich besitze nur zwei Wertgegenstände auf dieser Welt: einen Fotoapparat sowie einen vom 10. Februar 1867 datierten Brief Ferenc Deáks an den Grafen von Beust. Wenn mir jemand Geld für den Brief böte, würde ich es dankbar annehmen. Aber meinen Fotoapparat liebe ich, und hergeben würde ich ihn nur, wenn ich kurz vor dem Verhungern stünde. Dabei bin ich kein besonders guter Fotograf. Zwar wurde eines meiner Bilder in Paris bei der Ausstellung ›Fotografien des Jahres‹ gezeigt, aber wie alle Fotografen wissen, kann jeder Amateur, der über eine gute Kleinbildkamera, etliche Filme und etwas Erfahrung verfügt, früher oder später eine gute Aufnahme machen. Wie bei all diesen Geschicklichkeitsspielen, die auf englischen Jahrmärkten so beliebt sind, ist es vor allem eine Frage des Zufalls.
Ich hatte im Réserve ein wenig fotografiert und den belichteten Film tags zuvor zum Entwickeln in die Dorfdrogerie gebracht. Nun würde es mir normalerweise nicht im Traum einfallen, meine Filme von einem anderen Menschen entwickeln zu lassen. Das Vergnügen des Amateurfotografen liegt ja nicht zuletzt darin, dass er seine Filme selber entwickelt. Aber ich hatte ein wenig herumexperimentiert, und wenn ich die Ergebnisse nicht vor meiner Abreise aus St. Gatien sah, würde es mir nichts nützen. Also hatte ich den Film dem Drogisten anvertraut. Er schien sich auszukennen und hatte meine Angaben sorgfältig notiert. Um elf Uhr sollte mein Film fertig entwickelt sein.
Ich sah auf meine Uhr. Es war halb zwölf. Wenn ich ihn jetzt abholte, blieb mir noch genügend Zeit, um vor dem Essen schwimmen zu gehen und anschließend einen Aperitif zu nehmen.
Ich stand auf und ging über die Terrasse in den Garten und über das kleine Steintreppchen hoch zur Straße. Die Sonne brannte schon so stark, dass die Luft über dem Asphalt flimmerte. Ich hatte keinen Hut auf, und meine Haare fühlten sich ganz warm an, als ich sie berührte. Ich legte mir ein Taschentuch über den Kopf und ging, erst bergan, dann bergab, die Straße zum Hafen hinunter.
In der Drogerie war es kühl, und es roch nach Parfüm und Desinfektionsmitteln. Kaum war die Türglocke verklungen, als der Drogist schon auf der anderen Seite des Ladentisches stand. Er sah mir in die Augen, schien mich aber nicht wiederzuerkennen.
»Monsieur désire?«
»Ich habe gestern einen Film zum Entwickeln abgegeben.«
Langsam schüttelte er den Kopf.
»Er ist noch nicht fertig.«
»Sie haben ihn mir aber für elf Uhr versprochen.«
»Er ist noch nicht fertig«, wiederholte der Drogist gleichmütig.
Ich schwieg. Irgendetwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Seine Augen, die durch die dicken Brillengläser sehr viel größer erschienen, fixierten mich noch immer. Ein seltsamer Ausdruck lag in ihnen. Dann wurde mir klar, was der Blick besagte. Der Mann hatte Angst.
Ich weiß noch, dass mich diese Erkenntnis ziemlich verdutzte. Dieser Mann hatte Angst vor mir – ich, der ich mein Lebtag Angst vor anderen gehabt hatte, war also imstande, Furcht einzuflößen! Am liebsten hätte ich laut gelacht. Gleichzeitig ärgerte ich mich aber, denn ich ahnte schon, was passiert war. Der Mann hatte meinen Farbfilm mit einem gewöhnlichen Entwickler behandelt und damit ruiniert.
»Ist alles in Ordnung mit dem Film?«
Er nickte heftig.
»Ja, ja. Er muss nur noch trocknen. Wenn Sie mir freundlicherweise Ihren Namen und die Anschrift nennen, schicke ich meinen Sohn mit dem fertigen Film vorbei.«
»Schon gut. Ich komme später wieder.«
»Es ist überhaupt kein Aufwand, Monsieur.«
Seine Stimme klang sonderbar gezwungen. In Gedanken zuckte ich mit den Schultern. Wenn der Mann den Film versaut hatte und eine kindische Angst davor hatte, sein Missgeschick einzugestehen, dann war das nicht mein Problem. Ich selbst hatte mich mit dem Verlust meiner Fotoexperimente schon abgefunden.
»Na schön.« Ich nannte ihm Namen und Adresse.
Laut wiederholte er die Angaben, während er sie notierte.
»Monsieur Vadassy, Hôtel de la Réserve.« Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sagte dann, nicht mehr ganz so laut: »Ich werde Ihnen den Film bringen lassen, sobald er fertig ist.«
Ich bedankte mich und trat zur Tür. Ein Mann mit Strohhut und einem schlechtsitzenden schwarzen Anzug stand draußen. Da der Gehsteig schmal war und der Mann keinerlei Anstalten machte, mir Platz zu machen, schob ich mich mit einer leisen Entschuldigung an ihm vorbei. In diesem Moment legte er mir eine Hand auf den Arm.
»Monsieur Vadassy?«
»Ja?«
»Ich muss Sie bitten, aufs Kommissariat mitzukommen.«
»Wieso das denn?«
»Bloß eine kleine Passformalität, Monsieur.« Er war unbeirrbar höflich.
»Sollte ich dann nicht meinen Pass aus dem Hotel holen?«
Statt zu antworten, sah er nur an mir vorbei und nickte fast unmerklich. Eine Hand packte meinen anderen Arm. Ich blickte über meine Schulter. Hinter mir im Laden stand ein uniformierter Polizist. Der Drogist war verschwunden.
Die Hände schoben mich nicht allzu sanft vorwärts.
»Das verstehe ich nicht«, sagte ich.
»Sie werden schon verstehen«, sagte der Kriminalbeamte. »Allez, file!«
Er war jetzt nicht mehr höflich.