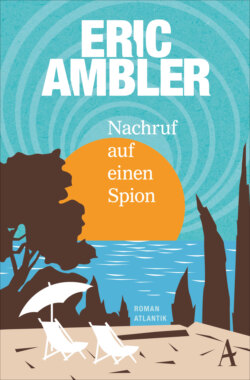Читать книгу Nachruf auf einen Spion - Eric Ambler - Страница 6
4
ОглавлениеAn die nächsten zwei Stunden kann ich mich nur schwach erinnern. Ich weiß aber, dass es, als ich mein Zimmer betrat, nur eine einzige Frage gab, die mich interessierte – ob am Sonntagnachmittag ein Zug von Toulon nach Paris fuhr. Ich entsinne mich, dass ich rasch zu meinem Koffer lief und fieberhaft nach dem Fahrplanheft suchte.
Dem Leser mag es merkwürdig erscheinen, dass ich in einer so schwierigen, fast ausweglosen Situation an derart banale Dinge wie die Zugverbindungen nach Paris dachte. Aber die Menschen verhalten sich in Stresssituationen eben merkwürdig. Während auf einem sinkenden Schiff die letzten Rettungsboote ablegen, laufen Passagiere in ihre Kabinen, um völlig unwichtige Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Sterbende denken im Angesicht des Todes an nicht bezahlte Rechnungen.
Was mich beunruhigte, war die Aussicht, dass ich mich am Montagvormittag verspäten würde. Monsieur Mathis legte großen Wert auf Pünktlichkeit. Über Verspätungen regte er sich furchtbar auf. Dies äußerte sich in bissigen, lautstarken Bemerkungen, die er peinlicherweise immer in Gegenwart von Dritten vorbrachte. Seine Standpauke kam meist auch mehrere Stunden nach der Missetat. Die Spannung konnte sehr enervierend sein.
Wenn ich am Sonntagnachmittag in Toulon einen Zug erwischte und über Nacht fuhr, würde ich eventuell rechtzeitig eintreffen. Ich weiß noch, mit welcher Erleichterung ich feststellte, dass es einen Zug gab, der am Montagmorgen um sechs in Paris ankam. Meine Gedanken bewegten sich wie in einem Nebel. Beghin hatte gesagt, dass ich am Samstag nicht abreisen konnte. Furchtbar! Monsieur Mathis würde wütend sein. Ob ich rechtzeitig in Paris war, wenn ich am Sonntag abfuhr? Ja, Gott sei Dank! Alles war gut.
Wahrscheinlich hätte ich ungläubig gelacht, wenn mir in diesem Moment jemand gesagt hätte, dass ich an dem Sonntag nicht würde abreisen können. Mein Lachen hätte allerdings hysterisch geklungen, denn während ich auf dem Fußboden neben dem geöffneten Koffer saß, spürte ich Angst in meiner Brust, mein Herz klopfte laut, und mein Atem ging kurz und heftig wie nach einem schnellen Lauf. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass sich mein Herz beruhigen würde, wenn ich ständig schluckte. Daraufhin wurde ich so durstig, dass ich nach einer Weile aufstand, zum Waschbecken ging und aus dem Zahnputzglas etwas Wasser trank. Dann ging ich wieder zurück und stieß den Deckel des Koffers mit dem Fuß zurück. Dabei fühlte ich Beghins Zettel in der Hosentasche. Ich setzte mich aufs Bett.
Bestimmt eine gute Stunde hockte ich da und starrte stumpfsinnig auf Beghins Liste. Immer wieder las ich die Namen, die sich in Chiffren, nichtssagende Buchstabenreihen verwandelten. Ich schloss die Augen, öffnete sie und las von neuem. Diese Personen waren mir unbekannt. Ich hatte erst einen Tag im Hotel verbracht, das von einem großen Park umgeben war. Bei den Mahlzeiten beschränkte ich mich darauf, den anderen Gästen zuzunicken. Da ich mir Gesichter nur schlecht merken kann, hätte ich auf der Straße vermutlich keinen wiedererkannt. Aber eine dieser Personen auf der Liste hatte meine Kamera. Eine dieser Personen, die mir zugenickt hatten, war ein Spion. Einer von ihnen hatte den Auftrag, in militärisches Sperrgebiet einzudringen und Fotos von Beton und Geschützen zu machen, damit eines Tages Kriegsschiffe draußen auf See den Beton und die Geschütze exakt beschießen und mitsamt den Soldaten, die sie bedienten, ausschalten konnten. Und ich hatte zwei Tage Zeit, um herauszufinden, wer diese Person war.
Ihre Namen, dachte ich einfältig, sahen ganz unverdächtig aus.
| Monsieur Duclos, Robert | Franzose | Nantes |
| Monsieur Roux, André | Franzose | Paris |
| Mademoiselle Martin, Odette | Französin | Paris |
| Monsieur Skelton, Warren | Amerikaner | Washington, D.C. |
| Mademoiselle Skelton, Mary | Amerikanerin | Washington, D.C. |
| Monsieur Vogel, Walter | Schweizer | Kreuzlingen |
| Madame Vogel, Hilda | Schweizerin | Kreuzlingen |
| Major Clandon-Hartley | Engländer | Buxton |
| Madame Clandon-Hartley, Maria | Engländerin | Buxton |
| Monsieur Schimler, Emil | Deutscher | Berlin |
| Köche, Albert (Hoteldirektor) | Schweizer | Schaffhausen |
| Köche, Suzanne (Ehefrau) | Schweizerin | Schaffhausen |
Eine vergleichbare Gästeliste hätte man in fast jedem kleinen Hotel in Südfrankreich aufstellen können. Da war der unvermeidliche englische Offizier mit Frau. Die beiden Amerikaner waren nicht ganz so unvermeidlich, aber keineswegs ungewöhnlich. Da waren die Schweizer und ein paar Franzosen. Der einzelne Deutsche fiel auf, aber nicht allzu sehr. Und verheiratete Schweizer Hoteldirektoren waren gang und gäbe.
Was sollte ich tun? Wann sollte ich anfangen? Dann erinnerte ich mich an Beghins Auftrag. Ich sollte herausfinden, wer von den Gästen eine Kamera besaß, und dann Bericht erstatten. Eifrig beschloss ich, sofort ans Werk zu gehen.
Am einfachsten war es, die Gäste, einen nach dem anderen oder paarweise, in ein Gespräch zu verwickeln und irgendwann auf das Thema Fotografieren zu sprechen zu kommen. »Übrigens«, würde ich sagen, »waren Sie das, den ich neulich beim Knipsen gesehen habe?« »Nein«, würde die Antwort lauten, »ich besitze gar keine Kamera« oder »Ja, aber ich glaube, die Aufnahmen werden nichts. Meine Schnappschüsse taugen nie etwas.« »Das kommt auf die Kamera an«, würde ich listig, aber nicht ganz wahrheitsgemäß erwidern. »Vielleicht haben Sie recht«, würde der Betreffende antworten. »Ich habe nur eine billige Box.«
Aber nein, so würde es nicht funktionieren. Zum einen entwickeln sich Gespräche nie in der von mir erwarteten Weise, und meistens falle ich auf die Rolle des Zuhörers zurück. Und es gab noch einen zweiten Einwand. Angenommen, der Spion hatte bereits entdeckt, dass seine Fotos fehlten, dass auf seinen Fotos nicht Beton und Geschütze zu sehen waren, sondern bunte Szenen eines Volksfestes in Nizza. Selbst wenn er nicht sofort erkannte, dass er die Kamera eines anderen hatte, würde er wissen, dass etwas schiefgegangen war und dass er aufpassen musste. Jeder Versuch, ihn in ein Gespräch über Fotografie zu verwickeln, würde ihm verdächtig erscheinen. Ich musste vorsichtiger vorgehen. Ich brannte darauf, aktiv zu werden.
Ich schaute auf die Uhr: Viertel vor sieben. Von meinem Fenster aus sah ich, dass der Strand noch belebt war. Ich erkannte ein Paar Schuhe und einen kleinen Sonnenschirm. Ich kämmte mir die Haare und ging hinaus.
Manchen Menschen fällt es sehr leicht, Bekanntschaften zu schließen. Sie besitzen eine rätselhafte Anpassungsfähigkeit, sodass sie sich rasch auf die Denkweise anderer Menschen einstellen können. In kürzester Zeit werden die Interessen der anderen zu ihren eigenen. Sie lächeln. Die anderen erwidern das Lächeln. Sie stellen eine Frage, sie antworten. Man kommt sich näher. Wenig später plaudert man angeregt über Belanglosigkeiten.
Dieses sympathische Talent ist mir nicht gegeben. Ich mache den Mund überhaupt nur auf, wenn ich angesprochen werde. Selbst dann bin ich unsicher und will unbedingt nett sein, sodass ich entweder zu steif oder zu förmlich oder aber zu überschwänglich bin. Aus diesem Grund werde ich für mürrisch oder arrogant oder für einen Schauspieler gehalten.
Doch als ich zum Strand hinunterstieg, sagte ich mir, dass ich zumindest dieses eine Mal meine schüchterne Art überwinden musste. Selbstsicher und freundlich wollte ich sein, mir amüsante Bemerkungen ausdenken, die Unterhaltung geschickt lenken. Mir stand ein gutes Stück Arbeit bevor.
Der kleine Strand lag jetzt vollständig im Schatten, und eine schwache Meeresbrise bewegte die Baumwipfel. Aber es war noch immer sehr warm. Über dem oberen Rand der Liegestühle sah ich von hinten die Köpfe von zwei Männern und zwei Frauen. Und während ich mich der letzten Treppenstufe näherte, hörte ich, dass sie versuchten, sich auf Französisch zu unterhalten.
Ich setzte mich ein paar Meter von ihnen entfernt auf eines der Gestelle, die zum Aufbocken der Boote dienten, und blickte hinaus auf die Bucht.
Beim Hinsetzen hatte ich mich rasch umgeblickt. In den beiden Liegestühlen, die mir am nächsten waren, saßen ein junger Mann von etwa dreiundzwanzig und eine junge Frau von etwa zwanzig. Sie trugen Badesachen, und natürlich waren es ihre Beine, die ich am Morgen von der Terrasse aus gesehen hatte. Dem Französisch der beiden entnahm ich, dass sie die Amerikaner waren, Warren und Mary Skelton.
Die beiden anderen dagegen waren schon etwas älter und ziemlich dick. Ich erinnerte mich, sie schon einmal gesehen zu haben. Der Mann hatte ein feistes Mondgesicht und einen Leib, der von weitem wie eine Tonne anmutete. Dieser Eindruck rührte vielleicht auch von seiner Hose her, die aus dunklem Stoff war und kurze, schmale Beine hatte. Kräftige Träger hielten die Hose so hoch, dass der Bund fast unter den Achselhöhlen saß. Der Mann trug ein Tennishemd mit offenem Kragen und kein Jackett. Er erinnerte an eine Simplicissimus-Karikatur. Seine Frau war etwas größer als er und ebenfalls nicht sehr geschmackvoll gekleidet. Sie lachte viel, und selbst wenn sie nicht gerade lachte, schien es, als würde sie im nächsten Moment losprusten. Ihr Mann strahlte mit ihr um die Wette. Es war das Schweizer Ehepaar. Beide wirkten so unbedarft und naiv wie zwei kleine Kinder.
Anscheinend war Skelton gerade dabei, Vogel das politische System der USA zu erklären.
»Il y a«, sagte er angestrengt, »deux partis seulement, les Républicains et les Démocrates.«
»Oui, je sais bien«, meinte Vogel unbekümmert, »mais quelle est la différence entre les deux? Est-ce que les Républicains sont des socialistes?«
Die beiden jungen Amerikaner stöhnten entsetzt auf. Die Schweizer bogen sich vor Lachen. Mary Skelton setzte die Darstellung fort. Ihr Französisch war jedoch kaum besser als das ihres Bruders.
»Mais non, Monsieur. Ces sont du droit – tous les deux. Mais les Républicains sont plus au droit que les Démocrates. Ça c’est la différence.«
»Il n’y a pas de socialistes aux Etats-Unis?«
»Si, il y en a quelques-uns, mais ils s’appellent …« Sie zögerte und wandte sich hilfesuchend an ihren Bruder. »Sag, was heißt Radikale auf Französisch?«
»Versuch’s mit radicals. Wahrscheinlich kommt es hin.«
»On les appelle radicals«, sagte die junge Frau unsicher.
»Ah oui, je comprends«, sagte Vogel und übersetzte den letzten Satz sofort ins Deutsche. Seine Frau grinste breit.
»Man hört«, fuhr er in seinem abgehackten Französisch fort, »dass die Gangster großen Einfluss auf die Wahlergebnisse haben. Wie eine Partei der Mitte, vielleicht?« Jetzt tat er wie jemand, der von belanglosem Geplauder allmählich zu wichtigeren Dingen kommen wollte.
Das Mädchen kicherte hilflos. Ihr Bruder holte tief Luft und erklärte sehr ernsthaft und zu Vogels deutlicher Verwunderung, dass 99,9 Prozent aller Amerikaner noch nie einen Gangster gesehen hätten und dass John Dillinger kein typischer Amerikaner sei. Doch sein Französisch ließ ihn bald im Stich.
»Il y a sans doute«, räumte er ein, »une quantité de … quelque …« Er kam nicht weiter. »Mary«, sagte er entnervt, »was heißt Mauschelei?«
In diesem Moment kam mir der Zufall zu Hilfe. Mag sein, dass der Lehrerberuf einem zur Gewohnheit wird, dass der pädagogische Impuls in ähnlicher Weise gesellschaftliche Schranken überwindet wie Hunger oder Durst. Ich weiß nur, dass ich aus den Augenwinkeln sah, wie das Mädchen hilflos mit den Schultern zuckte, und dass mir fast im selben Moment das Wort chantage über die Lippen kam.
Alle starrten mich an.
»Oh, danke«, sagte das Mädchen.
Die Augen ihres Bruders leuchteten interessiert auf.
»Hey, sprechen Sie Französisch und Englisch?«
»Ja.«
»Dann könnten Sie diesem alten Trottel hier neben uns vielleicht erklären, dass Gangster in Amerika nicht so furchtbar wichtig und dass sie im Kongress nicht vertreten sind, jedenfalls nicht offen«, sagte er ein wenig schroff. »Und wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie ihm noch erklären, dass wir Amerikaner nicht ständig Angst vor einer japanischen Invasion haben, dass wir uns nicht nur von Konserven ernähren und dass wir nicht alle im Empire State Building wohnen.«
»Gern.«
Das Mädchen griente.
»Mein Bruder meint es nicht so ernst.«
»Und ob ich es ernst meine! Der Alte tickt ja nicht richtig. Jemand sollte ihm mal die Meinung sagen!«
Die Vogels hatten diesen Wortwechsel verständnislos lächelnd beobachtet. Ich übersetzte möglichst taktvoll. Sie wieherten vor Lachen. Vogel wies darauf hin, dass man bei Amerikanern einfach nicht anders könne, als sie aufzuziehen. Eine Gangsterpartei! Das Empire State Building! Wieder lachten sie. Die Schweizer waren offenbar doch nicht so naiv, wie sie aussahen.
»Was ist denn jetzt in ihn gefahren?«, wollte Skelton wissen.
Er grinste, als ich es ihm erklärte.
»Dabei wirken sie so harmlos, was?«, sagte er und beugte sich vor, um die Vogels genauer zu studieren. »Mein ganzes Menschenbild ist erschüttert. Woher kommen die beiden? Aus Deutschland?«
»Nein, aus der Schweiz.«
»Der Mann sieht echt wie eine Witzfigur aus«, sagte das Mädchen. »Weshalb trägt er denn diese komische Hose?«
»Sind wohl in der Schweiz so üblich«, sagte ihr Bruder.
Der Gegenstand dieser spöttischen Bemerkungen betrachtete uns aufmerksam. Schließlich sagte er zu mir:
»Hoffentlich haben uns diese jungen Leute unseren kleinen Spaß nicht übelgenommen.«
Der junge Skelton guckte überrascht, als ich es ihm übersetzte.
»Ach was. Schauen Sie …« Er wandte sich an die Vogels. »Nous sommes très amusés«, sagte er aufgeräumt. Und dann: »Vous êtes … Himmel, sagen Sie ihm, es ist schon okay.«
Ich übersetzte. Alle nickten und lächelten. Dann sprachen die Vogels miteinander.
»Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich?«, fragte Skelton.
»Fünf.«
Er schnaubte unwirsch.
»Dann erklären Sie mir bitte«, warf seine Schwester ein, »wie man eine fremde Sprache lernt. Nicht fünf, eine reicht schon. Wenn Sie sich darauf beschränken könnten, würden mein Bruder und ich das sehr gern erfahren.«
Eine peinliche Situation. Ich murmelte, dass man in dem betreffenden Land leben und ein Ohr für Sprachen entwickeln müsse, und fragte dann, ob sie schon lange im Réserve seien. Ich hätte sie bei den Mahlzeiten nicht gesehen.
»Ähm, wir sind seit etwa einer Woche hier«, erwiderte er. »Unsere Eltern kommen nächste Woche mit der Conte di Savoia herüber. Wir treffen uns mit ihnen in Marseille. Und Sie? Sie sind erst seit Dienstagabend hier, stimmt’s?«
»Ja.«
»Deshalb haben Sie uns nicht gesehen. Wir frühstücken nämlich meistens auf dem Zimmer, und gestern haben wir uns von Köche einen Wagen geliehen und sind den ganzen Tag herumgefahren. Ist echt prima, dass wir uns mit Ihnen auf Englisch unterhalten können. Köches Englisch ist zwar ganz gut, aber er gibt zu schnell auf. Ansonsten haben wir nur diesen englischen Major und seine Frau. Er ist arrogant, und sie macht überhaupt nie den Mund auf.«
»Wissen Sie«, sagte seine Schwester, »bei Warren muss man zäh sein.«
Mir fiel auf, dass die junge Frau nicht besonders hübsch, in gewisser Weise aber ziemlich attraktiv war. Der Mund war zu breit, die Nase nicht ganz ebenmäßig, das Gesicht flach, die Wangenknochen waren etwas zu stark. Aber wenn sie die Lippen bewegte, strahlte sie Witz und Klugheit aus, und die Nase und die Wange hätten einen Maler fasziniert. Ihre Haut war straff, rein und gebräunt, und ihr dichter dunkelblonder Haarschopf schimmerte eindrucksvoll. Ich fand jetzt, dass sie richtig schön war.
»Leider sind die Franzosen gleich so furchtbar beleidigt, wenn man ihre Sprache fehlerhaft spricht. Ich jedenfalls bin nicht sauer, wenn ein Franzose kein gutes Englisch spricht.«
»Das liegt daran, dass die meisten Franzosen den Klang ihrer Sprache lieben. Schlechtes Französisch hören sie genauso ungern wie einen Anfänger auf der Geige.«
»Es ist zwecklos, ihm mit Musikalität zu kommen«, meinte das Mädchen. »Er spielt Mundharmonika, wenn man ihn lässt.« Sie stand auf und strich sich den Badeanzug glatt. »Also, ich glaube, wir sollten uns noch etwas überziehen.«
Vogel stemmte sich hoch, schaute auf eine riesige Taschenuhr und verkündete auf Französisch, dass es Viertel nach sieben sei. Dann zog er sich die Hose noch höher und begann, seine Sachen und die seiner Frau einzusammeln. Wir marschierten zur Treppe. Der junge Amerikaner ging vor mir.
»Übrigens«, sagte er unterwegs, »ich habe Ihren Namen nicht verstanden.«
»Josef Vadassy.«
»Ich heiße Skelton. Das ist meine Schwester Mary.«
Doch ich hörte kaum zu. Über Vogels breitem Rücken hing eine Kamera, und ich versuchte mich zu erinnern, wo ich ein solches Modell schon einmal gesehen hatte. Dann fiel es mir wieder ein. Es war eine Voigtländer Box.
An warmen Abenden wurde das Essen auf der Terrasse serviert. Dazu wurde eine gestreifte Markise ausgerollt, und kleine Tischlampen spendeten Licht. Wenn alle Tische beleuchtet waren, sah es richtig romantisch aus.
Ich hatte beschlossen, an diesem Abend als Erster auf der Terrasse zu sein, denn einerseits hatte ich großen Hunger, andererseits wollte ich die anderen Gäste in Ruhe beobachten. Drei saßen jedoch schon auf ihren Plätzen, als ich eintraf.
Ein einzelner Mann hatte einen Tisch hinter dem meinen, sodass ich ihn nur würde sehen können, wenn ich mich auf meinem Stuhl ganz umdrehte. Auf dem Weg zu meinem Platz versuchte ich daher, mir möglichst viel von diesem Mann einzuprägen.
Die Lampe auf seinem Tisch und der Umstand, dass er sich über seinen Teller beugte, verhinderten, dass ich mehr von ihm sah als den Kopf mit kurzen blonden Haaren, zur Seite gekämmt, scheitellos. Er trug ein kurzärmeliges weißes Hemd und eine sehr französisch aussehende Leinenhose. Das musste entweder André Roux oder Robert Duclos sein.
Ich setzte mich und wandte meine Aufmerksamkeit den beiden anderen zu.
Sie saßen ziemlich steif da. Der Mann hatte einen schmalen Kopf, grau meliertes braunes Haar und einen gestutzten Schnurrbart. Ihm gegenüber saß eine teilnahmslose Frau mittleren Alters mit kräftigen Knochen, blassem Teint und gepflegten weißen Haaren. Beide hatten sich zum Essen umgezogen. Sie trug eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock, er eine graue Flanellhose, ein braunes gestreiftes Hemd mit Krawatte sowie ein grobkariertes Tweedjackett. In diesem Moment legte er den Suppenlöffel beiseite, nahm eine Flasche billigen Rotwein vom Tisch und hielt sie gegen das Licht.
»Ich glaube, meine Liebe«, hörte ich ihn sagen, »der neue Kellner trinkt von unserem Wein. Beim Mittagessen habe ich die Flasche eindeutig markiert.«
Er hatte eine durchdringende Stimme, und sein Englisch verriet eindeutig, dass er aus der oberen Mittelschicht kam. Die Frau zuckte nur leicht mit den Achseln. Offensichtlich war sie anderer Meinung als er.
»Meine Liebe«, erwiderte er, »es geht mir ums Prinzip. Der Kerl gehört zusammengestaucht. Ich werde mal ein Wörtchen mit Köche reden müssen.«
Wieder zuckte sie mit den Achseln und tupfte sich mit der Serviette den Mund. Schweigend setzten sie die Mahlzeit fort. Offensichtlich handelte es sich bei ihnen um Major Clandon-Hartley und Ehefrau.
Mittlerweile waren auch die anderen Gäste eingetroffen.
Die Vogels saßen an einem Tisch hinter den beiden Engländern, direkt am Terrassengeländer. Ein anderes Paar steuerte auf den Tisch an der Wand zu.
Diese beiden waren unverkennbar Franzosen. Der Mann – dunkelhaarig, glupschäugig und unrasiert – sah wie fünfunddreißig aus. Seine Begleiterin, eine magere Blondine, die einen Hosenanzug aus Satin und als Ohrschmuck traubenförmige Kunstperlen trug, mochte etwas älter sein. Sie wirkten sehr verliebt. Als er ihr den Stuhl zurechtschob, streichelte er ihren Arm, woraufhin sie leicht seine Finger drückte und sich verstohlen umschaute, um zu sehen, ob die anderen Gäste es bemerkt hatten. Ich sah, dass sich die beiden Schweizer über diese Szene insgeheim amüsierten. Vogel zwinkerte mir von weitem zu.
Die Blonde, sagte ich mir, war vermutlich Odette Martin, ihr Begleiter entweder Duclos oder Roux.
Als Nächste kamen die beiden Amerikaner. Sie nickten freundlich und setzten sich an einen Tisch rechts hinter mir.
Schließlich kam der letzte Gast, ein älterer Mann mit weißem Bart und einem Kneifer, den er an einem breiten, schwarzen Band trug.
Als der Kellner meinen Suppenteller abräumte, gab ich ihm ein Zeichen.
»Monsieur?«
»Wer ist der weißbärtige Herr dort?«
»Das ist Monsieur Duclos.«
»Und der Herr mit der blonden Dame?«
Der Kellner lächelte diskret.
»Das sind Monsieur Roux und Mademoiselle Martin.« Das »Mademoiselle« betonte er leicht.
»Aha. Und wer ist Monsieur Schimler?«
Er runzelte die Stirn.
»Schimler, Monsieur? Einen Gast solchen Namens gibt es im Réserve nicht.«
»Sind Sie sicher?«
»Ganz bestimmt, Monsieur«, sagte er etwas steif.
Ich blickte über meine Schulter.
»Wer ist der Herr am letzten Tisch dort?«
»Das ist Monsieur Paul Heinberger, ein Schweizer Schriftsteller. Er ist mit Monsieur Köche befreundet. Nehmen Sie Fisch, Monsieur?«
Ich nickte, er eilte davon.
Einen kurzen Moment lang saß ich reglos da. Dann suchte ich, ruhig, aber mit zitternder Hand, in meiner Tasche nach Beghins Liste, versteckte sie in meiner Serviette und las sie sorgfältig.
Doch ich kannte sie schon auswendig. Der Name Heinberger stand nicht darauf.