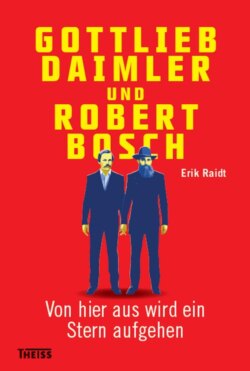Читать книгу Gottlieb Daimler und Robert Bosch - Erik Raidt - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gehirnerweichung bei rasanter Zugfahrt – Herbst 1845
ОглавлениеAm Schafott enden Geschichten, aber in Württemberg will man jetzt eine neue Geschichte schreiben. Eine, die in die Zukunft weist. Sie erfordert eine gewaltige Mobilmachung, bei der kein einziger Soldat in Marsch gesetzt wird. Zum Einsatz kommt stattdessen ein ganzes Heer von Arbeitern: Die Eisenbahn versetzt Deutschland spätestens seit ihrer Jungfernfahrt von Nürnberg nach Fürth in eine fiebrige Fortschrittserwartung, in der sich Hoffnungen und Ängste vermischen. Doch bevor sich in Stuttgart auch nur ein Rad auf einer Schiene dreht, bricht Streit aus: Braucht die Stadt überhaupt einen Bahnhof? Wo soll man ihn bauen? Wer soll das alles bezahlen? Das Neckartal ist angesichts dieser gewaltigen Herausforderung auch ein Tal der Ahnungslosen. Nach einer jahrelangen Debatte hat der württembergische König Wilhelm I. schließlich doch noch das Eisenbahngesetz unterschrieben und damit einen Schlusspunkt gesetzt: Die Bahn kommt. Basta.
Nun beginnt ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, ohne das Stuttgart endgültig von der modernen Wirtschaftswelt abgehängt würde. Da -von sind zumindest der König und die Regierung überzeugt. Für den Schienenanschluss der Residenzstadt werden Bäume gefällt, Schienen verlegt und Tunnels gegraben. Was auf die Bauarbeiter im Untergrund alles zukommt, weiß niemand so genau. Nach allem Streit, trotz aller Bedenken, beginnt das große Graben – nicht für Stuttgart 21, sondern für das Großprojekt Stuttgart 1845.
Das Königreich sucht nach externem Sachverstand, nach einem Mann, der sich mit der neuen Technik auskennt. Ein Schwabe scheidet wohl von vornherein aus, schließlich fährt hierzulande noch keine Eisenbahn. Die württembergische Regierung sondiert den Markt und erhält aus Paris und Wien schließlich den entscheidenden Tipp: Die Wahl fällt auf Carl Etzel, der zu diesem Zeitpunkt gerade 33 Jahre alt ist. Der Ingenieur ist zuvor in leitender Funktion beim Bau der Eisenbahnlinie von Paris nach St. Germain beteiligt gewesen, und er ist gebürtiger Stuttgarter. Vor Carl Etzel liegt eine Herkulesaufgabe.
Das Problem ist die Stadt selbst, ihre Topografie ist ein Albtraum. Der Stuttgarter Innenstadt geht es nicht besser, als einem Damenkörper: Sie ist eingezwängt in ein Korsett. Doch im Fall der Stadt sind es keine Korsettstangen, die sie in ihre Form pressen, es sind bis zu 230 Meter hohe Hügel, die Stuttgart nach Süden, nach Westen und nach Osten hin begrenzen. Nur in Richtung Cannstatt, zum Neckartal hin, ist der Weg frei – und genau über jene Schneise will Carl Etzel die Stadt an die Moderne anschließen.
Der Weg dahin ist vertrackt. Eine Aktiengesellschaft beauftragt den Ingenieur mit dem Bau der Eisenbahnlinie von Stuttgart nach Cannstatt, jenem frühen Wellnesszentrum, das als mondäne Bäderstadt ein Publikum aus ganz Europa anzieht. Etzel veröffentlicht eine Denkschrift, die unter anderem klären soll, ob im Schienenbetrieb besser Dampflokomotiven oder Pferdebahnen eingesetzt werden sollen. Für Württemberg, schreibt Etzel, sei der Pferdebahnbetrieb völlig ausreichend. Dieser Schluss ist für ihn beinahe unumgänglich, wenn man weiß, wer ihn zu dieser Denkschrift angestiftet hat: eine Pferdebahngesellschaft. Wird die Muskelkraft die Maschinen schlagen?
Noch tickt im Königreich Württemberg die Uhr nicht so laut, noch hat der Zeitgeist sich nicht mit dem Spruch „time is money“ verheiratet. So darf Carl Etzel in seiner Denkschrift zum Tempo der Eisenbahnen ungestraft behaupten: „Dem Passagier, welcher zu seinem Vergnügen reist, wird eine Geschwindigkeit von zwei teutschen Meilen [15 km/h] in der Stunde durch das fruchtbare, blühende Württemberg eher zu groß als zu klein dünken. Die Anzahl derer, welche im inländischen Verkehr mit höherer Geschwindigkeit reisen wollen, ist in Wahrheit sehr klein, weil in Teutschland, zumal in Südteutschland, die Zeit unendlich geringeren Werth hat als in England oder Amerika.“
Der Irrtum gehört zur Grundausstattung des Fortschritts. Carl Etzel wird in wenigen Jahren klüger sein und lernen, dass die Uhren auch in „Südteutschland“ in einem immer schnelleren Takt gehen: im Takt der Maschinen und der Fahrpläne. Unterdessen macht der Bau des neuen Bahnhofs in der Schlossstraße Fortschritte, genau wie die Verlegung der Schienen. Am 3. Oktober 1845 überzeugt sich König Wilhelm I. bei einer Probefahrt mit der Lokomotive Neckar, in einem eigens aus Philadelphia herbeigeschifften amerikanischen Musterwagen, persönlich von der Eisenbahn. Fein hierarchisch sortiert folgen nun die Bahnpremieren der übrigen gesellschaftlichen Schichten: Zwei Tage nach dem König unternimmt der Finanzminister gemeinsam mit hohen Staatsbeamten eine Fahrt. Ende des Monats darf endlich das Volk einsteigen: Die Bahnlinie von Cannstatt nach Untertürkheim wird eröffnet.
Um das Neue begreifen zu können, bedienen sich die Menschen des Altbekannten. Kein Wunder, dass die Lokomotiven sich im Volksmund in Dampfrösser verwandeln – was sonst als die Fortbewegung in der Kutsche und auf dem Pferderücken ist den Menschen geläufig? Noch vor wenigen Jahren ist das Wort „Tunnel“ im deutschen Sprachraum weitgehend unbekannt gewesen. Wenn man in die Tiefe vordrang, war von unterirdischen Straßen oder Stollen die Rede. Die Menschen müssen sich in diesen Spätherbsttagen 1845 an die Eisenbahn erst gewöhnen. Noch ahnen nur wenige, wie schnell sich ihr Leben und ihr Alltag verändern werden. Was eben noch außer Reichweite lag, liegt plötzlich nur noch wenige Fahrtstunden entfernt.
Von dieser Erfolgsgeschichte werden viele profitieren. Auch König Wilhelm I. sieht eine Chance, sich zeitgemäß und der Zukunft zugewandt zu präsentieren: Ende November 1845 besteigt er, nachdem er die erste Probefahrt unbeschadet überstanden hat, erstmals mit seiner Familie die Eisenbahn. Eine Menschenmenge säumt die Strecke, die Fahrt wird zum PR-Triumph. Als der König in Esslingen die Bahn verlässt und sich ins Rathaus begibt, läuten die Glocken.
Die alte Residenzstadt Stuttgart erwacht zu neuem Leben. Als sich am 26. November 1845 eine frühe Dunkelheit über den Talkessel senkt, finden die Einwohner ihre Stadt verändert vor. In dieser Nacht wird erstmals die Gasbeleuchtung in Betrieb genommen. Die Presse ist beeindruckt: „Die schönen hellen Gasflammen gewähren gegenüber den bisherigen Öllampen eine bedeutend größere Helle.“
Schon bald brennen rund 450 Wandlaternen in den Straßen, die Abend für Abend von Laternenanzündern in Betrieb genommen werden. An den ersten Abenden lockt das Schauspiel Hunderte von Zuschauern auf die Straße. Den Anzündern folgt eine johlende Kinderschar.
Ist dieses Licht auch das Licht einer aufgeklärten Zeit? Mit einer Mixtur aus Taschenspielertricks und technischem Schnickschnack lässt sich jederzeit ein Publikum finden. So kündigt das Neue Tagblatt den Auftritt des Zauberers Ludwig Winter an, der schon einmal die Menschen in der Stadt begeisterte und nun erneut mit seiner „physikalisch-magischen Bühnenshow“ in Cannstatt auftreten soll: „Wir wünschen Herrn Winter nur Glück, dem neunzehnten Jahrhundert anzugehören, das ihn höchstens mit Lorbeerkränzen erdrücken wird“, schreibt der Chronist und fügt hinterlistig hinzu: „Wäre er sein Urgroßvater, man würde ihn als Hexenmeister schon längst verbrannt haben.“
Magie und Ingenieurskunst scheinen manchmal zwei Seiten einer Medaille zu sein – auch beim Eisenbahnbau. Das bekommt der Ingenieur Carl Etzel zu spüren: Während er noch rechnet, zeichnet und vermisst, melden sich die Herren eines honorigen Medizinalkollegiums zu Wort. Sie haben zur Eisenbahndebatte Wichtiges beizutragen: Die schnelle Bewegung bei der Zugfahrt werde bei den Passagieren „unfehlbar eine Gehirnerkrankung erzeugen“. Andere Skeptiker karikieren die Eisenbahn, sie zeichnen sie als eine Spinne, die ihre Opfer zu ersticken droht.
Mit den Befürchtungen der Mediziner kann sich Etzel nicht länger aufhalten. Ihm steht die schwierigste Operation beim Eisenbahnbau bevor: Die Pionierfahrten haben die Eisenbahnlinie am Neckar entlang erschlossen, aber der wichtigste Baustein im großen Masterplan fehlt noch. Stuttgart ist vom Fortschritt noch immer abgehängt. Zwischen dem Cannstatter Bahnhof und dem Stuttgarter Bahnhof, der fast fertig gebaut ist, steht der Eisenbahn ein Hügel im Weg. Was hier aufragt, ist nicht irgendein Hügel, es handelt sich um den Rosenstein, den ein Landhaus des Königs krönt. Carl Etzel hegt einen ungeheuerlichen Plan. Er will die neue Eisenbahnlinie in einem Tunnel direkt unterhalb von Schloss Rosenstein hindurchführen. Der Hofstaat schäumt: Majestätsbeleidigung! So nah darf dieses bürgerliche Projekt dem imperialen Glanz niemals kommen. Und überhaupt – kein Mensch könne die Risiken überschauen. Es schlägt die Stunde der Zweifler und Bedenkenträger. Sollte die Eisenbahn nicht besser oben bleiben?
Carl Etzel beschwichtigt im Tonfall eines kühlen Technikers, der sich von laienhaft argumentierenden Skeptikern nichts vorschreiben lassen will. „Dass dem Schlosse von einem Tunnel keine Schäden drohen, dafür bürgt die Sicherheit und Schnelligkeit, mit der man in neuerer Zeit derartige Arbeiten ausführt.“ Doch die Bauarbeiten halten für Etzel noch unliebsame Überraschungen bereit. Von beiden Seiten aus beginnen die Grabungen für den Rosensteintunnel: Die Tunnelmünder werden von einem Bretterzaun geschützt, die Ingenieure bestellen 200 Zentner gereinigtes Rapsöl – den Brennstoff benötigen sie, um die Baustelle zu beleuchten. Dann dringen die Arbeiter in den Berg vor. Sie mauern das Tunnelgewölbe aus Sandsteinen direkt gegen das Gestein, die kritischen Stellen sichern sie mit Gusseisenplatten.
Doch im Fortschritt steckt oft der Wurm drin, weil vieles erstmals gedacht und geplant, aber noch nie zuvor gemacht worden ist. So steckt der selbstbewusste Ingenieur Carl Etzel kurz nach den feierlichen Jungfernfahrten zwischen Cannstatt und Untertürkheim im Schlamassel. Während die Arbeiten an den Außenmauern des neuen Bahnhofs in der Schlossstraße weit fortgeschritten sind, liegen die wahren Probleme im Untergrund verborgen. Die Arbeiten am Prag- und am Rosensteintunnel, die die Stadt der Hügel mit der Außenwelt verbinden sollen, sind ein kompliziertes Stück Ingenieurskunst.
Mit dem Eisenbahnbau bricht eine ganz neue Zeit der Großprojekte an – eindrucksvolle Neubauten zeigen, wie sich die gesellschaftlichen Machtverhältnisse in einigen europäischen Ländern verschieben: Im Mittelalter waren gotische Kathedralen himmelsstürmend emporgewachsen, beauftragt von mächtigen Kirchenmännern. Noch im 18. Jahrhundert hatten weltliche Herren mit neuen Schlössern und Palästen die vermeintlich gottgleiche Rolle des Adels Stein für Stein erlebbar werden lassen. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts bröckelt – trotz aller Selbstinszenierungen – die höfische Macht. Es sind die neuen Bahnhöfe, die in allen europäischen Großstädten den Menschen vor Augen führen, wohin die Reise gehen wird. Sie sind nicht nur Kathedralen des Fortschritts. In ihnen flanieren die Herren – und erst mit Jahren Verspätung auch immer mehr Damen – einer gesellschaftlichen Klasse, die nun den Ton angeben will: die des Bürgertums.
Aber kann diese Fortschrittseuphorie gut gehen? Muss nicht bald jemand auf die Bremse treten, bevor sich hinter der nächsten Ecke ein Abgrund auftut, weil die Technik von den Menschen letztlich doch nicht zu beherrschen ist? Vielen wird unwohl zumute, auch einem Journalisten des Neuen Tagblatts, den es schaudert, „vor dem herkulischen Muthe, dem unbegreiflichen Unterfangen, mitten durch den Rosensteinberg hindurch und so wenig tief unter dem Schlosse hinweg einen solch weiten und hohen Tunnel anzulegen. Was man sagen mag, es ist und bleibt dieser Tunnel ein Wagstück, das als solches schon kaum verantwortet werden kann“. Technik und Risiko, riskante Technik – der Artikel gibt eine leise Vorahnung davon, welche Debatten eine hoch industrialisierte Gesellschaft einmal prägen werden.
Der Ingenieur Carl Etzel hält die Technik für beherrschbar. Doch am 18. Januar 1846 kommen die Dinge beim Schloss Rosenstein ins Rutschen. Unterhalb des Schlosses schreiten die Arbeiten an der Tunnelröhre voran, aber die Ingenieure haben an der Oberfläche etwas Wichtiges übersehen: den Seerosenteich im Innenhof des Schlosses. Dessen Wasser weicht das Erdreich auf, sodass es im 363 Meter langen Rosensteintunnel zu einem Schlammeinbruch kommt. Die Arbeiter fliehen ans Tageslicht und müssen anschließend mühsam überredet werden, an den Unglücksort zurückzukehren.
Das Unglück bedeutet für die Baustelle: Nichts geht mehr. Carl Etzel muss sich in einem neuen Job beweisen, in dem des Krisenmanagers. Der Ingenieur nutzt seine freundschaftlichen Kontakte zu König Wilhelm I., der ihm eine Audienz gewährt. Etzel sieht nur eine Chance, die Panne zu beheben: Er muss beim König erreichen, dass er vom Schloss aus nach unten graben kann, um den Hohlraum zu versiegeln, durch den immer mehr Schlamm in die Tunnelröhre eindringt. Die Bitte ist gewagt, eigentlich sogar unerhört. Doch Etzel hat Glück, und der König stimmt zu. Vom Souterrain des Schlosses aus dringen Arbeiter bis in den Hohlraum vor – eine lebensgefährliche Operation.
Schicht für Schicht füllen sie eine Mischung aus schwarzem Kalk und Beton in den Hohlraum, schließlich gelingt es ihnen, das Leck abzudichten. Nach einer fünfmonatigen Zwangspause können die Arbeiter die Tunnelröhre endlich weiter vorantreiben. Carl Etzel will jetzt nichts mehr dem Zufall überlassen und mit aller Macht weitere Pannen verhindern. Anfang Juli 1846 schreibt er dem Finanzministerium einen Brief: Bevor das Publikum erstmals mit der Bahn durch Stuttgart fahre, müssten weitere Probefahrten stattfinden, um die Bremsen des Zugs beim Bergabfahren und auch die Brücken zu überprüfen. Weil er nach dem Schlammeinbruch Kritik einstecken musste, will Etzel sicherstellen, dass das Schloss keinen Schaden nimmt, wenn unter ihm Lokomotiven durch die Röhre hindurchdonnern. Etzel stellt im Schloss eine mit Quecksilber gefüllte Schale auf – als sich die Quecksilberoberfläche nur leicht trübt, während ein Zug im Tunnel das Schloss unterquert, atmet der Ingenieur auf: Der Eisenbahnbetrieb wird das Schloss nicht gefährden.
Am 16. Oktober 1846 begünstigt schönstes Wetter die Premierenfahrt der Eisenbahn nach Stuttgart, wie der Journalist des Schwäbischen Merkurs anderntags notiert. In Cannstatt, in Esslingen und in Ludwigsburg strömen Menschenmassen zu den Bahnhöfen, um das Schauspiel einer einfahrenden Lokomotive zu bestaunen. In Esslingen spielt die Stadtmusik, an den Schranken des Bahnhofs wehen die Fahnen der Zünfte und Fabriken im Wind. Medizinische Horrorereignisse werden nicht überliefert: Bei keinem der Fahrgäste kommt es zu den befürchteten Gehirnerweichungen. Als Nebenwirkungen sind nur gelegentliche Anfälle von Poesie zu verzeichnen. Ein Hofrat notiert nach der Fahrt bewegt: „Jetzt bohrt sich das Feuer speiende Ungetüm in den Bauch des Berges, und wir verschwinden in gähnender Nacht“. Wenig später jedoch taucht der Passagier aus der Dunkelheit schon wieder auf, „mit zauberhafter Kraft und Schnelle, die Haare fliegend im Wind, das Herz pochend vor Reise- und Lebenslust“. Derart ergriffen geht es dem Ziel entgegen: Stuttgart.
Nachmittags erreichen die Bahnreisenden die Metropole. In Stuttgart wird im ersten Haus am Platz, unmittelbar neben dem neuen Bahnhof, das Festmahl ausgerichtet. Der erste Toast wird auf den Landesvater ausgesprochen. Man lobt die Einsicht König Wilhelms I. in die Notwendigkeiten des Fortschritts, man würdigt das Durchhaltevermögen. Rund 250 Gäste im Saal des „Hotel Marquardt“ heben die Gläser, bis ihnen die Arme lahm werden: Ein Toast reiht sich an den nächsten. Die Eisenbahn ist ein Versprechen auf eine bessere Zeit. Sie rückt die Kohlevorräte aus dem Ruhrgebiet in greifbare Nähe. Die Menschen nutzen die von Stuttgart aus fortführenden Schienen erst für Vergnügungsfahrten, aber nach und nach wird die Eisenbahnlinie zu einer Nabelschnur für die ganze Region. Noch kann kaum einer der Feiernden im Hotel Marquardt voraussehen, wie das Erfolgsmodell aussehen wird. Es lässt sich in einem Satz verdichten: Rohstoffe werden kommen, Produkte werden die Stadt verlassen.
Dank der Eisenbahn verändert sich der Alltag der Menschen. Die Bahn macht die Massen mobil. In diesen Anfängen eines neuen Transportmittels liegt der Keim für ein Ende: Die Postkutschen, die ihre Fahrten oft mit dem Zusatz „Express“ vermarkten, kommen den Menschen bald sehr langsam vor. Noch spüren das die stolzen Wagenbauer kaum, die in Stuttgart Kutschen für den Hofstaat und die feinen Leute bauen. Bei allem Fortschritts-Tamtam in jenen Jahren – so schnell ändern sich die Dinge nicht. Es werden noch vier Jahrzehnte vergehen, bevor Gottlieb Daimler mit einem geheimen Hintergedanken die Werkstatt eines Wagenbauers im Stuttgarter Bohnenviertel betritt. Doch Mitte der 1840er-Jahre scheint der Gedanke an eine Kutsche ohne Pferde absurd, obwohl längere Reisen in einer Postkutsche einer Folter gleichkommen können, wie ein weit gereister Verleger notiert: „Das unbequeme enge Sitzen oft bei schwüler Luft, das langsame Fortrutschen mit phlegmatischen und schlaffen Postknechten, der oft pestialische Gestank unsauberer Reisegesellschafter, das Tabakdampfen und die zotigen schmutzigen Reden der ehrsamen bunten Reisekompanie, lassen uns bald das Vergnügen satt werden und verursachen gänzliches Übelfinden an allen Gliedern. Wer acht Tage so gefahren ist, wird fast ein anderer Mensch geworden sein: wunderlich, träge, gelähmt am ganzen Körper, wachend wird er schlafen, die Augen eingefallen, das Gesicht aufgedunsen, der Magen ohne Appetit, der Geist abwesend, und wie im Taumel redend.“ Eine weitere Nebenwirkung des Reisens in Kutschen: die anschließende Neigung zu Übertreibungen.
Im Zug kann der Reisende weder nach Belieben anhalten noch auf freier Strecke aus einer Eingebung heraus abbiegen. Der Passagier ist einem übergeordneten Strecken- und Fahrplan unterworfen, der an höherer Stelle von den Eisenbahngesellschaften für ihn entworfen wird. Der neue Stuttgarter Bahnhof spiegelt dabei den Blick seiner Planer und Finanziers auf die Gesellschaft: Im Mittelgang befinden sich zwischen den Gleisen die Wartesäle. Der Hofstaat wartet sorgsam abgetrennt vom gemeinen Volk, Durchlaucht hat vom Eingang aus selbstverständlich den kürzesten Fußweg. Es folgen der Wartesaal für die erste, die zweite und die dritte Klasse, jeweils mit eigener „Restauration“ – wer in der dritten Klasse reist, der möge sich am Buffet für die Fahrt stärken. Sortiert wird nicht nur nach gesellschaftlichen Schichten, sortiert wird auch der Verkehr: So kommen die einfahrenden Züge auf Drehscheiben an, wo sie auf ein anderes Gleis gesetzt werden, um von dort aus den Bahnhof wieder zu verlassen.
Binnen weniger Wochen spielt sich der Betrieb ein, eine ausgeklügelte Logistik hält alles am Laufen. Die ersten Zehntausend Reisenden sind mit dem Zug gefahren, bald werden sie kaum mehr für möglich halten, dass es jemals anders war. Der Bahnhof und die auf ihn zulaufenden Gleise prägen nun auch das Stadtbild, die Station befindet sich in unmittelbarer Nähe des Neuen Schlosses. Durch den Neubau wird den Einwohnern der Stadt täglich vor Augen geführt, dass moderne Zeiten angebrochen sind. Mit den Lokomotiven kommen nicht nur die Lokführer: In den Reparaturwerkstätten arbeiten Techniker, die Passagiere begegnen Schaffnern und Bahnwärtern. Die Vernetzung der Welt schreitet immer schneller voran. Sie wird noch exakter vermessen. Bevor Schienen verlegt und Bahnhöfe gebaut werden können, muss das Terrain geprüft werden. Briten und Amerikaner bauen Miniaturmodelle von Brücken, um deren Tragfähigkeit zu testen.
Auf den größten Baustellen der Welt arbeiten Mitte des 19. Jahrhunderts mehr als 15.000 Menschen gleichzeitig. Wenn die Schienen verlegt werden, folgt alles einer festgelegten Choreografie: Hinter den Gleisverlegern rücken Hämmerer und Verschrauber nach – der Bau der Eisenbahnen ähnelt einem Feldzug. Ingenieure und Facharbeiter treiben Tunnel durch Berge, schütten Dämme auf und überwinden Flüsse mit Brückenkonstruktionen. Die Baustellen werden zu komplex, um die Regie dem Zufall zu überlassen. In wenigen Jahren schon wird der Bau der Eisenbahnstrecken in immer entlegenere Gebiete vorrücken, er wird vielen Menschen zu Arbeit verhelfen und etliche Menschenleben kosten. Der Fortschritt hat seinen Preis.
Aber er öffnet den Menschen auch Erlebniswelten, zu denen sie vorher keinen Zugang besaßen: Der junge Gottlieb Daimler wächst in einer Zeit auf, in der die räumliche Distanz zwischen Stuttgart und Tübingen oder zwischen München und Berlin natürlich gleich bleibt – für die Reisenden jedoch schrumpfen die Distanzen zwischen Start- und Zielpunkt dramatisch. Wer seiner Neugier folgt und den Fortschritt nicht nur im heimatlichen Bahnhof bewundern will, der reist nun quer durchs Land, quer durch Europa. Das hat dramatische Folgen: Der Wissensfluss strömt schneller als jemals zuvor.
Die Welt steht unter Dampf. Die Technik treibt Landmaschinen, Eisenbahnen und gewaltige Ozeandampfer an. Die Maschinen stampfen, zischen und toben. Dieses Orchester fasziniert nicht nur Erwachsene, es begeistert auch viele Kinder. Keine Generation zuvor ist mit solchen Wundern groß geworden, wie sie nun der zwölfjährige Gottlieb Daimler in Schorndorf und der zweijährige Carl Benz in Karlsruhe sehen.
Beim kleinen Carl spielt die Eisenbahn 1846 Schicksal: Sein Vater, Lokomotivführer bei der badischen Staatsbahn, zieht sich am Führerstand der Dampflok eine Lungenentzündung zu und stirbt. Carl Benz wächst mit den Erzählungen seiner Mutter über den Vater und über die Eisenbahn auf. Abends steigt der Junge fauchend wie eine Dampflok ins Bett, um morgens ebenso fauchend wieder aufzustehen. Sehr viel später wird sich Carl Benz an seine Kindheitstage erinnern: „Ich bin stolz auf diesen Mann, der auf einer der ersten Lokomotiven Badens einer neuen Zeit entgegenfuhr, jener Zeit, die ein eisernes Schienennetz um den Erdball spannte.“
Der junge Carl Benz träumt viel von der Eisenbahn, der zehn Jahre ältere Gottlieb Daimler träumt davon, was aus ihm werden könnte, wenn er die Schule verlassen wird. Seine Kindheitszeichnungen verraten einiges über ihn. Er zeichnet nicht nur akkurat und präzise, er ist auch ein kreativer Kopf. Der Junge denkt Bekanntes weiter und schöpft daraus Neues.
Carl Benz und Gottlieb Daimler wachsen in einer Eisenbahnwelt auf, in der sich die Menschen in festgelegten Spuren von einem Ort zum anderen fortbewegen.
Werden schnelle Fahrzeuge eines Tages ohne Schienen fahren? Davon kann Mitte des 19. Jahrhunderts noch keine Rede sein. Das Königreich Württemberg hat mit dem Bau der Eisenbahnlinien wichtige Weichen gestellt, doch seine Einwohner sind noch längst nicht aus dem Gröbsten heraus. Immer wieder erwächst aus Missernten nur die Not. Viele sehen in der Auswanderung den einzigen Ausweg. Zwischen 1841 und 1865 verlassen 240.000 Menschen Württemberg, weil sie den amerikanischen Traum träumen, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal diesen Namen trägt. Der Aderlass schwächt viele europäische Nationen: In Irland werden die Menschen 1845/46 nach einer Kartoffelfäule von einer Hungersnot geplagt, die rund eine Million Todesopfer fordert. Die folgende Massenauswanderung hat vor allem ein Ziel: Nordamerika. Dort ist das Streben nach Glück zum Staatsziel geworden. Für viele liegt das größte Versprechen Amerikas aber nicht in der Aussicht auf Reichtum. Das größte Versprechen lautet: Freiheit und Demokratie.