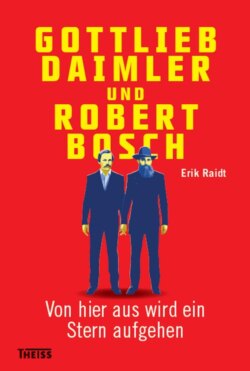Читать книгу Gottlieb Daimler und Robert Bosch - Erik Raidt - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Diese Schlange in Menschengestalt“ – Sommer 1845
ОглавлениеFür die Presse bietet der Mord ein gefundenes Fressen. Das Neue Tagblatt schreibt sich im Stil eines Boulevardblatts in Rage: „Stuttgart, das gegenwärtig so rasch voraneilt und bald in Nichts mehr den großen Städten Deutschlands nachsteht, hat leider nun auch eine Giftmischerin … Wer diese Schlange in Menschengestalt sieht, hält es für unmöglich, dass so viel Schlauheit in ihrem Schädel wuchert, so viel Bosheit in ihrem Herzen und ein solcher Grad an Verworfenheit in ihrem ganzen Wesen.“
Der Fall, der den Zeitungsmann moralisch durchschüttelt, hat eine verschlungene Vorgeschichte, er ereignet sich im Herzen Stuttgarts. Dort leben der Goldarbeiter Eduard Ruthardt, seine Frau Christiane und ihr gemeinsamer Sohn. Christiane Ruthardt ist als uneheliche Tochter bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Ihre Herkunft ist über Jahre hinweg in einem Dickicht abenteuerlicher Gerüchte verborgen geblieben. Sie solle, so heißt es zwischenzeitlich, die Tochter eines Seiltänzers sein. Die junge Frau arbeitet als Dienstmädchen. Als sie von einer Dienstherrin 400 Gulden erbt, heiratet sie dank dieser Mitgift.
Doch der Mann, der sie vor den Traualtar führt, erweist sich für ihre Träume von einem geregelten bürgerlichen Leben als Fehlbesetzung. Eduard Ruthardt, angestellt in einer Stuttgarter Fabrik, strebt nach Höherem: Er kauft Bücher und Geräte, er will als Erfinder ein Teil jenes Fortschritts sein, von dem in diesen Jahren so oft die Rede ist. Doch seine Tüftlergeschichte ist eine, die nur vom Scheitern erzählt. Eduard Ruthardt bringt das Geld seiner Frau mit seinen hochfliegenden Plänen durch. Ruthardt macht Schulden, seine Frau verzweifelt an ihm, sie wähnt sich an der Seite eines Taugenichts. Not macht erfinderisch? Bei den Ruthardts hat der Mann nichts anderes als die Not erfunden.
Christiane Ruthardt sieht keinen anderen Ausweg, als den Gatten umzubringen. Die unglückliche Frau besinnt sich auf List und Tücke. Sie besucht mehrere Ärzte, gibt dabei vor, gegen eine Rattenplage ankämpfen zu wollen und bittet um ein geeignetes Mittel: Arsen. Einer der Ärzte stellt ihr schließlich den Giftschein aus, mit dem sie das Mittel in einer Apotheke erhält. Die Ruthardt mischt das Arsen ihrem Mann bald in kleinen Dosen in die Suppe, was die gewünschte Wirkung nicht verfehlt. Erst leidet der Gatte, dann befindet er sich kurzfristig auf dem Weg der Besserung, nur um doch noch an den Folgen der Vergiftung zu sterben. Der Tod hat ihn auf Raten ereilt. Die Gattin kann nicht lange die trauernde Witwe spielen: Sie wird nur wenige Stunden nach dem Tod ihres Mannes von einem Polizeidiener festgenommen und auf das Kriminalamt Stuttgart gebracht, weil sich ihr Interesse an Arsen herumgesprochen hat.
Die Hauptverhandlung findet vor dem Criminal-Senat des Königlichen Gerichtshofs in Esslingen statt. Dort spricht die 40 Jahre alte Frau offen über ihre Motive und darüber, wie sie innerlich erst vom Scheitern ihres Mannes und dann von den daraus resultierenden Schulden gequält wurde: „Mir war es eine Pein, einem Menschen unter die Augen zu treten, dem ich, was ich schuldete, zu rechter Zeit nicht geben konnte. Begegnete mir ein solcher auf der Straße, und war es mir nicht möglich, auszuweichen, so drückte mich sein Anblick fast zu Boden. Ich war es nie gewöhnt, Schulden zu haben und mich von Gläubigern verfolgt und gedrängt zu sehen.“
Christiane Ruthardts Gattenmord wirft einen Schatten auf einen schillernden Mythos: auf den, des heldenhaften und ruhmreichen Erfinders. Die Geschichte vieler Erfinder handelt keineswegs von Durchbrüchen und Welterfolgen, sie erzählt von Fehlversuchen und Irrwegen. Und oft davon, dass eine gute Idee nichts wert ist, wenn sie nicht vermarktet werden kann. Am Ende steht für viele Erfinder die Erkenntnis: aus, ohne Applaus.
Warum sollte auch ausgerechnet dem biederen Schwaben Eduard Ruthardt das Kunststück gelingen, mit Erfindungen reich zu werden? Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Schwabe der technischen Brillanz gänzlich unverdächtig – im Königreich Württemberg gilt die harte Feldarbeit etwas und nicht zweifelhafte gedankliche Turnübungen. Der typische Schwabe ist kein Erfindergenie – er ist Kuhbauer. In zeitgenössischen Kommentaren lässt man diesem schwäbischen Mängelexemplar seine Fortschrittsvergessenheit gerade noch durchgehen: „Sein hartnäckiges Festhalten an dem Alten und Herkömmlichen“, lässt sich „zwar nicht leugnen, aber leicht entschuldigen.“
Als Eduard Ruthardt vergeblich nach dem Fortschritt fahndet, ist der schwäbische Erfinder noch nicht erfunden worden. Wohl aber die Lachnummer. Niemand kann so tief fallen wie derjenige, der sich zu Höherem berufen fühlt und mit dem Alten und Herkömmlichen radikal bricht. Während die Geschichte der Meuchelmörderin Christiane Ruthardt gerade zu neuem Legendenstoff wird, erzählt man sich im Württemberg des Jahres 1845 immer noch gerne die Geschichte eines Mannes, der als Erfinder die Bodenhaftung verlor: Sie handelt von Albrecht Ludwig Berblinger, besser bekannt als der Schneider von Ulm.
Berblinger wuchs in bescheidenen Verhältnissen in einem Waisenhaus auf, nachdem er früh seinen Vater verloren hatte. Er begann eine Schneiderlehre, stellte sich außergewöhnlich geschickt an und legte bereits mit 21 Jahren die Meisterprüfung ab. In seiner Heimatstadt Ulm hätte aus ihm ein allseits geachteter Bürger werden können. Doch Berblinger wollte mehr, und er konnte auch mehr. Er war fasziniert von der Technik künstlicher Gelenke und stellte für das Ulmer Hospital Prothesen her. Als der Schneider aus den Zeitungen erfuhr, dass in ganz Europa tollkühne Männer versuchten, mit Apparaten den Himmel zu erobern, war es um ihn geschehen. Berblinger wollte der fliegende Schneider von Ulm werden, dieser Traum beherrschte ihn.
Am 24. April 1811 setzte er eine Ankündigung in die Schwäbische Chronik: „Nach einer unsäglichen Mühe in der Zeit mehrerer Monate, mit Aufopferung einer sehr beträchtlichen Geldsumme und mit Anwendung des rastlosen Studiums der Mechanik hat der Unterzeichnete es dahin gebracht, eine Flugmaschine zu erfinden, mit der er in einigen Tagen in Ulm seinen ersten Versuch machen wird.“ Berblinger zweifelte nicht im Geringsten am Gelingen des Projekts. Mehrere Kunstsachverständige hätten ihn in seiner Auffassung bestärkt. Er stellte seine Flugmaschine im Gasthof „Zum Goldenen Kreuz“ aus. Jeder, der dies wollte, sollte sich dort ein eigenes Bild von seinem Apparat machen und diesen prüfen.
Gut einen Monat später kam es zum Showdown. Die Stadt verbot dem Schneider, von einer Plattform des noch unvollendeten Münsters hinabzuspringen. Berblinger sollte stattdessen an der Donau abheben. Der Schneider ließ sich ein Holzgestell als Rampe bauen. Am entscheidenden Tag legte er seine mechanischen Flügel an, erblickte unter sich eine enorme Menge an Zuschauern und trippelte nervös auf und ab. Als er nach einigem Hin- und Herrudern mit seinen künstlichen Flügeln endlich absprang, landete er wie von einem Mühlstein hinabgezogen im Fluss. Schiffer zogen den Unglücksraben aus der Donau. Der Absturz überlebte er zwar, nicht aber die Häme seiner Zeitgenossen. Berblinger musste zahllose Spottgedichte und Lieder ertragen, die Schneiderzunft schloss ihn aus. Am Ende blieben ihm Gelegenheitsarbeiten, er flüchtete sich in den Alkohol und das Kartenspiel. Albrecht Ludwig Berblinger starb einsam und verarmt. Niemand sah in ihm einen Flugpionier, der Schneider von Ulm galt allen nur als Luftikus.
Aber lagen sie damit wirklich richtig? Berblingers Flugversuch war eine riskante One-Man-Show. Der Schneider von Ulm arbeitete auf eigenes Risiko und eigene Rechnung, er hatte keinen Sponsor und kein Team aus kompetenten Mitarbeitern, das ihn unterstützte. 150 Jahre nach Berblingers Plumps in die Donau bauten die Ulmer dessen Flugapparat entsprechend den alten Skizzen nach. Sie stellten fest, dass der Schneider mit dem Gerät durchaus hätte fliegen können – wenn nur bei seinem Jungfernflug die Windverhältnisse günstiger gewesen wären. Seine Zeitgenossen hielten ihn wegen des Flugversuchs für verrückt. Ähnlich wird es vielen Menschen 200 Jahre später ergehen, als ein Mann ankündigt, im freien Fall aus dem Weltraum auf die Erde herabzuspringen. Der eine scheitert, der andere triumphiert. Und oft fehlt dem Gescheiterten nur ein wenig Glück zum Triumph. Zu Lebzeiten des Schneiders von Ulm sauste über dem Mann das Fallbeil der öffentlichen Meinung herab: Er starb einen Tod auf Raten, sein Leben wurde vergiftet durch die gesellschaftliche Ächtung.
Grenzen zu überschreiten ist mitunter lebensgefährlich. Wer etwas wagt, das noch kein anderer vor ihm gewagt hat, etwas denkt, das noch keiner vor ihm gedacht hat – der bewegt sich auf dünnem Eis. Dennoch: Nicht jeder gescheiterte Erfinder muss damit rechnen, von der eigenen Frau umgebracht zu werden. In Württemberg lockt der Prozess gegen die Giftmischerin Christiane Ruthardt die Massen an. Weil sich am Verhandlungstag eine Unmenge von Fremden einfindet, kommt es in den umliegenden Wirtshäusern zu einem schwunghaften Handel mit Eintrittskarten. Das Publikum verlangt nach Sühne, und es wird nicht enttäuscht. Im Namen des Königs verurteilt das Gericht Christiane Ruthardt zum Tode durch Enthauptung und zur Bezahlung der Prozesskosten. Zum letzten Mal wird ein Todesurteil vor den Toren Stuttgarts öffentlich vollstreckt.
Am Abend vor der Hinrichtung stellt sich die Stadt auf das Blutgericht ein. Man gibt öffentlich bekannt, dass niemand seine Kinder vor und nach der Hinrichtung der Ruthardt auf die Straße lassen solle. Die Bevölkerung fasst dies als Einladung auf. Am frühen Morgen des 27. Juni 1845, einem Freitag, ist die halbe Stadt auf den Beinen. Natürlich stehen viele Menschen genau in jenen Straßen, vor denen sie am Abend zuvor von den Behörden gewarnt wurden. Um vier Uhr morgens wird Christiane Ruthardt durch die Menschenmenge geführt. Ein Chronist beschreibt ihren Auftritt. Sie trägt ein hellgraues Kleid, dazu ein in mattem Rot durchwirktes Halstuch. In der abgemagerten Hand hält sie ein Tuch. Ihr Gesicht: undurchdringlich kalt, blass und wie aus Marmor – so wirkt sie zumindest auf den Beobachter.
Mit erstaunlicher Ruhe, so der Augenzeuge, steigt sie allein die Treppen des Stuttgarter Rathauses hinauf, bis sie in den kleinen Saal im ersten Stock gelangt. Dort wird ihr zum letzten Mal das Urteil verkündet, bevor ihr der Stab symbolisch zu Füßen geworfen wird: „Ihr habt euer Leben verwirkt, Gott sei eurer Seele gnädig!“ Ob sie einen letzten Wunsch habe? Die Giftmischerin wünscht sich einen würdevollen Tod: Ihre Hinrichtung solle still vor sich gehen, sie wolle nicht zur „Schau ausgestellt“ werden. Von nun an befindet sie sich in den Händen des in einen roten Mantel gehüllten Scharfrichters. Er führt sie aus dem Saal und besteigt mit zwei Diakonen eine von Stadtreitern flankierte Kutsche. Während das Armesünderglöcklein läutet, setzt sich der Zug langsam in Bewegung. Zahllose Menschen folgen dem Zug der Verurteilten, an dessen Spitze glänzende Uniformen zu sehen sind. Bald erreicht der Tross die Feuerbacher Heide. Eingebettet zwischen zwei Erdhügeln des Militärschießplatzes steht hier das Schafott.
Ein Zeitungschronist des Schwäbischen Merkur sieht zu: „Mit festem Schritt bestieg die Unglückliche das Schafott und hielt eine eindringliche Rede an das Volk. Die Zahl der Anwesenden war groß, doch die Haltung ruhig und ernst.“ Ein anderer Augenzeuge am Richtplatz beschreibt später die letzten Minuten im Leben der Christiane Ruthardt. Sie faltet die Hände, steckt sie schließlich „wie es schien, mit einigem Unwillen in die Bande“ hinein, bevor ihr eine Ledermaske um das Gesicht gebunden und sie durch einen Riemen am Stuhl befestigt wird. Nun fasst der Gehilfe des Vollstreckers ihren Kopf, während jener selbst das Schwert anhebt. Ein letzter Angstschrei aus der Menge: „Halt!, Halt!“ Er bewirkt nichts mehr.
Es ist geschehen. Der Scharfrichter zeigt der Menge ihren Kopf.
An diesem Sommertag weht nicht der Wind des Fortschritts durch Stuttgart – vor den Schaulustigen wird ein letztes Mal ein blutiges Spektakel aufgeführt, dessen Traditionen weit in die Geschichte zurückreichen. Darüber reden die Menschen auch in der Back- und Weinstube in der Schorndorfer Höllgasse, in der der Schuljunge Gottlieb Daimler ein- und ausgeht. Wie zeitgemäß ist in Württemberg eigentlich noch die Todesstrafe?
Der Fall Ruthardt bringt keine gute Presse. Er wächst sich zum handfesten Skandal aus, als bekannt wird, unter welchen Umständen der Leichnam der Enthaupteten ins Anatomische Institut der Universität Tübingen gelangt: Auf halbem Weg wird der Sarg geöffnet, Neugierige begaffen den Leichnam. In Tübingen steht der Sarg unbewacht im Hof der Anatomie. Volk dringt ein, wirft Christiane Ruthardts Kopf umher und schneidet ihr die Haare ab. Mit der Giftmörderin kennen die Menschen auch nach der Hinrichtung keine Gnade.
Nach der Schändung wird Kritik laut. Wie passt es zusammen, dass der Staat in die Bildung seiner Untertanen investiert – und gleichzeitig verurteilte Täter vor einem sensationslüsternen Publikum enthaupten lässt?