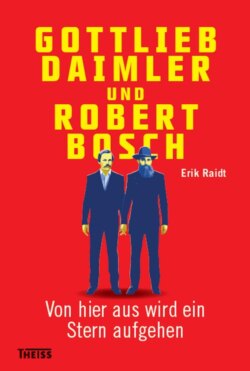Читать книгу Gottlieb Daimler und Robert Bosch - Erik Raidt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Herculeskäfer – 1845
ОглавлениеDie Kauwerkzeuge des Herculeskäfers verzweigen sich auf ausladende Weise. Sie ähneln Scherenhänden, jederzeit bereit, zuzupacken. Feine Striche zeigen auf dem Papier die Beine des Käfers, seine Schuppen – bei keinem Körperteil hat der Zufall Regie geführt. Der Käfermaler ist elf Jahre alt. Der Junge zeichnet gern, er zeichnet präzise, er will, dass die Dinge, die er aufs Papier bringt, ihren Platz haben. Genau wie in der Natur. Gottlieb Daimler erkennt in den Beinen, Klauen und Füßen des Käfers Teile eines Gesamtbauplans. Dieser versetzt das Tier in die Lage, zu krabbeln, seine Nahrung klein zu schneiden und sie zu fressen. Der Junge zeichnet präzise, das Bild, das auf dem Papier entsteht, verrät sein Talent, sich Dinge dreidimensional vorstellen zu können.
Gottlieb Daimler besucht 1845 in seiner Geburtsstadt Schorndorf die Lateinschule. Immer sonntags nimmt er zudem Zeichenunterricht. Diese Stunden füllen bald ein Skizzenbuch, auf dessen Seiten Tiere aus der Alten und der Neuen Welt lebendig werden: ein Elch, ein Känguru, ein stolzer Sumpfhirsch, ein von seinem mächtigen Geweih schier erdrücktes Rentier, sowie eine Gottesanbeterin, die ihren Körper bedrohlich aufrichtet. Gottlieb Daimler zeichnet auch einen Erdhügel, den er als „Wohnungen der Termiten“ beschreibt, nicht ohne deren Königin Gestalt zu verleihen. Schon in diesen Kindheitstagen gibt er sich nicht damit zufrieden, nur die bloße Hülle eines Gegenstands oder eines Lebewesens zu sehen. Der Junge forscht in seinen Zeichnungen danach, wie Einzelteile eines Körpers als Teil eines Ganzen zusammenwirken. An einem Tierkörper lassen sich Gesetzmäßigkeiten erkennen, alles scheint einer Ordnung zu folgen. Es fällt dem Jungen leicht, sich davon ein Bild zu machen. Es wird ihm später ungleich schwerer fallen, sich vom Wesen der Menschen ein ähnlich genaues Bild zu machen. Sie bleiben für ihn oft unberechenbar und entziehen sich seinem logischen Verstand.
Der junge Gottlieb Daimler nimmt Zeichenunterricht. Sein Skizzenbuch zeigt, wie viel Wert er auf Genauigkeit legt – und wie viel Talent er besitzt.
Der Junge wächst in einem Fachwerkhaus in der Höllgasse 7 auf. Das Haus ist von bescheidener Größe, im Untergeschoss ist die Back- und Weinstube untergebracht, die Gottliebs Vater, der Bäcker Johannes Daimler, betreibt. Das schmale Haus steht unauffällig in der Gasse: Fensterläden, Butzenscheiben, Fachwerkbalken und nur ein gut armlanger Abstand zu den beiden Nachbarhäusern. Das Elternhaus ist keineswegs das stolzeste Gebäude im Viertel, das bescheidenste ist es auch nicht. In krummen Gassen stehen Giebelhäuser mit Sockeln aus Sandstein, über denen sich Fachwerkgeschosse erheben. Die Kinder, die hier aufwachsen, erleben die Stadt als Abenteuerspielplatz: Zwischen den Häusern öffnen sich versteckte Winkel, in denen die Jungen und Mädchen ihre Schlupflöcher finden. Die Kelter bietet Gottlieb Daimler und seinen Freunden, mit denen er sich nach der Schule trifft, Platz für Verstecke. Im Wallgraben vor dem Stadttor hüpfen Frösche herum, die sich den feuchten Lebensraum mit Salamandern teilen. Für die Kinder gibt es neben dem geheimnisvoll plätschernden Schorndorfer Höllbrunnen viel zu entdecken.
Gottlieb ist der zweitälteste von vier Brüdern, eine Schwester stirbt früh, sie wird nur ein halbes Jahr alt. Für die meisten Einwohner des Städtchens hält das Leben ein hartes Los bereit: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Schorndorf zu einer unbedeutenden Provinzstadt herabgesunken, eingezwängt in einen Festungsbau. Wie Plagen kommen Hungerjahre über die Stadt, verursacht auch durch Missernten. Oft deuten die Menschen diese als biblische Strafen – was sich mit dem Verstand nicht erklären lässt, wird als apokalyptisches Zeichen gesehen. Gottlieb Daimlers Vater Johannes ist 14 Jahre alt, als 1815 auf der indonesischen Insel Sumbawa der Vulkan Tambora ausbricht und eine gewaltige Staubwolke in die Atmosphäre emporschleudert. Beim stärksten Vulkanausbruch der jüngeren Geschichte sterben Zehntausende von Menschen in der näheren Umgebung – doch die Folgen der Eruption spüren Millionen von Menschen: Nordamerika und Europa erleben 1816 das „Jahr ohne Sommer“ – die Klimakatastrophe trifft vor allem die Bauern. Auch in Schorndorf verschärft die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts das ohnehin bestehende Elend.
Ein durchreisender Chronist jener Jahre beschreibt, dass die kärgliche Ernährung die Menschen in Schorndorf krank mache. Vor allem jene, die in den „ziemlich krummen, engen und schlechten Straßen“ unmittelbar hinter der Mauer wohnen. Immer wieder leiden die Menschen unter Infektionskrankheiten, Kinder werden von der Brechruhr heimgesucht. Noch 1844 ist die Lage so schlimm, dass fast in jedem Haus ein Kranker zu finden ist. Auch die Wirtschaft liegt auf der Intensivstation – mit ungewissen Aussichten auf Besserung. Der Mangel gehört zum Alltag, das räumt auch das Schorndorfer Oberamt ein: „daß … die Mehrzahl der Einwohner nicht mehr als ihr Auskommen hat, daß eine große Zahl um dasselbe mehr oder weniger kämpfen muß und daß eine bedeutende Zahl, welcher es gänzlich oder größtenteils fehlt, die öffentlichen Kassen namhaft in Anspruch nimmt“.
Die Heimat des jungen Gottlieb Daimler ist ein Armenhaus. Mehrmals zwingt die Hungersnot die Stadt dazu, eine öffentliche Suppenküche einzurichten. Die Jahre zwischen 1800 und 1860 sind für Schorndorf verlorene Jahre. Der einst blühenden Stadt bescheinigt ein Amtsarzt: „Schorndorf gehört zu den ärmsten Bezirken im Land.“ Bei den Feldarbeiten müssen die Kinder mithelfen, weshalb sie die Schule versäumen. Die Hände zählen, nicht das Hirn.
Der aus Reutlingen stammende Volkswirtschaftler Friedrich List berichtet, dass die „Nahrung der arbeitenden Classen“ in Deutschland die „roheste von der Welt“ sei. „An Weizenbrod und frisches Fleisch ist da nicht zu denken.“ Wer sich dem Schicksal nicht ergeben will, sucht verzweifelt nach Auswegen. An einen Aufstieg durch Bildung denken die wenigsten. Viele sehen ihre einzige Chance darin, die karge Heimat zu verlassen. Im Südwesten beginnt ein Massenexodus, infolgedessen ganze Dörfer aufgegeben werden, weil ihre Bewohner in den Vereinigten Staaten noch einmal ganz von vorn anfangen wollen. Auch viele Schorndorfer verlieren die Hoffnung, dass sich das Blatt jemals wieder wenden wird, und wandern nach Amerika aus.
Amerika präsentiert sich auf Werbeplakaten für die Auswanderer als Gelobtes Land: Aus einem goldenen Füllhorn quellen Bananen, Ananas und Trauben. Kalifornien, so verheißt es die Botschaft, biete nicht nur Land für eine Million Farmer, es biete auch ein gesundes Klima für Reichtum. Die Botschaft kommt an. Aus dem Südwesten strömen die Menschen über Jahrzehnte hinweg den Häfen am Atlantik und an der Nordsee entgegen. Von dort aus geht es weiter nach Westen, zuerst mit Segel-, in späteren Jahren immer öfter mit den schnelleren Dampfschiffen: volle Kraft voraus, dem amerikanischen Traum entgegen. Allein zwischen 1845 und 1854 wandern zehn Prozent der in Baden und Württemberg lebenden Menschen aus.
Diesem Elendskreislauf will Gottlieb Daimler entgehen, auch wenn seine Familie die schlimmste Not nicht selbst erleiden muss. Vor dem Jungen liegt ein Leben voller Höhen und Schlaglöcher. Sein Schulweg wird zum Beginn eines längeren Bildungswegs, bei dem sich Theorie und Praxis ergänzen. Wenn sich Gottlieb Daimler morgens auf den Weg zum Unterricht macht, läuft er über buckliges Kopfsteinpflaster und durch enge Gassen, in die nur im Sommer für längere Zeit die Sonne einfällt. Sie sind gerade breit genug, damit eine Kutsche durchfahren kann. Aus dunklen Winkeln kommend erreicht er nach wenigen Minuten den Marktplatz, wo sich all die krummen Straßen endlich zu einem Platz hin öffnen, auf dem das 1726 erbaute Rathaus steht. Autorität strahlt auch die Gaupp’sche Apotheke aus, die noch einige Jahrzehnte älter ist. Vom Marktplatz aus sieht Gottlieb den Turm der evangelischen Stadtkirche. Dort, gleich am Kirchplatz, beginnt morgens der Unterricht in der Lateinschule. Niemand ahnt, dass der Schüler viel später mit einem Apparat Furore machen wird, den sich jetzt noch kein Mensch vorstellen kann. Diese Erfindung wird den Namen Gottlieb Daimler weit jenseits der Befestigungsmauern von Schorndorf bekannt machen, über die Grenze des Königreichs Württemberg hinaus. Sie wird einen weltweiten Siegeszug antreten, der zuerst außerhalb des Deutschen Kaiserreichs in Frankreich Fahrt aufnimmt.
Eine schwäbische Erfolgsgeschichte? Ja – und nein, wie ein Blick auf den Stammbaum der Schorndorfer Familie Daimler zeigt. Im Jahr 1657 packte der 24-jährige Zimmermann Friedrich Teumler in einem Dorf in Thüringen seine Siebensachen, ließ seine Mutter und einen Bruder zurück und brach zu einer Wanderung auf, von der er nie wieder zurückkehren sollte. Er lief durch den Frankenwald und sah viel ödes und ausgeblutetes Land, das gebrandmarkt war von den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges. Nach vielen Tagesmärschen erreichte er einen hügeligen Landstrich, der ihn womöglich an die heimatlichen Berge im Vogtland erinnerte. Friedrich Teumler war im Dörfchen Schorndorf angekommen, das einst mit Schaufel und Spaten aus dem Schwäbischen Wald ausgerodet worden war. Hier, wie überall in Württemberg, standen zerstörte Häuser leer. In diesen harten Wiederaufbauzeiten brauchte das Land nichts dringlicher als tatkräftige junge Männer und Frauen, die bereit waren, für einen Neubeginn mit anzupacken. Zimmerleute standen besonders hoch im Kurs. So ließ sich Friedrich Teumler nieder und heiratete bald die Tochter eines Weingärtners und Ratsherren. Mit diesem Schritt begründete er eine Daimlerlinie, die fünf Generationen und rund 150 Jahre später zu den Eltern von Gottlieb Daimler führt.
Im Mai 1831 heiraten Johannes Daimler und Wilhelmine Friederike Finsterer – knapp drei Jahre später kommt Gottlieb am 17. März 1834 als zweiter Sohn des Paares auf die Welt. In der Ahnenreihe der Daimlers stehen brave Bäcker, Hutmacher und andere Handwerker, unter ihnen findet sich kaum einer, der sich besonders hervorgetan hat.
Nur zwei tanzen aus der Reihe. Dass es eine aufregende Welt jenseits der Höllgasse und der Schorndorfer Lateinschule gibt, erfährt der junge Gottlieb Daimler, wenn ihm seine Eltern von seinem Großvater erzählen. Johann Friedrich Daimler (1757–1825) hatte Schorndorf im Alter von 22 Jahren den Rücken gekehrt. Das Bäckerhandwerk, das er gelernt hatte, konnte warten. Johann Friedrich war die Welt in Schorndorf zu klein geworden, ihn zog es hinaus in die Ferne. Im Sommer 1779 heuerte er auf der holländischen Prinzeß Luisa an, einem stolzen Kriegsschiff mit 350 Matrosen und Soldaten. Wer der Prinzeß Luisa in den Weg kam, musste 54 Kanonen fürchten. Die erste Fahrt ging hinaus aufs Mittelmeer, und bald stellten sich jene Abenteuer ein, von denen Johann Friedrich daheim in der Höllgasse geträumt haben mag: An Deck stachen Matrosen mit Messern aufeinander ein, Seeräuber kreuzten den Weg und mussten mit Kanonendonner vertrieben werden.
In seinem Tagebuch schrieb der Maat, der in der Bordkantine Dienst tat, über Hafenstädte, die er vorher nur vom Hörensagen kannte. Was dem jungen Mann voller Abenteuerlust beim Landgang alles auffiel? Marseille: „Der Wein ware so roth als Blut und die französischen Jungfern so weiß als der Schnee.“ Malaga: Der süße Wein war so stark, dass „die größten Menschen auf den Boden geworfen“ wurden. Es blieb nicht beim Mittelmeer.
1782 heuerte Johann Friedrich Daimler erneut auf einem holländischen Kriegsschiff an, das gen Surinam in See stach, später weiterfuhr nach Venezuela, wo „die Mohren, sowohl Manns Leute, als Weibs Leute wie das Vieh nackend laufen, doch haben sie die Scham noch bedeckt“. In der Neuen Welt sah der Schorndorfer Bäcker auch den tropischen Regenwald, der ihm so undurchdringlich wie gefährlich vorkam: „lauter Wald, worinnen sich gräßliche wilde Tiere aufhalten, nämlich wilde Schweine, Tiegern, Affen, Papagayen, große Schlangen, Hirsche, Wölfe, Bären, Löwen und noch allerhand Sorten wilde Tiere“. Womöglich trug die Hitze das Ihre dazu bei, dass Johann Friedrich Daimler neben realen Tieren beim Tagebuchschreiben einige Trugbilder in die Zeilen gerutscht sind. „Es ware hier so grässlich warm, daß es nicht auszusprechen ist.“
Schließlich ging der schwäbische Seemann doch noch endgültig vor Anker – als Bäckermeister, Wirt und Ehemann. Nicht in Marseille oder Malaga, sondern in der Höllgasse in Schorndorf. Dort wird er später in weinseliger Runde von den Jugenderlebnissen erzählt haben. Seinen Enkelsohn Gottlieb lernt der weltläufige Opa nicht mehr kennen: Er stirbt 1825, neun Jahre vor Gottlieb Daimlers Geburt. Aber manche seiner Geschichten überleben ihn und machen im Wirtshaus weiter die Runde, auch der kleine Gottlieb hört von ihnen. Es sind Geschichten, die seine Fantasie anregen, die unglaublich klingen. Wie diese „gräßlichen wilden Tiere“ wohl aussehen mögen, die der Großvater alle gesehen hat? Sie bewohnen das Skizzenbuch des Schorndorfer Schülers. Grässlich sehen sie nicht aus. Gottlieb Daimler verfremdet beim Zeichnen die Hirsche und Käfer nicht, sein exakter Strich weicht nicht vom Vorbild ab – dem Jungen geht es darum, die Wirklichkeit abzubilden.
Neben dem abenteuerlustigen Großvater sticht ein weiterer Verwandter aus der Reihe der Daimlers hervor: Ein Onkel Gottlieb Daimlers beginnt zwar, wie so viele aus der Familie, ebenfalls als Bäcker. Schließlich sucht er sich jedoch einen anderen Broterwerb. Der Onkel wird Geometer, bringt es zum Stadtbaumeister und steckt seinen jungen Neffen mit seiner Vorliebe für alles Technische an. Im Taufbuch ist er als Taufzeuge vermerkt.
Wenn Gottlieb Daimler in seiner Kindheit und Jugend durch seine Nachbarschaft streift, entdeckt er überall kleine Handwerksbetriebe. Die meisten davon werden niemals jenseits der Schorndorfer Stadtmauern bekannt. Gottlieb Daimler sieht Küfer und Seifensieder, Schlosser und Dreher, Schuhmacher und Glaser. Die Wohnungen und die Werkstätten sind oft kaum voneinander zu trennen. In den Handwerkergassen herrscht Geschäftigkeit, aber es werden keine großen Geschäfte gemacht. Im stillen Remstal fehlt eine moderne Infrastruktur, ein Verkehrsweg, der den Handel mit weiter entfernten Städten in Schwung bringen könnte. Zwischen Nürnberg und Fürth verkehrt gut anderthalb Jahre nach Gottlieb Daimlers Geburt die erste Eisenbahn. Überall wachsen Bahnhöfe fast aus dem Nichts, werden Schienen verlegt. In Schorndorf geschieht nichts dergleichen: Man hat doch die „Königlich Württembergische Post“ für den Transport von Briefen und Menschen – und private Kutschen gibt es auch.
Rückständigkeit und Fortschritt geben sich die Hand. Während Gottlieb Daimler auf der Lateinschule sein erstes Jahr verbringt, wird unweit von seiner Heimatstadt in Stuttgart ein blutiges Schauspiel aufgeführt. Doch das Drama findet nicht auf der Bühne statt, es ist real: Es handelt vom tragischen Fall eines Mannes, der sich in diesen Zeiten des Aufbruchs zum Erfinder berufen fühlt. Dass er dabei scheitert, hat für ihn tödliche Folgen. Und für seine Mörderin ebenfalls.