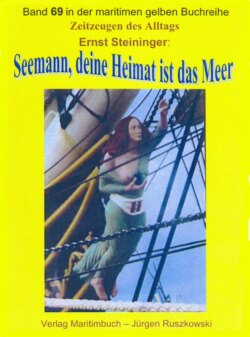Читать книгу Seemann, deine Heimat ist das Meer – Teil 1 - Ernst Steininger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sie, als Österreicher, wie kommen Sie zur Seefahrt?
ОглавлениеAls Kleinkind von etwa drei Jahren bin ich mir nichts dir nichts in eine kleine, abgelegene Froschlake geplumpst. Meine damals noch sehr junge Mutter, die beim Heueinbringen mithalf, hatte mich vorsorglich im Schatten eines großen, einsam für sich stehenden Laubbaumes abgestellt. Na, sicherlich nicht bloß nur so abgestellt, sondern ich sollte wohl, auf einer Decke kauernd, schön brav dem Grillengezirpe lauschen und nach den vorbeitanzenden Schmetterlingen haschen. Nein, letzteres sollte ich sicher nicht – aber vielleicht hab ich’s doch gemacht und bin dabei dem Tümpel zu nahe gekommen – und…
Aber so schnell, wie ich da hinein geraten war, so schnell war ich auch wieder draußen. Wahrscheinlich aus Angst vor dem schmerbäuchigen, fischhäutigen, algengrünen Wassermann, vor dem ich eindringlich gewarnt worden war. Dem grünen Ungeheuer war ich also entkommen; den Mägden auf dem Felde, die etwas bemerkt haben mussten, aber nicht. Die zogen mich splitternackt aus und steckten mich in einen Sack, den man auch noch „fürsorglich“ verschnürte. So gesichert, wurde ich wiederum im Schatten des alten Solitärs abgestellt! Das soll, auch wenn es sich so anhört, kein Vorwurf sein: Es waren Kriegszeiten, meine Mutter war kein Kindermädchen, sie war ein Bauernmädchen. Und die wurden auf dem Felde – die Männer waren ja im Felde – gebraucht.
Wer aber nun meint, dieses Schlüsselerlebnis müsste eine Wasserphobie in meiner Kinderseele ausgelöst haben, den muss ich enttäuschen. Allenfalls habe ich so etwas wie Platzangst abbekommen. Der Tümpel, alles Wasser überhaupt, hatte eher meine Neugier geweckt; so, wie ein paar Jährchen später die fließenden Gewässer mein Fernweh weckten. Und so war es für mich von Kindesbeinen an ganz selbstverständlich, dass ich eines Tages, dem Wasser folgend, an das Ziel meiner Träume, ans ferne Meer gelangen werde.
Am Anfang meiner Seemannskarriere fand ich es einfach unverständlich, immer wieder mit der Frage konfrontiert zu werden: „Sie als Österreicher, wie kommen Sie als Österreicher zur Seefahrt?“ Im jugendlichen Übereifer – und weil mich das: „Sie als Österreicher...“ einfach nervte, ließ ich mich zu weitschweifigen Erklärungen hinreißen; schließlich war ich, jedenfalls die Seefahrt betreffend, einigermaßen belesen. So wies ich immer wieder dezidiert darauf hin, dass es in Österreich nicht nur die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gibt, sondern zu Zeiten der Donaumonarchie auch den Österreichischen Lloyd, der, 1833 noch vor dem Norddeutschen Lloyd, 1857, gegründet worden war. Und dass der k. u. k. Barkschoner „ADMIRAL TEGETTHOFF“, im Auftrage seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph, 1873 das „Franz–Joseph-Land“ entdeckt hatte! (Buchempfehlung: „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ von Christoph Ransmayr.)
Ich schwadronierte von den beiden Segelfregatten SCHWARZENBERG und RADETZKY, die am 9. Mai 1864 in der Seeschlacht vor Helgoland gegen die Dänen für die „schiffslahmen“ Preußen die Kastanien aus dem Feuer holten. Ungläubigen empfahl ich schon mal, den Gedenkstein an der Palmaille in Hamburg-Altona zu bestaunen, der den gefallenen österreichischen Seeleuten der beiden Fregatten gewidmet ist.
Nebenbei bemerkt: Als Österreicher der 2. Republik empfinde ich es halt doch ein bisschen befremdlich, dass die Nachnamen der gefallenen Gemeinen und Matrosen bis auf wenige Ausnahmen auf serbokroatische und italienische Herkunft schließen lassen. Die Vornamen allerdings sind eingedeutscht: Der Seekadett Fontana wird da nicht als Giovanni, sondern als Johann geführt, der Matrose Jan Waniczek wird ebenfalls zum Johann aufgewertet und Herr Karel Vidulich wird zum ganz gewöhnlichen Karl degradiert. Wer weiß, vielleicht hatte das ja System, und der österreichischen Kriegsmarine war nur Kanonenfutter mit deutschen Vornamen genehm. Da tut es einer patriotisch gesinnten Seele ja richtig gut, dass unter den angeführten 51 Toten doch auch noch ein Hauptmann namens Johann Kleinert, sozusagen als „deutsches“ Feigenblatt, zu finden ist.
Verzeihung! Aber meine Sicht auf „unsere Geschichte“ ist die eines jener ungefragten Untertanen, auf deren Rücken die von „Gott“ eingesetzten Monarchen ihre Ränkespiele ausgetragen haben. Deshalb sind mir die den Krieg verherrlichenden Kriegerdenkmale, egal von wem und welcher Art, sowieso suspekt. Den einen mögen sie ja als ein mahnendes Beispiel für die Verführbarkeit, Blindheit und Unmündigkeit ganzer Völker gelten, anderen aber sind sie noch immer ein nationales Heiligtum. Und so frage ich mich, ob das vom Kaiser der Doppelmonarchie 1866 höchstpersönlich geweihte Denkmal auf dem Ritzebütteler Friedhof in Cuxhaven noch zeitgemäß ist. Allerdings, ich bin kein Bilderstürmer! Wenn also der mit Ankerkettenteilen und Kanonenkugeln der Fregatte SCHWARZENBERG eingefriedete Obelisk auch heutzutage noch von der Marinekameradschaft „Tegetthoff“ aus Graz und den Marinekameradschaften der Stadt Cuxhaven in Ehren gehalten wird – na, bitteschön…
Angeblich – so wurde mir von defätistischer Seite zugeflüstert – war es eh bereits zu spät, als nach der langen Reise von der Adria bis zur Nordsee das k. u. k. Geschwader endlich vor Helgoland auftauchte, pardon, aufkreuzte. Soll heißen, dass der Krieg für die Dänen bereits verloren war. Zur Vorgeschichte: In den Monaten Februar und März 1864 verhängten die Dänen eine Seeblockade gegen alle schleswig-holsteinischen und preußischen Häfen. Die preußische Marine konnte das aus dem einfachen Grunde nicht verhindern, weil sie, schlicht gesagt, zu schwach auf der Brust war. Das im Deutschen Bund (1815 – 1866) mit Preußen „verbandelte“ Österreich sah sich dadurch genötigt, maritimen Entsatz nach der fernen Nordsee zu entsenden. Nun war es aber für die schwerfälligen, teils mit Windes-, teils mit Dampfeskraft vorgetriebenen Schiffe ein verhältnismäßig langer Weg von Istriens freundlichen Gestaden bis hin zur fernen, rauen „Mordsee“. Von Anfang März bis Anfang Mai, also sage und schreibe zwei ganze Monate, war der Verband, bestehend aus den beiden schon erwähnten Schraubenfregatten und dem Kanonenboot „SEEHUND“, unterwegs. Der oder die SEEHUND machte dann auch noch vorzeitig schlapp und musste im Ärmelkanal einen englischen Nothafen anlaufen.
Dieweil erwartete der dänische Verband, der zwischen der englischen Enklave Helgoland und der Elbe-Weser-Mündung hin und her kreuzte, voller Ungeduld den so betulich anmarschierenden Feind. Dem Flottenkommandanten Edouard Suenson lief nämlich, ach wie dämlich, die Zeit davon. Der Kampf um die Düppeler Schanzen war für die dänische Sache bereits verloren; kein noch so erfolgreiches Seegefecht hätte die endgültige Niederlage der Dänen verhindern können.
Dass sich der österreichische Flottenchef, Wilhelm Freiherr von Tegetthoff, möglicherweise ganz bewusst Zeit ließ, um vor Helgoland nicht doch noch in des Teufels dänische Küche zu geraten – das stimmt natürlich nicht! Dieses Gerücht entspringt lediglich meiner destruktiven Gesinnung in Sachen Kriegsverherrlichung. Dann, am 9. Mai 1864, drei Tage vor Inkrafttreten des Waffenstillstandes, kam es doch noch zu einer heftigen gegenseitigen Beschießung, die als Seegefecht bei Helgoland in die Annalen der Seegeschichte einging. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass auch drei kleinere preußische Kriegsschiffe daran beteiligt waren – allerdings nur als Zuschauer…
Wie schon angedeutet, hatte das „Treffen“, den Umständen entsprechend, weder militärischen noch politischen Wert. Aber wie dem auch war, der lange Anmarsch der einen Partei und das lange Warten der anderen Partei sollten letztlich nicht vergeblich gewesen sein. Nachdem sich die Streithähne die Federn gehörig gerupft und somit ihr Gesicht gewahrt hatten, obsiegte wenigstens bei Tegetthoff die Vernunft. Dazu trug sicherlich bei, dass sein Flaggschiff, die SCHWARZENBERG, bereits Feuer gefangen hatte. Kurz entschlossen benutzte er den neutralen Status Helgolands – damals noch zu England gehörig – um so seinen Verband und nicht zuletzt sein angekohltes Schiff erst einmal vor weiterem Schaden zu bewahren.
Tegetthoff mit versammelter Besatzung auf seinem Flaggschiff SCHWARZENBERG – Foto: Wikipedia
Dann, bei nächtlicher Dunkelheit verholte er, von den Dänen unbehelligt, sein Geschwader nach dem nahe gelegenen „Cuxendorf“. Die alten Dänen, die den Ausbruch irgendwie verschlafen hatten, suchten noch eine Weile vergeblich nach dem verschwundenen Feind und trollten sich schließlich nach Hause – weit hatten sie es ja nicht…
Der geneigte Leser mag sich vielleicht wundern, warum ich die Stadt Cuxhaven, immerhin ein doch recht bedeutsamer Ort in der deutschen Marinegeschichte, so despektierlich einfach Cuxendorf nenne. Nun, weil ich als Seefahrtschüler einige Jahre da zugebracht habe. Während dieser Zeit sind mir so manche ihrer Bewohner, ist mir so manche Kneipe lieb und – teuer geworden. Das allein aber rechtfertigt meine unbotmäßige Vertrautheit natürlich nicht. Es ist einfach der dörfliche Charakter der Stadt, die je nach Sichtweise, entweder gar keins oder gleich mehrere Zentren hat. Deshalb, Cuxhaven hin, Cuxhaven her – ein Dorf ist es allemal.
Zurück zum Thema: Irgendwann war ich der Ignoranz und des Belächeltwerdens müde. Nachdem auch gezielte Hinweise auf den Erfinder der Schiffsschraube, den aus Böhmen stammenden Tausendsassa und Revierförster Josef Ludovik Frantisek Ressel nichts fruchteten, verzichtete ich schließlich auf marinegeschichtlichen Nachhilfeunterricht. Stattdessen versuchte ich es auf sarkastische Art und Weise. Wie würde wohl ein Seemann aus dem mittleren Westen der USA, vielleicht aus Kentucky, aus Dakota, aus Arizona reagieren, wenn er ständig gefragt würde: Sie als Kentuckianer, als Dakotaner, als Arizoneser, wie kommen denn Sie zur Seefahrt?
Eines der gängigsten Bonmots an Bord war, dass die Ahnung von der Seefahrt gleich hinter’m Deich aufhöre. Da ist schon was Wahres dran. Dennoch hatte es ein an der Waterkant aufgewachsener Junge wesentlich leichter als ein Binnenländer wie ich, die begehrten Planken, die für mich die „Welt“ bedeuteten, unter die Füße zu bekommen. Mein Weg zur Küste glich einem Hindernislauf. Ich war bereits siebzehn, als ich im Sommer 1957 im Hafen von Bremen zum ersten Mal aufregende Seeluft schnupperte, seegängige Schiffe sah...
Doch halt! So weit sind wir noch lange nicht! In der unmittelbaren Nachkriegszeit war Kinderarbeit kein Thema. Es verstand sich von selbst, dass ich als Ältester der kontinuierlich nachwachsenden Kinderschar meiner Mutter, die für Naturalien bei den Bauern in der Nachbarschaft „extra“ schuftete, bei der Feldarbeit helfen musste.
In den großen Ferien war ich dann – von früh bis spät – nur noch beim Lehner-Bauern. Und über die guten Sachen, die es zu Hause nicht so häufig gab, wie Butter, Käse, Speck, Eier, mit Marillenmarmelade gefüllte Krapfen – mir läuft gleich das Wasser im Munde zusammen – hätte ich fast die wund gescheuerten Knöchel vergessen, wenn ich barfüßig bei der Getreideernte die Garben zusammenhäufte und hinterher im Stoppelfeld die liegen gebliebenen Ähren auflas. Oder wenn mir beim „Führen“ der Zugpferde während des Heu-Einbringens der alte Ackergaul, an dessen Halfter ich mehr hing als ging, wieder einmal mehr auf die blanken Zehen trat. Zum Glück war der Untergrund der Bachwiese weich genug, und so häufig kam das ja auch nicht vor…
Und dennoch, dennoch hatten wir – mein nächstfolgender Bruder und die gleichaltrigen Dorfkinder – einen Abenteuerspielplatz ohnegleichen. Es war der Bach, ein urtümlicher, mit windschiefen Weiden, hohen Pappeln und Erlen und allerlei Gesträuch gesäumter, träg dahin fließender Bach. Der Bach, der unsere Wohnbaracke vom Dorf und von den benachbarten Bauernhöfen trennte, war dann auch der Grund, warum sich unsere Boten- und Arbeitsgänge, unsere Spuren oft genug – trotz aller Strafandrohungen und Strafgerichte – in seinem Mäander verloren.
Der Bach, der meinem Geburtsort Prambachkirchen seinen Namen gab, war eine Welt für sich. Während des Winters schlitterten wir in unseren Alltagsschuhen – Schweinslederschuhen mit einer dicken Sohle aus Holz, deren Ränder mit einem Eisenband beschlagen waren – über seine in unterschiedlicher Eisstärke gefrorene Oberfläche. Der Uferbereich mit den tückischen Baumwurzeln, leicht abbrechenden Überhängen und dünnen Eisrändern war tunlichst zu meiden. Aber mit den eisenbeschlagenen „Sohlen“ ließ es sich bestens bremsen – oder auch nicht. Na, jedenfalls konnte man auf glattem Terrain mit diesem Armeleute-Schuhwerk, „Hoizschuabunscha“ genannt, doch immerhin laufen. Auf nassem Schnee hingegen waren sie die reinsten „Haxlbrecher“, weil der schnell anpappende Schnee eine normale Gangart nicht mehr zuließ. Immer wieder sah man sich gezwungen, die nach unten anwachsenden Kegel irgendwie wieder loszuwerden. Dafür eignete sich ganz hervorragend die meinen Schulweg querende Bahnkreuzung. Bei dieser „unvermeidlichen“ Beschäftigung beherrschte mich stets der Gedanke, dass mich der klobige Schuh im engen Zwischenraum der Doppelschiene festhalten könnte und…
Es wäre ja nur zu gerecht gewesen, dass mein hartherziger Stiefvater, der mir keine anständigen Schuhe vergönnte, durch meinen Tod bestraft würde. Ich war klein, mein Herz war rein, und ganz sicher würde ich zu einem Engelein! Aber zu Tode gerädert werden, dass musste nun auch nicht sein – schon der erste Pfeifton des sich nähernden Triebwagens brachte mich wieder ganz schnell auf Trab…
Im Frühling strotzte der Uferbereich des Baches nur so vor Schlüsselblumen, Buschwindröschen, „Hänsel-und-Gretel“ (so nannten wir das Echte Lungenkraut) und auch Veilchen. Mit einem kleinen Sträußchen duftender Veilchen war es dann auch gar nicht schwierig, der verstimmten Mutter den Wind aus den Segeln zu nehmen. In der warmen Jahreszeit aber, da waren die Sorgen meiner Mutter wegen unserer Bach-Exkursionen schon sehr berechtigt. Trotzdem hatte sie nichts dagegen, dass wir gelegentlich das Abendbrot mit einem eigenhändig gefangenen Fisch aufbesserten. Unsere Art zu fischen war, dass wir mit bloßen Händen die ausgewaschenen Höhlungen unter Wurzeln und Steinen abgriffen. Spürte man einen Fisch, so durfte man keineswegs sogleich fest zugreifen; oh nein, ganz gefühlvoll musste man die „hohle“ Hand bis zum Kiemenbereich bringen, um dann blitzschnell zuzufassen.
Das war nicht ganz ungefährlich! Nicht immer waren es nur Fische, was man da griff. Manchmal hatte man einen Krebs am Finger, und Schlangen und Bisamratten waren auch keine Seltenheit. Außerdem gab es dort und da tückische Tümpel, die meinem kleineren, des Schwimmens unkundigen, Bruder auflauerten – und mich dadurch ebenfalls in Gefahr brachten. Es waren aber nicht so sehr die „natürlichen“ Gefahren, die meine Mutter beunruhigten. Was ihr vielmehr Sorge bereitete, waren die Kriegsrelikte, die wir ja ebenfalls nach Hause schleppten. Aus gutem Grund, denn dafür gab es beim Schrotthändler, unserem Stiefvater, bares Geld…
Auch noch Jahre nach Kriegsende war rund um mein Heimatdorf Kriegsgerät auffindbar. Die Wälder und Gehölze, Sandgruben und Lehmkuhlen – und nicht zuletzt der Bach – waren verseucht damit. Der Grund: Versprengte Reste der Waffen-SS, die nicht mehr wussten, wohin denn nun, hatten sich in den letzten Kriegstagen in der Gegend herum getrieben. Außerdem gab es da noch eine strategisch wichtige Brücke, die wohl noch verteidigt worden war. Grund genug für die Amis, mal kurz hinzulangen.
So wollte es die Geschichte, dass die Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Land Oberösterreich, aufgrund ihrer Lage an der Bundesstraße 129 zu einem der letzten Schauplätze des zweiten Weltkrieges wurde. Kurioserweise blieb der Ort selbst von größeren Schäden verschont. Das Resümee: Die Brücke zerstört, das Nachbardorf in Flammen, weggeworfenes Kriegsgerät allenthalben. Fürwitzige Jungen meines Alters wurden noch Jahre danach beim Sammeln von Schrott jeglicher Art verstümmelt oder gar getötet…
Zurück zum Bach: Während mein Bruder nach allem griff, was er in die Finger bekam – und das waren eben nicht nur Fische, sondern auch Handgranaten, Karabiner, Panzerfäuste – war ich bemüht, das Gelände zu erkunden. Stück für Stück erforschte ich den Bachlauf von der Quelle bis zu seiner Mündung in den nächsten größeren Fluss, die Aschach. Von der wusste ich, dass sie zur Donau hin fließt. Die Donau! Der große Strom, von dem ich träumte, dass er mich eines Tages bis ans Meer tragen sollte...
Eines Tages – im Verlaufe eines Schulausfluges – war es dann so weit: Ich stand am Ufer des gewaltigen Flusses. Der Anblick der damals noch ungefesselten Wassermassen, die sich ungestüm durch die Enge des Aschacher Kachlets zwängten und sich gleich danach, beruhigt und behäbig in das Eferdinger Becken ergossen, hypnotisierte mich…
Im Kachlet selbst mühte sich ein Raddampfer mit langen Eisenkähnen an langen Seilen stromaufwärts. Die riesigen Schaufelräder schienen auf der Stelle zu drehen. Es knirschte und knarrte, als ob sie mehr über Grund ackerten als durchs Wasser schaufelten. Auf der Kommandobrücke stolzierten bemützte Männer hin und her, und die lange, schräg nach hinten geneigte Schornsteinröhre paffte unablässig schwarze Wolken in den blauen Himmel. Das Vorschiff fiel von der Schiffsmitte schräg nach vorn ab, was dem Schiff ein wunderliches Aussehen verlieh, so als ob es sich in die anstürzende Flut verbeißen wollte. Stockend, ächzend, pfeifend und qualmend quälte es sich durch das unbekümmert vorbeirauschende Wasser. Müßig zu sagen, wie sehr mich dieser Anblick faszinierte; müßig zu sagen, was da in mir reifte…
Um die vierte Klasse unserer Volksschule machten alle Schüler, die da nicht unbedingt hinein mussten, einen respektvollen Bogen. Diese Klasse unterstand direkt dem autoritären, uneingeschränkt über sein „Reich“ herrschenden Oberlehrer Frosch. Renitente Jungs aus anderen Klassen, gegen die sich die „Fräuleins“ nicht zu helfen wussten, wurden ihm noch während des Unterrichts vorgeführt. Hei, was war das doch immer wieder für eine willkommene Abwechslung, wenn dann so ein Delinquent vor unser aller Augen „Scheitelknien“ musste. Aus der Sicht unserer Elterngeneration galt der Herr Oberlehrer zwar als „streng, aber gerecht“. Aus der Sicht eines Schülers aber war Frosch alles andere denn gerecht. Er war auch nicht das, was man ihm als nur „streng“ unterstellen könnte; nein, er war schlicht brutal. Ein Himmler-Typ: Rundköpfig, runde Nickelbrille, kurz geschorenes, rechts gescheiteltes Haar – wie es rassenhygienisch bis vor kurzem noch Pflicht war. Neben seiner Eigenschaft als Schulleiter war er auch Organist der Kirchengemeinde und als solcher für den musikalischen Nachwuchs zuständig. Das sah dann so aus, dass er die von ihm als unmusikalisch Eingestuften so lange mit dem Bogen seiner Violine traktierte, bis sie von ihrer Unmusikalität überzeugt waren. Dazu zählte natürlich auch ich. Jahre später revanchierte ich mich für diese Gemeinheit, indem ich als selbstbewusster junger Seemann – lauthals Seemannslieder grölend – nächtens vom Dorfwirtshaus nach Hause zog…
Dass der Rohrstock das beliebteste Lehrmittel dieses perversen Erziehers war, versteht sich von selbst. Ich galt zwar als brav, weil ich Ministrant war, und habe den Stock lediglich als massive Drohung in Erinnerung. Nur einmal, da hatte ich Pech: Eine von mir nur durch den Mittelgang getrennte Mitschülerin verpetzte mich wegen irgendeiner Kleinigkeit. Oder? Die Strafe, die der Tat auf dem Fuß folgte, lässt darauf schließen, dass es vielleicht doch eine größere Kleinigkeit war. Na sicher, war es doch ausdrücklich verboten, die Mädchen auch nur wahrzunehmen. Das war weniger schwierig, als man denken möchte. Die durchwegs, bis auf ganz wenige Ausnahmen, mausgrauen und langzopfigen Landmädchen waren, jedenfalls für mich, eigentlich kein Grund, auf „dumme“ Gedanken zu kommen. Die Strafe für mein Vergehen war „Glockenläuten“. Das ging so: Der Oberlehrer, ein gestandenes Mannsbild in den besten Jahren, fasste mich am Hosenboden und den Hosenträgern, hob mich waagerecht in die Luft und bumste mich, wie einen menschlichen Glockenschwengel, mit dem Kopf voran, gleich mehrere Male gegen die stabile Schreibtafel. Das war schon arg, so vor der ganzen Klasse unter dem Gejohle der Buben und dem Gekreische der Mädchen gedemütigt zu werden. Allerdings, oh Wunder, hinterher vermeinte man wirklich eine Zeitlang, so etwas wie Glockengeläut zu vernehmen...
Der Mann hatte aber auch seine guten Seiten. Denn, wenn man bei ihm auch nichts Konkretes lernte, so war er doch ein begnadeter Geschichtenerzähler. Wie ein Bänkelsänger stand er – mit Stock, versteht sich – vor der großen Landkarte der großen Donaumonarchie und erzählte in schwelgerischer Weise aus der guten alten Zeit; von seinen Schiffsreisen auf der Donau von Wien bis ans Schwarze Meer. Zum Abschluss der „Geschichtsstunde“ fuhr er mit dem „Zeigestock“ von der Nord- über die Ost- bis zur südöstlichen Grenze des so kläglich zusammengeschrumpften Österreich. Und in dramatischer Pose verwies er auf die akute Gefahr, die von den abtrünnigen slawischen Völkern ausgehe…
Das waren die Stunden, in denen ich seine Bösartigkeit vergaß und voller Aufmerksamkeit an seinen Lippen hing. Seinem Stocke folgend, schiffte ich mich in Wien ein, zollte Budapest die gebührende Achtung, mied Belgrad wegen der „aufsässigen, hundsgemeinen Serben“, wand mich mit meinem Schiff durch das Eiserne Tor, drang bis zur Dobrudscha vor, gelangte endlich ans gelobte Meer; Thalassa! Thalassa!
Mein Stiefvater – mein leiblicher Vater war als vermisst gemeldet und blieb es auch – war Schrotthändler. Das brachte ihn auf die Idee, aus dem Schutt der zerbombten Lagerhallen des Linzer Donauhafens geborgenes, grotesk verbogenes Moniereisen aufzukaufen. Anschließend wurde der Schrott mit dem „Opel Blitz“, einem „ausgedienten“ Wehrmachts-LKW, nach unserem rund 40 Kilometer entfernten Dorf transportiert. Am häuslichen Lagerplatz wurden dann die Eisenstangen mit dem Vorschlaghammer auf dem Amboss leidlich gerade geklopft, um so wiederum an die Bauern der Umgebung als wieder verwertbares Betoneisen verkauft zu werden. Das war schon Knochenarbeit; für die ich als schmalbrüstiger Junge jedoch keineswegs zu schade war. An der Linzer Oberen Donaulände, die wir bei diesen Gelegenheiten stets passierten, lagen zwei große Raddampfer, die „SATURN“ und die „URANIA“, einstens der Stolz der österreichischen Donauflotte zwischen Wien und Konstanza. Man hatte die beiden Passagierschiffe, um sie dem Zugriff der Roten Armee zu entziehen, noch schnell vor Kriegsende von Wien nach Linz verlegt. Ich konnte sie immer nur flüchtig im Vorbeifahren bestaunen. Waren es doch die Schiffe „meines“ Oberlehrers – als Hotelschiffe für den Rest ihres Daseins an der Kaje angebunden…
Meinem Stiefvater oblag es auch, das in der Umgebung liegengebliebene Kriegsmaterial einzusammeln und zu verschrotten. Dazu gehörte auch das Einsacken von Nazi-Literatur aus diversen Schulbibliotheken. Für mich, der ich doch alles verschlang, was auch nur im Entferntesten nach Schiffen und Abenteuer roch, war dieser Lesestoff eine gefährliche Falle… Waren sonst so unschuldige Bücher wie die „Schatzinsel“, „Das Geheimnis der Inka-Insel“ Quellen meiner Fantasie, so hielt ich nun plötzlich schuldbeladene Bücher in meinen Knabenhänden. Hauptsächlich waren es die mit vielen Fotos illustrierten Bücher, Almanache der soeben untergegangenen Kriegsmarine. Binnen kurzer Zeit wurde ich ein „Experte“ in Sachen Seekriegsführung, kannte alle Seeschlachten beider Weltkriege und die dazu gehörenden Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe mit Namen. Einzig zu Torpedo- und U-Booten hatte ich ein gestörtes Verhältnis, vermutlich, weil sie anstelle anständiger Namen – wie „SCHARNHORST“, „GNEISENAU“, „BISMARCK“, „PRINZ EUGEN“ – lediglich eine „Nummer“ hatten. In dieser Zeit verschlechterte sich die ohnehin schwierige Beziehung zu meinem Stiefvater gravierend; er nahm mir nämlich diese Bücher einfach weg! Ich sah mich nun gezwungen, sie mir heimlich aus dem Lagerschuppen, in dem sie auf ihrem Weg in die Papiermühle zwischengelagert wurden, „auszuleihen“…
Mein Stiefvater, Ferdinand A., von seiner Kundschaft kurz und prägnant „Eisenferdl“ genannt, war so taub, wie einer mit geplatztem Trommelfell nur sein kann. Er war 28 Jahre älter als meine Mutter, demnach 47 Jahre älter als ich. Seine Taubheit hatte er sich im Granathagel der Isonzo-Schlachten des Weltkriegs I eingefangen – erzählte meine Mutter. Mir gegenüber hat er darüber nie ein Wort verloren, wie er überhaupt von sich so gut wie nichts erzählte. So empfand ich die Konfiszierung „meiner“ Bücher durch ihn als gewalttätig und kam mit keinem Gedanken auf die Idee, es hätte „prophylaktisch“ gemeint sein können. Viele Jahre später, als mir diesbezüglich dies und jenes durch den Kopf ging, erinnerte ich mich an folgendes Geschehen: Es war gegen Ende des Krieges, als ein Trupp zerlumpter, ausgemergelter Gefangener auf der Landstraße – direkt vor unserem Haus – vorbei getrieben wurde. Mein Stiefvater klemmte sich einen halben Laib Brot unter den Arm, nahm das Brotmesser in die Hand und schritt beherzt auf den von Wachen geführten Trupp zu. Was nun geschah, hat sich wie ein Brandzeichen in mein Gehirn eingeätzt. Einer der begleitenden Aufseher schlug meinem Stiefvater das Brot aus der Hand und beförderte es mit einem Fußtritt in den Straßengraben… Heute denke ich, wenn es in unserem Dorf auch nur einen Menschen gab, der kein Nazi war – dann war es mein Stiefvater, der alte Eisenferdl…
Ich hingegen? Was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich ein paar Jahre früher geboren worden wäre – oder wenn die Faschisten ihren Krieg gewonnen hätten? Höchst wahrscheinlich ein strammer Marinesoldat – dessen Gebeine vermutlich längst in einem auf dem Meeresgrund ruhenden, eisernen Sarg vermoderten. Gott sei dank kam es anders. Nach dem Willen des im besten Sinne dieses Wortes gestrengen Gemeindepfarrers ward ich ausersehen, mit finanzieller Unterstützung der Kirche in der nahe gelegenen katholischen Missionsschule das Gymnasium besuchen zu dürfen. Um es kurz zu machen, es blieb bei einem Besuch. Der währte aber immerhin von meinem elften bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr. Erwähnenswert ist dieser „Besuch“ deshalb, weil ich dadurch in meinem festen Entschluss, so oder so Seemann zu werden, kurz schwankend wurde. Die zum Verein der „Oblaten des Franz von Sales“ gehörende Missionsschule war die unterste Stufe für eine Ausbildung zum Missionar. Aber der Weg bis dahin ist lang, und nur die allerwenigsten von uns Zöglingen dürften das vorgegebene ferne Einsatzland – Deutsch-Südwest-Afrika / Namibia – jemals als Missionar betreten haben.
In dem tristen Internat, in dem ich mir oft genug wie lebendig begraben vorkam, gab es nur wenige Höhepunkte. Neben dem Geburtstag des heiligen Franz von Sales, an dem ganz unwahrscheinlich aufgetafelt wurde und es sogar Weintrauben als Nachspeise gab, waren es die Besuche der aktiven Missionare. Deren Lichtbildvorträge verfehlten nicht ihre Wirkung auf mich. Jenes weite, dünn besiedelte Land mit seinen exotischen Menschen und Tieren entsprach meiner Vorstellung eines abenteuerlichen Lebens. Daran mochte ein gewisser Herr namens Karl May auch nicht ganz unschuldig sein. Denn hauptsächlich war es seine Literatur, die ich während der Studierstunden heimlich in mich hinein sog. Was so schwierig nicht war, denn die mit der Aufsicht betrauten Patres waren in der Regel zutiefst in ihr Brevier vertieft. Allerdings nicht alle – Pater Berger, der tat nur so. Er hatte es ohnehin wegen meiner schlechten Lateinnoten auf mich abgesehen. Pater Eisenbart hingegen, der Rektor des Internats, der war harmlos, der schmökerte selbst ganz ungeniert Karl May…
Auch eines meiner „Leihbücher“ aus des Stiefvaters Lagerschuppen mit dem martialischen Titel: „Mit der Flinte in der Hand durch das „Betschuana-Land“ beeindruckte mich sehr. Das von deutscher Kolonialherrlichkeit berichtende Buch war reinste Schundliteratur: Heldenhafte deutsche Männer bewährten sich als tapfere Krieger und trieben die aufmüpfigen Hottentotten nur so vor sich her. Dieses hinterhältige Mordsgesindel, das es den tüchtigen deutschen Kolonisten so schwer machte, das unwirtliche Land zu kultivieren, die hatten doch nichts Besseres verdient, als gejagt und erschlagen zu werden! Es sei denn, sie ließen sich im Namen des Herrn taufen und als willfährige Sklaven zur Haus- und Feldarbeit verwenden. Das wäre dann ja meine vornehmste Arbeit als Missionar gewesen – das Taufen und das Erziehen der ungezogenen Wilden zu brauchbaren, den Weißen ergeben dienenden Sklaven. Nebenbei sollte noch Zeit genug übrig bleiben, um mich so wie Gustav Nachtigal als Entdecker und Landnehmer oder wie Ernest Hemingway als Reiseschriftsteller und Großwildjäger hervorzutun. Dass die beiden letzten Punkte nicht unbedingt zum Programm eines Missionars gehörten, war mir schon klar, aber immerhin – man wäre erstmal vor Ort gewesen…
Daraus wurde nichts, leider! Leider deshalb, weil mir in meinem späteren Leben gar manches Mal der Stoßseufzer entfleuchte: „Ach, wäre ich doch bloß Pfarrer geworden!“ Dies scheiterte vornehmlich an einem Buch: meinem Schicksalsbuch, dem „Liber Latinus“. Obwohl ich in den meisten Fächern gut, in einigen – wie Geschichte, Geographie und Naturkunde – sogar sehr gut war, blieb mir das Latein ein Buch mit sieben Siegeln. Auch die Mathematik war nicht so recht mein Fall. So kehrte ich alsbald reumütig zu meiner alten Berufsvorstellung zurück, denn als Seemann braucht man schließlich keine Mathematik – welch ein Irrtum! – und vor allem – kein Latein! So verließ ich, stante pede, nach Vollendung meines vierzehnten Geburtstages ohne Reue, aber leider auch ohne Abschlusszeugnis die „geistliche“ Anstalt – um mich dann unvermittelt im wirklichen Leben wieder zu finden.
Das wirkliche Leben bestand dann erst einmal aus Arbeit auf dem Schrottplatz meines Stiefvaters. Ich musste mir meinen Lebensunterhalt von nun an selbst verdienen. Zu Kost und Logis bekam ich in der Woche ganze 20 Schilling als Lohn. Zwanzig Schilling: das reichte gerade mal für einen Kinobesuch im benachbarten Marktflecken und anschließend noch für einen Schoko-Würfel in der Konditorei. Verabreicht wurde die Süßigkeit von der frühreifen – eine frühere Umschreibung für sexy – maliziös lächelnden Konditorstochter. Eine neue Falle tat sich auf, kam ich doch direkt aus einem „Bullenkloster“ und war – sehr zur Belustigung meiner neuen Freunde – bar jeglicher Erfahrung dem „Weibe“ gegenüber…
Viel Zeit für Belustigung gab es ohnehin nicht. Die Woche hatte sechs volle Arbeitstage, und zwischen meinem Stiefvater und mir gab es nur Zoff. Meine Mutter war redlich bemüht, eine Lehrstelle für mich zu finden. Sie schleppte mich zum Berufsberater. Der empfahl mir, wohl meinem Habitus angemessen, Schneider, Koch, Kellner oder Konditor zu werden. Doch ich blieb stur und bestand auf Seemann…
Meiner Mutter zuliebe und wegen des alten „Grantscherben“, meinem Stiefvater, bequemte ich mich doch hin und wieder dazu, die eine oder andere Lehrstelle anzunehmen. Doch das war meist nur von kurzer Dauer: Bäckerlehrling war ich gerade eine ganze Woche; beim Schlosser hingegen hielt ich volle neun Monate durch. Und dass, obwohl ich im Grund nichts anderes als eine billige Hilfskraft war. Im Winter oblag es mir, noch vor der regulären Arbeitszeit die 200 Liter fassenden Sägespäne-Öfen vollzustopfen. Auch für das Abschmieren der Gelenknippel völlig verdreckter LKW und Traktoren war ich gut genug. Den Rest aber gab mir wochenlanges Bohren blöder Löcher in vorgefertigte, blöde Eisenstücke. Dabei dachte ich an Palmen, Wind, Sonne, Sand und Meer und – Bohrer um Bohrer zerbrach. So zerbrach auch dieses Arbeitsverhältnis. Mir war, sehr zum Leide meiner Mutter, aber gar nicht leid darum. Wie sollte ich mir denn bei einem Wochenverdienst von ca. 50 Schilling jemals eine Fahrkarte nach Hamburg ersparen?
Freddi, nicht der Quinn, sondern mein damals bester Freund, hatte sich von seinem ersten Geld als frischgebackener Malergeselle ein funkelnagelneues Glockner-Dreigang-Fahrrad gekauft. Ihn dauerte meine finanzielle Dauermalaise, und eines Tages beschlossen wir, dass ich mit seinem Fahrrad nach Hamburg radeln sollte. Gesagt, getan – es war das Jahr 1956, und es war Frühling. Und es regnete, meine erste Station war die Jugendherberge in Straubing, deren freundliche Leitung mir einen deutschen Jugendherbergsausweis ausstellte. Im Büro der Herberge hing ganz groß vor meiner Nase eine Straßenkarte der Bundesrepublik Deutschland. Am nächsten Tag regnete es immer noch. Angesichts der Karte und der darauf so klar sichtbar gemachten Entfernung zwischen meinem Standort und meinem Ziel verließ mich der Mut. Ich beschloss, statt nach Hamburg lieber quer durch das südliche Bayern, über Lindau und Bregenz, nach Dornbirn zur „Hannitante“ zu radeln. Die Hannitante, die in einem herrschaftlichen Hause diente, freute sich und beköstigte mich zwei Tage lang. Dann machte ich wieder den Buckel krumm und radelte der Länge nach durch Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich wieder nach Hause…
Nun, so viel war mir hinterher klar: Von der Strecke her hätte ich genauso gut nach Hamburg radeln können. Ich aber saß nun wieder zu Hause fest, zur Freude meiner Mutter, zur Freude Freddis, dem ich sein Fahrrad unbeschädigt zurückgeben konnte und – war wiederum der Gnade und der Häme meines Stiefvaters ausgeliefert…
Aber gerade das war es, was mich so ungemein wurmte. Vor allem der Umstand, dass ich immer wieder auf ihn als Arbeitgeber angewiesen war, das frustrierte mich. Irgendwie jedoch kratzte ich soviel Geld zusammen, um ein Jahr nach der verfehlten Expedition einen neuen Anlauf an die Küste zu nehmen. Diesmal versuchte ich es per Anhalter, und ich gelangte binnen einer Woche quer durch ganz Westdeutschland bis nach Bremen. Dort hatte es mir das an den Dalben liegende Segelschiff „SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND“ sofort angetan. Ohne lange zu überlegen, ließ ich mich für einen dreimonatigen Ausbildungskurs zum Schiffsjungen eintragen. Dass das Vollschiff SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND nach dem Untergang der Viermastbark „PAMIR“, ebenfalls ein Ausbildungsschiff, nicht mehr in Fahrt gehen würde und in Zukunft nur noch eine stationäre Ausbildungsstätte sein sollte – das musste ich aber erst verschmerzen…
Trotzdem trampte ich frohgemut wieder nach Hause – mit der Zusage in der Tasche, von Dezember 1957 bis März 1958 zur Ausbildung zum Schiffsjungen an Bord angemeldet zu sein. Verbunden war dies mit der Auflage, ca. 500 DM – die genaue Summe weiß ich nicht mehr, so oder so war es für mich eine Unsumme – als Kursgeld mitzubringen. Dreitausendfünfhundert Schilling, und dann mindestens noch ein Tausender für die Bahnfahrt. Woher nehmen und nicht stehlen?
Nun, ich fand in Linz Arbeit am Bau als jugendlicher Hilfsarbeiter. Das bedeutete: Frühmorgens, um 04:30 am örtlichen Bahnhof zu stehen und erst abends um 19:30 dort wieder anzukommen. Dazwischen ein Arbeitstag in Dreck, Schweiß, Zementstaub. Zusammen mit einem jungen Ungarn, den der Aufstand von 1956 aus Budapest nach Linz verschlagen hatte, demontierte ich hölzerne Zementverschalungen. Dadurch bleibt mir das ungarische Wort für Beißzange – Horobafugo – für immer im Gedächtnis…
So hatte ich mir doch tatsächlich binnen eines halben Jahres mit Hilfe einer Beißzange das nötige Fahr- und Kursgeld erarbeitet und war am Vorabend des 9. Dezember 1957 zur Abfahrt nach Bremen bereit. Von meinen Freunden hatte ich mich bereits gebührend verabschiedet; von Mädchen erübrigte sich ein Abschied. Meine unbeholfenen Annäherungsversuche an die holde Weiblichkeit waren aufgrund meiner Verklemmtheit im Sexuellen allesamt kläglich gescheitert. Meine Mutter, die ich allzu sehr liebte, hielt sich tapfer… Mein Stiefvater, der alte Grantscherben, gab mir zum Abschied seine schwielige Hand und meinte trocken: „In vierzehn Tag bist eh wieda do“…