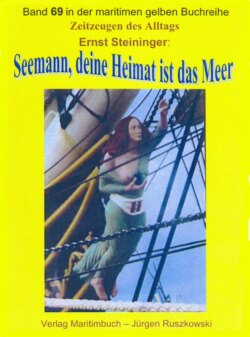Читать книгу Seemann, deine Heimat ist das Meer – Teil 1 - Ernst Steininger - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Küstenmotorschiff STADERSAND
ОглавлениеSeefahrtbuch für Ernst Steininger – ausgefertigt in Bremen am 25. Feb. 1958
– Seefahrtbuch Nr. 0266 / Seite 14 –
Der Inhaber ist angemustert als Decksjunge auf dem Motorschiff „STADERSAND“.
Reederei: Ch. Meyer
Unterscheidungssignal: DFJM
Br.-Raumgehalt cbm 1406
Heimathafen: Stade
geführt von Kapt. Wabers
Reise: Nord- und Ostsee
Zeit: unbestimmt
Der Dienstantritt erfolgt am 7. März 1958
Seemannsamt Rendsburg, den 9. März 1958
Nachträgliche Eintragung des Seemannsamtes Brunsbüttelkoog: Ab 1. Novb. 1958 als Jungmann
* * *
Die Heuerstelle – in meiner Erinnerung verkörpert durch ein rundliches Brillengesicht, das mich durch das quadratische Loch in der kahlen Zimmerwand flüchtig musterte. Es gehörte zu jenem Herrn Maier und begutachtete mein funkelnagelneues Seefahrtbuch. Es bemängelte, dass das Passfoto noch ausstehe. Das deutsche Seefahrtbuch sei immerhin ein international anerkanntes Dokument, und ich hätte das Foto schnellstens nachzuliefern. Sprach’s, schob mir das Büchlein samt einem Notizzettel durch den Schalter und schloss vernehmlich laut die Klappe: Rumms; war es doch schon Nachmittag, und der normale Parteienverkehr endet bei deutschen Behörden immer noch mittags…
Noch im Gebäude fischte ich aufgeregt und neugierig nach dem Zettel. Darauf stand nichts weiter als der Liegeplatz und der Name des Schiffes, auf das ich gerade verschanghait worden war. So kam es mir im Moment jedenfalls vor. Der Name des Schiffes STADERSAND verhieß nichts Gutes. STADERSAND, das hörte sich irgendwie nach Kuhdorf an… So viel wusste ich: Die Namen der Frachtschiffe des Norddeutschen Lloyds endeten alle auf –stein, die der Hansa-Linie alle auf –fels und die Namen der großen Massengutfrachter der Schlüssel-Reederei, die sogar den Orinoco befuhren, endeten auf –tor. Auch eines der Schiffe der Argo- oder der Neptun-Reederei, allesamt Bremer Reedereien, konnte es nicht sein. Die Schiffe der Argo-Linie hatten so poetische Sternenamen wie „ALGOL“ oder „ALDEBARAN“; die der Neptun-Linie hatten gar Namen aus der griechisch-römischen Götterwelt wie „THETIS“, „CERES“… Aber STADERSAND – der Name roch doch geradezu nach einem mickrigen Kümo.
Auf ein Kümo – das ist in der Regel ein kleines Küstenmotorschiff in der „Kleinen Fahrt“ – war ich nun ganz gar nicht erpicht. Mein Traum war die „Große Fahrt“: Hongkong, Yokohama, Valparaiso, so hießen meine Ziele und nicht etwa Brunsbüttelkoog oder Rendsburg… Mir war unsäglich flau im Magen, als ich mich schließlich auf die Suche nach dem Liegeplatz des Schiffes machte. Im Europahafen angekommen, stellte ich niedergeschlagen, aber erwartungsgemäß fest: Weit und breit kein größeres Schiff! Der Europahafen war fast leer gefegt. Es war Ebbe, die Masten und die Brückenhäuser einiger Kümos ragten neben den hohen Spundwänden aus der Tiefe des Hafenbeckens. Der Liegeplatz „meines Schiffes“ aber, dass konnte ich bereits von weitem erkennen, war nicht belegt. Die zwei größeren Kümos, die zur Neptun-Flotte gehörten, konnte ich gleich abhaken, und nachdem es mir gelungen war, die kleineren zu identifizieren, stellte ich erleichtert fest, dass keine STADERSAND darunter war.
„Gott sei Dank“, aber was nun, was sollte ich tun? Während ich noch überlegte und dabei mehr oder weniger zufällig in Richtung Hafeneinfahrt sah, bemerkte ich, wie sich gerade ein kleiner grauer Kahn anschickte, die Hafeneinfahrt zu passieren. Mir plumpste das Herz in die Hose; instinktiv verbarg ich mich hinter dem nächsten Kranaufbau. Von da aus beobachtete ich das langsam näher kommende Gefährt, das aussah wie eine graue Wassermaus mit zwei Zahnstochern auf dem Rücken. Die Hoffnung, es möge sich bei diesem unscheinbaren Kümo doch um Himmels Willen nicht um „das Schiff“ handeln, erfüllte sich nicht. Unübersehbar groß stand da, die ganze Seite der Back ausfüllend, schwarz auf grau mit – wie ich später feststellte – aufgeschweißten Lettern: STADERSAND.
„Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel…“ So oder so ähnlich hörte sich das gleichmäßige Tuckern der irgendwo im unteren Achterschiff versteckten Maschine an. Die STADERSAND war bereits frühmorgens ausgelaufen, nachdem man ihr noch während der vergangenen Nacht den Bauch mit Stückgut voll gestopft hatte. Nun schipperte sie die Weser hinunter. Vorbei an den beeindruckenden, gewaltigen Werftanlagen der „AG-Weser“, des „Bremer-Vulkan“ – Vegesack…; vorbei an mächtigen, irgendwie schief im Uferschlick liegenden Betonklötzen, ehemaligen U-Bootsbunkern – Elsfleth…; vorbei an Siloanlagen, Förderanlagen – Brake…; vorbei an einem Pulk vor Anker liegender Schiffe – Blexen-Reede, Bremerhaven… Ich saß auf irgendwas auf dem winzigen Achterdeck und – schälte Kartoffeln. Mir gegenüber saß, auf irgendwas, Hanna. Zwischen unseren Beinen: die Kartoffelpütz. Hanna war etwa vierzig, kleinwüchsig, fast zwergwüchsig, hatte einen Buckel und war die Schiffsköchin. Unsere Knie berührten sich, rieben sich, verursacht wohl durch das harte Vibrieren des Decks… „So, so – aus Österreich kommst du.“ Hannas neugierige Blicke musterten mich unverhohlen; und kichernd sagte sie: „Krause Haare, krauser Sinn, da steckt gewiss der Teufel drin!“ Damit hatte sie so unrecht nicht.
Zum ständigen Vibrieren des Decks hatte sich ein leichtes Schaukeln, ein kaum merkliches Schwanken des Schiffes gesellt. Ich blickte beunruhigt auf, wir waren doch noch immer auf dem Fluss, hatten gerade einmal Bremerhaven passiert… Was, zum Teufel, ging da vor? Mir ward auf einmal übel, und ich begann heftig zu schlucken. Hanna riet mir, trocken Brot zu essen – mit dem Erfolg, dass ich spätestens ab Leuchtturm „Rote Sand“ die Fische mit vorgekautem Brotbrei fütterte… Obwohl uns auf unserem Weg von der Weser in die Elbe – wir steuerten den Nord-Ostsee-Kanal an – kein Hurrikan, kein Tornado, nicht einmal ein simpler Sturm, geschweige sonst irgend ein widriges Wetter begegnete, kotzte ich, als ob wir in allen „Wettern“ gewesen wären. Erst kurz vor Brunsbüttelkoog gelang es mir, meinen Magen – dank Hannas körniger Brühe – wieder zu beruhigen.
In Rendsburg, das am Kanal – auf halbem Weg nach Kiel-Holtenau – liegt, wurde gebunkert. Der Kapitän nutzte den kurzen Aufenthalt, um mich durch das örtliche Seemannsamt ordentlich anmustern zu lassen. Ab dem 9. März 1958 war ich also Decksjunge auf dem Motorschiff STADERSAND, das dem Ziegelwerksbesitzer und Reeder Ch. Meyer gehörte. Das Schiff war vielleicht gerade einmal 60 Meter lang, keine 10 Meter breit, und der Heimathafen war Stade. Geführt wurde es von Kapitän W., der aber auch rein gar nichts Seemännisches an sich hatte. Wiewohl er sicherlich ein anständiger Mensch, ein Familienmensch, war. So oft es nur ging, hatte er seine Frau samt Kleinkind an Bord. Auf der Brücke ging es manchmal zu wie in der guten Stube eines Reihenhauses. Der „Alte“, im gestreiften oder karierten Hemd und in einer blauen Schlaghose, gemütlich im Lotsenstuhl sitzend; derweil „sin Fru“ das Baby in ihren Armen wiegend, gelangweilt durch die Brückenfenster – die allerdings keine Gardinen hatten – in die Gegend sah. So gemütlich ging es aber nicht immer zu, schon gar nicht in den „Iden des März“ 1958.
Kaum, dass wir den Kanal verlassen hatten und uns anschickten, die Kieler Förde zu durchfahren – unser nächster Hafen sollte Malmö sein – begann auch schon wieder die verdammte Schaukelei, und spätestens nach dem Passieren des Marine-Ehrenmales in Laboe war mir bereits wieder zum Kotzen. Als wir dann den Lotsen abgegeben hatten und mit östlichem Kurs der offenen Ostsee zustrebten, gesellte sich zu dem unangenehmen Schaukeln ein noch viel unangenehmeres Stampfen. Ein eiskalter, stetig anschwellender nordöstlicher Wind fegte über den Fehmarnbelt. Der Starkwind entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem richtigen, bösen Wintersturm und blies uns nun, nach der Kursänderung bei Gedser-Odde, voll ins Gesicht. Das Schiffchen stampfte und ruckelte und rollte erbärmlich, und ich? Ich kotzte mir sozusagen die Seele aus dem Leib. Was heißt hier Seele: Ich kotzte Blut… Hanna, der ich leid tat, war mit ihrem Latein am Ende. Der Rat des Alten, ein Stück Speck am Bindenfaden zu verschlucken, um es dann wieder hochzuziehen, erübrigte sich… Der Steuermann, ein Mann mit der etwas derben Ausdruckweise des ehemaligen Hochseefischers, gab mir auf meine verzweifelte Frage, was ich denn gegen mein Leiden tun könne, zur Antwort: „Nixs, min Jung, du schallst man blot uppassen; wenn de brune Ring hochkümmt, den musst du allweder schlucken, dat is dat Arschloch…“
Mittagszeit: Ich brauchte nichts, aber auch für die restliche Mannschaft, die klatschnass und halb erfroren von Deck herein getorkelt kam, gab es außer heißen Getränken auch nur kalte Küche. Sie hatten unter Lebensgefahr ein paar volle Zweihundert-Liter-Ölfässer, die am achteren Decksaufbau festgelascht waren und sich selbstständig zu machen drohten, wieder dingfest gemacht. Das bekam ich aber nur so am Rande mit; ich war ausschließlich mit mir selbst beschäftigt und war zu nichts zu gebrauchen. Ich weiß es noch, als ob es erst gestern gewesen wäre: Mich krampfhaft an irgend etwas festhaltend, starrte ich stundenlang durch das Kombüsenfenster auf die querab an Backbord auf und ab und hin und her tanzenden weißen Kreidefelsen von Mön – Möns Klinst. Das Schiff, das sich zu allen anderen Übeln auch noch schüttelte wie ein nasser Hund, wenn es die Nase tief wegsteckte und das Heck samt Schraube dabei kurz aus dem Wasser ragte und diese dann widerstandslos durchratterte, kam einfach nicht von der Stelle. Ich war verzweifelt und schwor bei allen Heiligen: Sobald wir auch nur wieder in die Nähe von Bremen kommen, mache ich einen großen Satz…
Irgendwie mussten wir während der Nacht doch noch vorangekommen sein, denn am darauf folgenden Morgen lag das Schiff – völlig ruhig gestellt – im Hafen von Malmö. Der Sturm hatte sich gelegt, aber nun verhinderte dichtes Schneetreiben das Öffnen der Ladeluke. Außerdem hatte sich noch kein Agent eingefunden, auch von den Schauerleuten war noch niemand zu sehen. Kräne und Schuppen trugen dicke weiße Hauben; es war auf einmal tiefster Winter.
Die Decksmannschaft – ein Matrose, ein Leichtmatrose, ein Jungmann und zwei „Mosese“ (d. h. selbstverständlich nur ein Moses, der andere Schiffsjunge, der bereits vor mir an Bord war, hatte die rote Laterne natürlich sofort an mich weitergegeben) – hatte sich in der Mannschaftsmesse unter Deck versammelt und – wärmte sich auf. Allerdings nicht nur mit Tee. Heini, der Matrose und Fiete, der Leichtmatrose, ehemalige Hansa-Fahrer, erinnerten sich an den Persischen Golf und schwärmten von einem Whisky-Schuppen in „Koramscha“. Jungmann Siegfried konnte da nicht mithalten; er war bislang nur in der „Kleinen Fahrt“ und hielt sich deshalb bescheiden zurück. Heiko, mein Vorgänger als Moses, frotzelte mich ungeniert wegen meines Totalausfalls. Diese freche Bremer Rotznase, ich würde es ihm schon noch einmal zeigen… Meine Lebensgeister hatten sich, dank Hannas körniger Brühe und mit etwas Pott-Rum im Tee, wieder zurückgemeldet. Ich war nun wieder bereit, den Kampf gegen die Elemente aufs Neue aufzunehmen.
Der ließ nicht lange auf sich warten. Nach dem Löschen der Ladung war als nächster Hafen Oskarshamn unser Ziel. Kaum, dass wir aus dem Sund heraus waren und unser Kurs sich erneut gen Osten richtete, wurden wir auch schon wieder von einem steifen, eisigen Wind gebeutelt und von kurzen, harten Wellen durchgeschüttelt. Ich aß trocken Brot und hing – nicht wieder über der Reling, sondern im Ruder. Genauer gesagt, im mannsgroßen, hölzernen, Messing beschlagenen Steuerrad. Die Haltezapfen der Speichen fest im Griff, versuchte ich das Unmögliche, nämlich: das Schiff auf Kurs zu halten. Die Ruderanlage der STADERSAND bestand aus einer höchst primitiven, rein mechanischen Kraftübertragung. Jeder etwas härtere Wellenschlag auf das Ruderblatt wirkte sich auf das Steuerrad wie eine Ohrfeige aus. Bei schwerem Wetter war es ein regelrechter Kampf gegen die Naturgewalten, und ich sollte es noch erleben, dass wir selbst mit drei Mann nicht in der Lage waren, das Ruder zu bändigen. Im Augenblick kam die See direkt von vorn. Das war relativ günstig zum Steuern. Ich musste nur aufpassen, den Kurs auch zu halten, um der groben See keine seitliche Angriffsfläche zu bieten. Als es dann doch passierte, versuchte ich, das plötzlich „durchdrehende“ Steuerrad abzubremsen, indem ich die flache Hand gegen den Messingbeschlag des Rades presste. Mit dem Erfolg, dass es mir die Hautfetzen vom Handballen nur so abzog… Nach einer Stunde härtesten Kampfes gegen die Unbilden der Natur und der Technik – die STADERSAND hatte selbstredend keinen Kreiselkompass, und der Magnetkompass, nach dem wir steuerten, befand sich über uns, sozusagen auf dem Dach der Brücke, dem Peildeck – wurde ich endlich abgelöst. Meine linke Hand schmerzte, mein Nacken schmerzte durch das ständige Hochgucken in eine Periskopröhre, in der sich der jeweilig präsente Kursausschnitt widerspiegelte. Meine total verkrampften Beinmuskeln schmerzten, und meine Arme – die spürte ich gar nicht mehr… Aber – und das merkte ich erst, als ich mich an meinem Ausguckplatz hinter einem der Brückenfenster verkeilt hatte und – bereits wieder würgend – in die schwarze, stockfinstere Nacht starrte – ich hatte, solange ich am Ruder stand – keine Zeit für die Seekrankheit gehabt…
Sechs lange Stunden dauert eine Wache auf einem Zwei-Wachen-Schiff. Drei Stunden davon stand ich am Ruder. Mein Eignungstest war demnach positiv ausgefallen. Hanna, der ich fürderhin nicht mehr zur Verfügung stand, war etwas verschnupft. Denn Heini, der alt gediente Matrose, der nun des lästigen Wachdienstes ledig war, half nicht beim Kartoffelschälen… Ich hingegen war nicht wenig stolz darauf, zusammen mit dem Jungmann Sigi auf der Kapitänswache, die von 06:00 h bis 12:00 h und von 18:00 h bis 24:00 h dauerte, zu sein.
Von wegen: untauglicher Schluchtenscheißer! Den „Seppl“ allerdings, den musste ich mir gefallen lassen; selbst der Alte rief mich so… Eigentlich lief es für mich ganz gut in diesen ersten Tagen auf See. Wenn mich nur die vermaledeite Seekrankheit und die daraus resultierende lähmende Müdigkeit nicht so fest im Griff gehabt hätten! Das Kraft raubende Steuern in schwerem Wetter war eine einzige Qual, und der Schlaf in meiner Oberkoje, aus der ich immer wieder heraus katapultiert zu werden drohte, brachte auch keine Erholung. Die Schlafkojen in den winzigen Zwei-Mann-Logis waren querschiffs angebracht. D. h., dass man im Seegang bei Rollbewegungen, je nach Umfang des Rollens, mehr oder weniger auf den Füßen bzw. auf dem Kopf stand. Beim Stampfen hingegen wurde man gegen das Schott gedrückt oder eben, wenn man nicht mittels eines „Steckbrettes“ vorgesorgt hatte, herausgeschleudert. Heiko, mit dem ich die Kabine teilte, ging die Steuermannswache. Das war schon ein großer Vorteil, so konnte ich wenigstens mein Elend vor ihm verbergen. Die meiste Zeit in meiner Freiwache verbrachte ich zusammengerollt wie ein Hund auf der schmalen Holzbank zwischen der Bordwand und dem fest im Boden verankerten Tischchen.
Wie es gekommen war, das hatte ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Tatsache war, als ich zur Vormittags-Wache geweckt wurde, war die Fahrt aus dem Schiff und – es rührte sich kein bisschen. Lediglich schabende, knirschende Geräusche, die von außen herein drangen, waren zu vernehmen. Auf der Brücke angekommen, staunte ich nicht schlecht: Wir steckten im Eis fest! Der Steuermann war während der Nacht völlig ahnungslos im südlichen Ende des Kalmarsunds in ein Eisfeld geraten. Weiß der Teufel, wie das geschehen konnte. Das Schiff verfügte über kein Radar, aber es war zumindest funktechnisch ausgerüstet. Somit hätte man wohl in der Lage sein müssen, Warnnachrichten abzuhören. Solche Betrachtungen jedoch gehörten damals nicht zu meinen Sorgen. Mochte sich der Alte Sorgen machen, der sich nun fluchend den Kopfhörer angelte… Für mich zählte nur: Dieses Schaukel-Schinakel, diese Sardinenbüchse von einem Schiff lag endlich still. Nun, ganz so still auch wieder nicht, eher völlig bewegungslos, völlig hilflos – weder vor noch zurück könnend. An der blechernen Bordwand – die STADERSAND hatte keine „Eisklasse“ – schob sich, vernehmlich knackend, gebrochenes Eis hoch. Dem Alten war das ganz und gar nicht geheuer, und er bat die schwedische Küstenwache inständig, uns doch aus dieser Falle zu befreien… Ich, darauf hoffend, dass dies nicht so schnell geschehen möge, betrachtete ganz entspannt die Gegend. Soweit man sehen konnte, und das war im Schneegestöber nicht allzu weit, nichts als eine schneebedeckte Eisfläche. Wenn das Gestöber nachließ, konnte ich in einiger Entfernung an Steuerbord eine schemenhaft dunkel aufragende Erhebung erkennen. Der auf dem Kartentisch ausgebreiteten Seekarte nach musste es eine klitzekleine Insel sein: „Bla Jungfrun“ geheißen. Das befruchtete meine Fantasie – aus bla wurde blau, aus blau gefrorenen Jungfrauen Weinflaschen schwingende, trunkene Bacchantinnen. Diese Wunschvorstellung – oder war es etwa schon Wahn? – erwärmte und erheiterte mein Herz so sehr, dass ich zu hopsen und zu trällern anhub. Für den Alten natürlich völlig grundlos; er betrachtete mich irritiert und verständnislos, um nicht zu sagen: misstrauisch…
Die Bemühungen unseres Kapitäns hatten endlich Erfolg. Der in der Nähe operierende schwedische Eisbrecher „IMAN“ sollte uns aus dieser misslichen Lage befreien. Es dauerte aber immerhin noch 24 bange Stunden – ich hatte mich in der Zwischenzeit prächtig erholt – bis der dunkle Koloss schnaubend, rasselnd, knirschend vor uns aus der grauweißen Einöde auftauchte. Uns umkreisend, zerbrach er das uns festhaltende Eis. Ich betrachtete interessiert seine Arbeitsweise. Das bullige Schiff schob seinen unten abgeflachten Bug einfach auf das Eis und brach es. Dabei schwänzelte es mit dem massiven Heck wie eine große, fette rußige Ente, um die gebrochenen Eisschollen auch noch zu zerkleinern. Schließlich setzte sich die „Ente“ vor uns und machte uns deutlich, ihr möglichst dicht aufgeschlossen zu folgen. Das allerdings war für unser schwachbrüstiges Schiffchen so einfach nicht. Um überhaupt folgen zu können, mussten wir uns relativ dicht hinter das spitze, zusätzlich mit Stahl verstärkte Heck des Eisbrechers halten. Das hatte zur Folge, dass es immer wieder sehr eng wurde, wenn die IMAN plötzlich stoppte oder gar ein Stückchen rückwärts fuhr, um notfalls mit einem neuen Anlauf größere Eishürden zu nehmen. Wurde indessen der Abstand auch nur etwas zu groß, steckten wir sogleich wieder im Brucheis fest.
Auf der Brücke der STADERSAND musste daher ständig der Maschinentelegraf bedient werden, der lediglich aus einem kleinen Handrad mit einem Kurbelgriff bestand. Mir traute man diese Aufgabe noch nicht zu, ich durfte steuern, was in diesem Fall ja sehr einfach war… Irgendwann dann, in der zweiten Nachthälfte, als ich friedlich schlummernd in meiner Oberkoje lag, gab es einen gewaltigen Bums. Das Schiff stoppte augenblicklich, und ich fand mich wieder auf dem harten Fußboden meiner Unterkunft. Ein Eisberg? Etwa so, wie bei der „TITANIC“? Dergleichen schoss mir durch den Kopf, und ich stürzte so, wie ich war, halbnackt an Deck. Da stand ich dann im gleißenden Licht der Scheinwerfer des Eisbrechers, dem wir offensichtlich zu nahe gekommen waren…
Und das kam so: Der Steuermann, der dem Leichtmatrosen Fiete oft genug stundenlang die Wache ganz alleine anvertraute, befahl Fiete, ja die Finger vom „Gasrad“ zu lassen. Das kränkte Fiete, schließlich war er bereits gewohnt, selbstständig zu handeln, sobald der Steuermann die Brücke zum „Zeugwäschemachen“ verließ. Nun konnte aber der gute Mann selbst in dieser heiklen Situation seine Sucht nicht beherrschen und verließ mal kurz die Brücke – wegen „Zeugwäsche“… Und wie der Teufel es will, stoppte auch mal kurz der Eisbrecher. Und Fiete, eingedenk der Order, die Finger vom Fahrtregler zu lassen, knallte kaltblütig auf das zugespitzte, Stahl verstärkte Hinterteil des Eisbrechers. Diesen störte das nicht weiter. Die STADERSAND aber schon, denn sie hatte daraufhin ein enormes Loch im Steven. Das war zum Glück hoch genug über dem Wasserspiegel, so dass wir schließlich dennoch Oskarshamn aus eigener Kraft erreichten. Dort angekommen, bestellte der Alte Handwerker. Die bastelten – als Provisorium – auf der Innenseite des aufgerissenen Buges einen Holzkasten, den sie mit Beton ausfüllten. Und, wie das halt so ist mit Provisorien – ich kann mich nicht erinnern, dass das Schiff während meiner ganzen neunmonatigen Bordanwesenheit auch nur für kurze Zeit in einer Werft gewesen wäre…
Von Oskarshamn, dem vereisten Kalmar-Sund das Heck zeigend, ging es dann weiter in Richtung Norden. Eiskalter Gegenwind peitschte das Wasser. Schäumende Gischt fegte über das Schiff hinweg und schlug sich als Eis an Deck, an den Aufbauten und Masten nieder. Das Schiff, dieser elende Wurstwagen, bockte, torkelte, versuchte immer wieder auszubrechen, was ich als Rudergänger nach Kräften zu verhindern hatte. Weiß Gott, woher ich die Kraft hatte, das störrische Steuer zu bändigen, denn mir war hundsübel. Ich verwünschte meine Geburt und bereute zutiefst meinen törichten Entschluss, mich unbedingt als Seemann bewähren zu müssen. Der Alte hatte keinen Blick für mich und mein Elend; er hatte andere Sorgen. Das Eis an Deck, besonders auf dem Vorschiff, nahm kontinuierlich an Dicke zu, und die Bewegungen der STADERSAND wurden irgendwie behäbiger, schwerfälliger. Geradezu bedächtig neigte sie sich von einer Seite zur anderen, wobei der Bug immer tiefer wegsackte…
Irgendwann erreichten wir dann doch noch Landsort, den südlichsten Punkt des Stockholmer Schärenbereichs. Die Lotsenübernahme endete mit einer Beinahe-Katastrophe: Der Lotse, der mit einem gewagten Sprung unser tief im Wasser liegendes Schiff quasi enterte, schlug auf dem vereisten Deck erstmal lang auf und rutschte der Länge nach der Treppe zum Achterdeck entgegen. Mochte seine Laune, ausgerechnet so einen „Wurstwagen“ lotsen zu müssen, schon vorher nicht die beste gewesen sein; nach der Rutschpartie, bei der auch noch sein schmuckes Käppi verloren ging, war sie sicherlich nicht besser geworden. Meine Laune hingegen besserte sich schlagartig, sobald das Schiff innerhalb der schützenden Schären wieder ruhig im Wasser lag. Die stundenlange nächtliche Fahrt zwischen den Inseln und Inselchen, die ich nur als dunkle, mit Leuchtfeuern versehene Schatten wahrnahm, nahm mich als Rudergänger voll in Anspruch. Ständig wechselnde Kurse, ins Fahrwasser ragende Felsen, Bojen, die nur mit Hartruderlage umschifft werden konnten, das Beachten und exakte Ausführen der Lotsenkommandos – das alles übte ungemein. Und obwohl ich die Kiste beinahe auf einen der vielen Steine gesetzt hätte, weil das Schweineschiff ob seiner Kopflastigkeit durch das viele Eis auf der Back sich nur schwer steuern ließ, war ich doch der Meinung, gute Arbeit geleistet zu haben. Auch der Alte schien mit mir zufrieden zu sein. Von Stockholm selbst allerdings weiß ich nichts zu berichten, außer dass wir erst mühsam das Schiff „enteisen“ mussten, um die Ladeluke überhaupt öffnen zu können.
Nach dem Löschen der schwer ramponierten Ladung ging es im Ballast nach einem Zellulosewerk bei Gävle. Dort sollten wir Zellulose für Bremen laden. Wiederum in stockfinsterer Nacht passierten wir die Schären, wiederum in nördlicher Richtung. Wiederum zeigte uns der Nordwind, spätestens nachdem wir das Feuerschiff „SVENSKA BJÖRN“ hinter uns gelassen hatten, seine hässliche Fratze. Wiederum erfasste mich sogleich die vermaledeite Seekrankheit, und überdies hatte ich keine der Kälte angemessene Unterhose… Trotz übereinander angezogener Hosen und Pullover fror ich während der Ladungsarbeiten im Hafen jämmerlich. Ich beneidete die Hafenarbeiter um ihre Beweglichkeit, die mit einem gekonnt angewendeten Stauhaken die schweren Zellulosepakete mit scheinbarer Leichtigkeit an ihren Stauplatz beförderten. Ich hingegen stand mir an Deck die Füße in den Bauch – auf des Steuermanns Anordnung und nach meinem Dafürhalten völlig unsinnigerweise. Der Steuermann hingegen, der machte wieder einmal mehr „Zeugwäsche“. Auch meine anderen Kollegen wärmten sich mit Tee mit Rum oder gleich mit einem steifen Grog in der Mannschaftsmesse auf. „Moses“ zu sein, ist – verdammt noch mal! – wirklich kein Honiglecken…
Die „Heimreise“ nach Bremen auch nicht. Die Wellen, die nun meist von achtern oder seitlich anrollten, schoben und hoben und senkten das kaum steuerbare Schiff nach Belieben. Die Ostsee, die für mich bislang ja gar kein richtiges Meer war, eher so was wie ein größerer Ententeich, zahlte mir meine dümmliche Überheblichkeit gründlich heim. Halb über die Reling hängend, würgte und kotzte ich, spuckte gegen den Wind, kämpfte mit dem Steuerrad, das mir bei allzu heftigen Wellenschlägen auf das Ruderblatt immer wieder mal regelrecht aus den Händen gerissen wurde, und versuchte dann, während der Freiwache, in voller Verzweiflung über meine aussichtslose Situation, etwas Schlaf zu finden. Und wenn mir auch zum „Überbordspringen“ war, wenigstens bis Bremen wollte ich noch durchhalten und dann – dann nichts wie weg… Dann aber, spätestens ab Kiel-Holtenau, im Nord-Ostsee-Kanal, regten sich bei mir wieder die Überlebensgeister. Ich interessierte mich wieder für Hannas Kochkünste, und wenn ich auch von der norddeutschen Kost noch immer nicht sehr angetan war, der Hunger trieb es rein… In Bremen angekommen, ging es mir bereits wieder so gut, dass ich – eingedenk der hinterfotzigen Bemerkung meines Stiefvaters: „In vierzehn Dag bist eh wieda do!“ – es doch noch einmal versuchen wollte…
Die STADERSAND, zu diesem Zeitpunkt noch in Charter für die Reederei Ahlmann und von dieser in der Skandinavienfahrt eingesetzt, fuhr also wieder gen Norden. Eine Reihe schwedischer Häfen, von Karlskrona bis Lulea, waren das Ziel der nächsten zwei Wochen. Ich hoffte inbrünstig, dass sich doch um Himmels Willen das Wetter etwas gebessert haben möge. Schließlich hatten wir schon fast April. Kurz gesagt, hatten wir dann auch die meiste Zeit über Aprilwetter… Um das berühmte „eine Haar“ wäre die Reise an ihrem Anfang bereits zu Ende gewesen: In der Elbmündung bei Cuxhaven, Höhe Kugelbake, lief mir das Schiff nach dem Passieren eines „Dickschiffes“ und infolge des Gezeitenstromes plötzlich aus dem Ruder. Selbst zu dritt – der Alte, der Lotse und ich – vermochten wir vorerst nicht, das Steuerrad aus seiner Hart-Backbord-Lage zurückzudrehen. Wie schon gesagt, um das berühmte Haar wären wir dabei von einem nachkommenden großen Frachter, einem Überholer, untergemangelt worden. Sobald wir das Schiff wieder auf Kurs hatten – und die beiden Herren sich beruhigt hatten – durfte ich wieder alleine steuern. Es gab keine Schuldzuweisungen; der Alte wusste nur zu gut, wie schwer sich diese Gurke bei Kopflastigkeit und dann noch im Strom steuern ließ. Das Steuerproblem war demnach auch ein Beladungs- und Stabilitätsproblem – aber davon verstand ich damals selbstredend noch nichts…
Die Fahrt durch die Ostsee bis in den bottnischen Meerbusen verlief – Gottseidank – ohne größere Zwischenfälle. Ich wurde immer noch seekrank, wenn auch nicht mehr so doll wie auf der vorigen Reise. Immer noch war es saukalt, wenn wir auch keine „Eisberührungen“ mehr hatten. Das Ein- bzw. Aufrollen der hart gefrorenen Persenninge, die der Lukenabdichtung dienten; das händische Aufkurbeln der zwei Ladebäume im eisigen Frost; überhaupt alle Arbeiten im Hafen ließen sich – laut Heini und Fiete – nur mit aufwärmendem Getränk bewältigen.
Dieser Meinung waren offensichtlich auch nicht wenige Einheimische, obwohl die anscheinend nicht gerade zur arbeitenden Bevölkerung zählten. Hinter den Hafenschuppen versteckt, lauerten sie auf einen günstigen Moment, um – vom Zoll unbemerkt – ans Schiff zu gelangen und von uns Schnaps zu erbeuten. „Ha du Snaps?“ war die Standardfrage – und meistens hatten wir: pro Nase mindestens eine Flasche Sprit und dazu noch eine Stange Zigaretten. Das brachte pro Flasche bis zu zwanzig Schwedenkronen – bei meiner Heuer von geraden einmal fünfundsechzig Deutschmark eine nicht zu verachtende Nebeneinnahme. Eine Flasche Spirituosen und eine Stange Zigaretten wurden vom örtlichen Zoll für die jeweilige Liegezeit im Hafen in der Regel als offizielles Guthaben genehmigt. Alles, was mehr war, war Konterbande und fiel in die Kompetenz der von uns so gefürchteten „Schwarzen Gang“. Diese, bestehend aus mehreren in schwarzen Overalls steckenden Männern, kam stets urplötzlich und vor allem unangemeldet an Bord und durchsuchte das ganze Schiff, sowohl den privaten als auch den übrigen Bereich, nach Schmuggelware. Auf der STADERSAND lohnte sich solch ein Aufwand fürwahr nicht. Bei uns wurde nur im ganz kleinen Stil geschmuggelt; und nur diejenigen, die den Hansen-Rum oder den Asbach Uralt für sich selbst benötigten, besorgten sich zusätzlich ein, zwei Flaschen Sprit fürs Geschäft. Wo meine Kollegen ihre „heiße Ware“ versteckten, blieb mir lange verborgen. Mein erster Versuch, wenigstens eine Stange Zigaretten – die mir wegen meines Seekrankseins sowieso nicht schmeckten – am Zoll vorbei zu kriegen, schlug prompt fehl. Das Kabelgatt, ganz vorne unter der Back, schien mir der geeignete Ort zu sein, die Zigarettenpackungen einzeln zwischen allerlei Gerätschaften zu verstecken. Als die „schwarzen Männer“, anscheinend ohne fündig geworden zu sein, wieder von Bord waren, gedachte ich frohgemut, meine Zigaretten wieder einzusammeln, um sie postwendend zu verscherbeln. Doch ach, bitter war die Enttäuschung, ich fand nicht eine einzige Packung wieder. Dabei musste ich noch froh sein, dass einer der Zöllner sie bloß so eingesackt hatte und ich somit keine Buße aufgebrummt bekam. Heiko, mein Kammergenosse, meinte schadenfroh: Etwas im Kabelgatt zu verstecken, so doof kann nur ein Neuling sein… Das Warum – und vor allem, wo er denn sein Zeug versteckte, verriet er mir nicht. Um das zu erfahren, bedurfte es erst einer „Begegnung“ mit dem Schmierer Manfred. Manfred war als Maschinenjunge gemustert, hatte ein äußerst unappetitliches Aussehen, seine dreckigen Klamotten waren immerzu verölt, er roch drei Meilen gegen den Wind nach Gasöl. Ich hatte ihn bislang eigentlich nur dann zu sehen bekommen, wenn er auf dem Bootsdeck, gleich hinter der Brücke und direkt am Schornstein mit einer Handpumpe den Tagestank für Gasöl auffüllte. Manfred war stark und groß, hatte ein rundes Pickelgesicht, in das ihm schmutziggelbe Haarsträhnen fielen. Ich brauchte ihn gar nicht zu sehen; wenn ich ihn nur roch, wurde mir gleich noch übler, als es mir meist sowieso schon war. Aber was immer man gegen sein Äußeres vorbringen konnte, vom Gemüt her war er einfach hilfsbereit. Und er war es dann auch, der mir den Tipp gab, mich wegen dieses Problems doch an Meister Lottl, den alten Mann in der Maschine, zu wenden. Meister Lottl, einen spindeldürren, langen Menschen in der gebeugten Haltung eines langjährigen Kellerbewohners, hatte ich bislang nur zu sehen bekommen, wenn er mal kurz zum Luftholen an Deck erschien. Er war mir freundlich gesinnt; und fortan durfte ich meine bescheidene Konterbande ihm anvertrauen. Das geniale, vom Zoll niemals – jedenfalls nicht während meiner Ägide – entdeckte Versteck war das Innere der abgestellten Abgasturbine… Da die schmale Heuer am Monatsende stets durch irgendwelche Vorschüsse in der Regel bereits aufgefressen war, waren die Schmuggelkronen somit das einzig „wirkliche“ Geld, das ich im „Jahr der STADERSAND“ in die Hände bekam…
… und von dem ich mir als erstes einen schicken, bunt gemusterten „Norweger“ kaufte und – dicke Wollsocken für die unvermeidlichen Gummistiefel. An so einen Luxus wie etwa Sicherheitsschuhe verschwendete man damals in der christlichen deutschen Schifffahrt noch keinen Gedanken. Ich natürlich auch nicht, Arbeitssicherheit war für mich damals ein völlig abstrakter Begriff. Die wichtigste Frage für mich hieß: Wie werde ich schnellstens seefest? Und dafür gab es leider keine verbindliche Antworten, nur leidvolle Erfahrungen. Eine dieser Erfahrungen war, dass man sich auf keinen Fall durchhängen lassen durfte, weil man sonst möglicherweise durchdrehte. So gesehen war es ganz gut, dass mir der nicht endende Wachdienst und das anstrengende Steuern, das ich schon ganz gut beherrschte, nur wenig Zeit für mitleidsvolle Selbstbetrachtungen ließen.
Meine zweite Seereise – ich war nun schon über einen Monat an Bord – ging zu Ende. Der Nord-Ostseekanal lag bereits hinter uns, und wir tuckerten unter Lotsenberatung die Elbe hinunter. Das Schiff zog ruhig durchs Wasser, mir ging es wieder gut, und so beschloss ich, doch noch eine nächste Reise zu versuchen. Der Alte, der sich wie üblich während der Kanalfahrt ausgeruht hatte, unterhielt sich gut gelaunt mit dem Lotsen im schönsten Platt über ditt und datt. Ich stand hinter’m Steuer und musste hören, wie der Alte zum Lotsen sagte: „Tja, un een Seppl heb wi ok on Bord“. – „Soso“ sagte der Lotse „kann he ok schon en betten Platt?“ – „Jau“ krähte ich ungefragt dazwischen „klei mi am Mors!“… Das war nun mal einer der ersten Sätze auf „Platt“, den ich inzwischen oft genug zu hören bekommen hatte, aber in diesem Fall kam es wohl nicht ganz so gut an; der Lotse drehte sich kurz nach mir um und musterte mich kalten Blickes…
In Bremen gab es für den Alten eine böse Überraschung: Die Charter war gekündigt worden. Böse deshalb, weil keine neue Charter in Sicht war und die STADERSAND in die „wilde Fahrt“ gehen sollte. Das bedeutete für Kapitän und Steuermann, dass sie nicht mehr mit festen Liegezeiten in Bremen rechnen konnten und somit ihr Familienleben darunter zu leiden hätte. Familienleben? Nun, das war mein Problem nicht. Im Gegenteil, ich freute mich auf die so genannte „wilde Fahrt“, weil sich mir ein weiterer Horizont auftat. Zuerst aber tat sich etwas anderes. Aus Einsparungsgründen – denn ab jetzt musste der Eigner selbst für sein Schiff aufkommen – wurden Hanna, die Köchin, und Heini, der alte Matrose, entlassen. Die Besatzung bestand jetzt aus dem Kapitän nebst Steuermann, dem Maschinisten Lottl, unterstützt von Manfred, dem Schmierer. An Deck hatte von nun an Fiete, der Leichtmatrose, das Sagen über Jungmann Siegfried und über Heiko und mich, die beiden Schiffsjungen. Die bange Frage aber war: Wer sollte wohl in Zukunft den Smutje machen?
Nach einer missglückten Proviantübernahme im Bremer Europahafen war diese lebenswichtige Frage erstmal vom Tisch. Wahrhaft, ein Malheur mit einschneidenden Folgen für die nächsten Wochen, denn der reiche Eigner des Schiffes, Reeder und Ziegeleibesitzer und weiß der Teufel was noch, verbat es sich, Proviant nachzubestellen. Was passiert war? Nun, als der Schiffshändler mit den bestellten Ausrüstungsgegenständen inclusive Proviant endlich am Liegeplatz eintraf, waren die Umschlagsarbeiten längst abgeschlossen. Zur Übernahme stand dann auch kein Kran mehr zur Verfügung. Zu diesem Übel kam noch, dass gerade Ebbe war, so dass von unserem mickrigen Schiff gerade mal die Mastspitzen über die Pier hinaus ragten. Auch das eigene Ladegeschirr war unter diesen Umständen nicht verwendbar. So fierten wir alle Gegenstände mit einem Tampen an den Spundwänden entlang einzeln aufs Bootsdeck hinunter. Oben an der Pier werkten die beiden Kräftigeren, Siegfried und Heiko, während Fiete und ich die Dinge in Empfang nahmen. Bei all den „unwichtigen“ Dingen, wie Farbe, grüne Seife, Piassavabesen klappte es auch vorzüglich: Die jeweilig speziell angebrachten Seemannsknoten hielten, was sie halten sollten. Auch die vollen Bierkisten für den Steuermann, all die wichtigen Spirituosen und Zigaretten kamen unten an. Nur ausgerechnet bei der unförmig großen Proviantschachtel, in der sich die guten Sachen wie Kaffee, Tee, Dosenmilch, Dosenwurst, Dosengemüse, Dosenobst etc. befanden – ausgerechnet bei der löste sich der sonst zuverlässige „Zimmermannssteg“ vorzeitig, und die Schachtel landete, am Heck knapp vorbei, im „Bach“. Und noch bevor wir richtig begriffen, was passiert war, versank das Fresspaket vor unseren verdutzten Blicken im verdreckten, schmutzigbraunen Hafenwasser…
Genau genommen, so hart wie die anderen, traf mich das nicht. Auch ohne seekrank zu sein, ekelte es mich vor solchen Delikatessen wie „Schlimme-Augen-Wurst“, „Jagdwurst“, grobschlächtige Sülze… Was mich dann jedoch voll traf war, dass ich, zusätzlich zum Wachdienst, den Koch machen sollte. Wieder ich, immer ich, das war doch echt zum Kotzen. Mein erstes Essen aber, dass fanden dann die anderen zum Kotzen bzw. nicht essbar. Ich hatte mich, ob ich nun wollte oder nicht, an frischen Bratwürsten – in Brunsbüttel eingekauft – zu vergehen. Dazu sollte es noch Kartoffelpüree mit Sauerkraut geben. Aber mir fehlte nicht nur der gute Wille, sondern wohl auch das richtige Händchen für die Hohe Schule der Kochkunst. Die vordem saftigen, noch dazu privat erstandenen Bratwürste glichen nach meiner Behandlung dürren, saftlosen Hundeködls, und das Püree hatte die Konsistenz von Kernseife. Lediglich das Sauerkraut blieb als einigermaßen genießbar übrig. Das alleine aber rettete mich nicht vor dem vernichtenden Urteil der gesamten Mannschaft. Ich wurde ab sofort für immer aus der Kombüse verbannt – was mir nur recht war. In der Folge versuchte sich abwechselnd mehr schlecht als recht der eine oder andere als Kochkünstler. Irgendwann stellten wir unisono fest, dass ausgerechnet der pickelige, schmierige, stets nach Gasöl stinkende Manfred das noch am ehesten genießbare Essen zubereitete…
Da mir der herbe „Bünting“-Tee ebenso wenig zusagte wie der den Magen zersetzende Muckefuck, mixte ich mir so zwischendurch, sehr zum Ärger meiner Kollegen, gerne einen „Drink“ aus Dosenmilch und heißem Wasser, den ich mir mit Zucker versüßte. Dosenmilch und Zucker waren aber, seit das Schiff auf eigene Rechnung fuhr, streng rationiert. So wachte jeder neidvoll über die „Völlerei“ des anderen. Zwistigkeiten deswegen waren schier unvermeidbar. Es kam so, wie es kommen musste: Heiko und ich wurden deshalb handgreiflich, und ich schüttete ihm zornentbrannt das bereits im Keramikbecher befindliche heiße Wasser vor den Latz. Heiko holte aus, ich sprang, dem Schlag ausweichend, auf die mir aus der Hand gefallene Muck. Unglücklicherweise war der oberste Rand der Muck abgesprungen und der nun scharfkantige Becherrand bohrte sich in die nackte Sohle meines rechten Fußes.
Als dies passierte, war es längst Sommer geworden. Ich war die längste Zeit schon seefest und natürlich auch längstens ein vollwertiges Besatzungsmitglied. Aus diesem Grund, nehme ich an, nahm es der Kapitän auf sich, für mich im nächsten Hafen einen Arzt an Bord zu bestellen. Unser Bestimmungshafen war Gent, und irgendwo während der Kanalfahrt dahin machte das Schiff deswegen an irgendwelchen Dalben fest. Es gab keine feste Landverbindung, der kleine, rundliche Doktor musste über ein schmales, schwingendes Etwas – wobei ihm prompt seine Arzttasche „in den Bach“ fiel… Der gute Mann ließ sich aber nicht entmutigen, besorgte sich Ersatz und hatte dann größte Mühe, meine zerschnittene Fußsohle irgendwie zusammenzuflicken. Meine Fußsohlen waren durch das bequeme Barfußlaufen auf dem Eisendeck zäh wie Schweineleder geworden. Der kleine Doktor bemühte sich redlich. Bald rannen ihm die Schweißperlen von der Stirn, während er die halbmondförmigen Nadeln mit einer Kombizange durch die Hornhaut zog. Eine nach der anderen ging dabei entzwei. Meine Kameraden, die ihm neugierig über die Schulter sahen, sparten unter johlendem Gelächter nicht mit fachlichen Ratschlägen. Und ich – durch das vorherige Vereisen spürte ich ja nichts – ich grinste dämlich…
Das Grinsen allerdings verging mir alsbald. Die Wunde wollte und wollte nicht heilen, vereiterte… Da man an Bord eines deutschen Schiffes in jener Zeit nur dann als krank galt, wenn man mit dem Kopf unterm Arm herumlief, lief ich – nein stand ich, weil ich ja beim besten Willen nicht mehr laufen konnte – nur noch am Ruder: Stundenlang, eine ganze Wache lang, tagelang, nächtelang, bis… Bis mir schwarz vor den Augen wurde und sich der Steuermann meiner erbarmte. Der erinnerte sich an seine Fischdampferzeit und kurierte mich auf seine Weise. Er verordnete mir Fußbäder in einer kräftigen Lauge aus „Grüner Seife“. Die Wirkung war verblüffend, binnen weniger Tage verschwand die eitrige Entzündung, und die doch beträchtliche Wunde verheilte rasch und anstandslos. Den Kapitän erinnerte dieser Vorfall anscheinend an seine Aufsichtspflicht; fürderhin war uns das Barfußlaufen an Bord verboten. So erstand ich dann beim Schiffshändler in Rendsburg für meine Schmuggelkronen nicht nur, wie üblich, Trinkmilch und Schokolade, sondern notgedrungener Weise auch noch ein Paar handelsüblicher Plastiksandalen.
Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal – die „Alten“ sprechen noch immer vom Kaiser-Willem-Kanal – wurde so quasi zu unserem Heimathafen. Auf unseren Reisen von dem bottnischen oder dem finnischen Meerbusen zu den belgischen Scheldehäfen frequentierten wir diese Abkürzung zwischen der Ostsee und der Nordsee monatlich drei- bis viermal. Die Abkürzung ist so beträchtlich eigentlich nicht, und für schnelle Schiffe auf langem Törn fällt die Kosten-Nutzen-Rechnung möglicherweise zu Ungunsten des Kanals aus. So eine Rechnung stand ja auch bei der Planung dieser Meeresverbindung, die1895 fertig gestellt wurde, erst gar nicht zur Debatte. Inzwischen hatten die Preußen ja auch eine ansehnliche Flotte modernster Kriegsschiffe; deshalb ging es besagtem Willem lediglich darum, seine „Kanonenboote“ nach Bedarf von A nach B – besser gesagt von K wie Kiel nach W wie Wilhelmshaven – zu verlegen. Ich gehe als selbsternannter Marinehistoriker und aus jetziger Sicht so weit zu sagen: Ohne den Nord-Ostsee-Kanal, pardon – „Kaiser-Wilhelm-Kanal“ – hätte es keine „Doggerbank-“ und auch keine „Skagerrak-Schlacht“ gegeben. Diese ruhmreichen, weltbewegenden Seeschlachten, die den übrigen Kriegsverlauf jedoch nicht im Geringsten beeinflussten, wären ohne die Weitsicht und Tatkraft eines Willem II. einfach nicht Geschichte geworden…
– Zeichnung aus Band 40 von Heinz Rehn –
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Rendsburg! Es gibt da eine auf einer Briefmarke verewigte, stählerne Eisenbahn-Hochbrücke aus Willems Zeiten zu bestaunen – ja, schon wieder dieser Wilhelm! Über dieses in die flache Landschaft hinein versetzte hohe Eisengerüst kriechen noch immer Züge langsam und angstvoll hinweg. Wir hatten unter durch zu kriechen; bei unserer Größe kein Problem. Meine Sorge galt mehr dem, was eventuell von oben hätte herunter kommen können…
Dass es in Rendsburg auch ein Seemannsamt gab, das meine Anmusterung auf der STADERSAND mit einem ordentlichen, amtlichen Stempel versah, hatte ich schon erwähnt. Weitaus wichtiger war jedoch die Tatsache, dass hier der ortsansässige Makler, der sozusagen unser „Briefkasten“ war, regelmäßig das Schiff, egal zu welcher Tages oder Nachtzeit, mit der Außenwelt verband. Dabei kann ich mich nicht mehr entsinnen, ob ich überhaupt auch nur einen einzigen Brief geschrieben oder vielleicht einen erhalten habe. Ich war doch mit mir, dem Schiff und mit all den anderen Umständen viel zu beschäftigt, um auch noch Zeit zum Schreiben zu finden. Und dann, wen interessierte es schon, außer meiner Mutter, wie ich mit den Unbilden der Seefahrt zuwege kam? Dieser Briefkasten war daher eher so etwas wie ein Placebo – würde man heutzutage sagen: Man hätte ja schreiben können, es hätte sich ja jemand, na ja…
Was sonst noch zum Kanal zu sagen wäre. Ich, als inzwischen routinierter Rudergänger, kannte ihn bald in- und auswendig – so wie ein Jäger sein Revier oder ein Pater sein Brevier oder – weniger aufwendig – wie ein Nachtwächter seine Gassen. Ich steuerte das Schiff sozusagen im Schlaf durch das kaum bewegte Fahrwasser. Die Schiffe glitten langsam, fast lautlos, mit stark reduzierter Fahrt, um Uferanlagen und die Böschung nicht zu beschädigen, von Ochs und Esel bestaunt, durch die Landschaft. Nur, wenn uns ein „Dickschiff“ entgegenkam, warf mir der Lotse einen kontrollierenden Blick zu, um zu sehen, ob ich denn von selbst auch richtig reagierte. D. h., ich durfte mich von dem „Dicken“ nicht abdrängen lassen und musste vorerst mutig auf dessen Backbord-Steven zuhalten. Natürlich – mit Augenmaß! War man dann beinahe Heck an Heck, musste man das Ruder mit Gefühl nach Steuerbord legen, um der Sogwirkung des Dicken zu entgehen. Darauf sagte dann der Lotse: „Recht so!“ Vielleicht fügte er noch hinzu: „Mitte Kanal!“ und nahm dann die Zeitungslektüre wieder auf, und ich döste, mich am Ruder festhaltend, weiter vor mich hin. Nachts musste man – vor allem der Lotse – schon etwas mehr aufpassen. Zwar sind die Ufer beleuchtet. Bald wusste ich auch den gleich bleibenden Abstand der Lampen beim Befahren der Biegungen zu nutzen. Doch neben dieser Uferbeleuchtung gab es da ja noch eine Unzahl anderer Lichtquellen, wie z. B. Hafen-, Industrie- und sonstige Anlagen, und nicht zuletzt selbstverständlich die Positionslaternen der „Gegenkommer“. Da war es schon gut, den Lotsen an seiner Seite zu wissen, wenngleich ich – aus schier überquellender Selbstüberschätzung – im Stillen der Meinung war, ich bräuchte eigentlich keinen Lotsen…
Der Alte und der Steuermann hingegen waren da sicherlich anderer Meinung. Im Kanal war, im Gegensatz zu den Außenrevieren auf der Elbe und der Weser, auch für ein kleines Schiff Lotsenpflicht. Seit das Schiff nun auf eigene Rechnung fuhr, wurde sowieso – falls überhaupt – in jeder Hinsicht nur noch der Pflicht genügt. Die Beiden waren also heilfroh, bei Anwesenheit des Lotsen auch während ihrer Wache mal die Brücke verlassen zu können, um eine Mütze Schlaf zu nehmen – bzw. „Zeugwäsche“ zu machen…
Gelegentlich überließ mir der Kapitän – bei Tageslicht und auf offener See – über einen kürzeren Zeitraum auch schon mal alleine die Brücke. Mein überbordendes Selbstvertrauen als „Jungsteuermann“ bekam allerdings einen ordentlichen Dämpfer, als ich eine „Beinahekollision“ verursachte. Und das kam so: Auf dem Wege nach Stockholm waren wir eben an Bornholm vorbei und steuerten nun in die Abenddämmerung hinein. Da kam mir, noch gut erkennbar, ein anderes Kümo entgegen. So wie ich es gelernt hatte, veränderte ich den Kurs rechtzeitig um ein paar Grad nach Steuerbord. Vom Gegenkommer durfte ich erwarten, dass er ebenso reagierte. Tat er aber nicht; stattdessen drehte er nach Backbord und zeigte mir seine grüne Seitenlampe. Nun, noch war er in gehöriger Entfernung. Ich legte das Ruder nach Backbord, um wieder auf Kurs zu kommen. Offenbar hatte mein Gegenüber dieselbe Eingebung; er legte das Ruder nach Steuerbord und zeigte mir nun Rot: Wir waren wieder auf Kollisionskurs. Das Spiel wiederholte sich noch zwei-, dreimal – bis es richtig eng wurde und wir in einem Abstand aneinander vorbeirutschten, dass ich dem anderen den Vogel hätte zeigen können, wäre es inzwischen nicht dunkel geworden. Stattdessen schimpfte ich lautstark wie ein Rohrspatz über diesen Idioten da drüben. Der Alte, der von mir unbemerkt, inzwischen auf die Brücke gekommen war, unterbrach mich unwirsch und – schaltete die Positionslichter ein – Scheiße!
Das war aber leider nicht das einzige, was mir zu der Zeit daneben ging. Zum Glück im Unglück war der nächste Misserfolg nicht seemännischer Art. Dennoch wäre er dazu geeignet gewesen, meine Seemannskarriere vorzeitig zu beenden. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, mich, der ich doch nicht die geringste Erfahrung im alpinen Klettern hatte, als Klettermaxe darzustellen. An einer hohen, steilen Felswand innerhalb des Stockholmer Hafengebietes sollte ich nun meinen Kameraden die hohe Schule des Kletterns anschaulich vorführen. Es war eine durch Sprengung künstlich entstandene Felswand, durchzogen von vielen Rissen, Spalten und kleinen Vorsprüngen, auf denen sich Erde und Kiesel abgelagert hatten. Und so ein kleiner, mit losem Geröll bedeckter Vorsprung, auf dem ich irgendwie zu stehen kam, wurde mir dann auch zum Verhängnis. Noch während ich mich – ohne vorher mit den Händen Halt gefunden zu haben, also völlig unsachgemäß – so dicht wie möglich an der Platte hochschob, die es zu überwinden galt, um die nächste Kante zu greifen, begann unter meinen Füßen das bisschen Erde abzurutschen. Ich rutschte mit. Aber noch bevor ich den Stand ganz verloren hatte, drehte ich mich geistesgegenwärtig um und sprang… Sprang punktgenau, wie ein Fallschirmspringer, aus über zehn Meter Höhe exakt auf den schmalen Rand eines Schienenstranges, der direkt neben der Felswand verlegt war. Dazwischen war lediglich noch ein Graben, in dem große, scharfkantige Steine lagen. Den Aufsprung allerdings stand ich nicht durch – da hätte es Punktabzug gegeben… Es warf mich der Länge nach hin; mit vorgestreckten Armen und aufgestellten Handflächen landete ich im Schotter des Gleiskörpers – die eine Schiene unterm Bauch. Der Versuch, sofort wieder aufzustehen, gelang noch, doch kam ich nicht allzu weit. Inzwischen hatte sich mein Publikum vom ersten Schrecken erholt, und die verdatterten Kameraden schleppten mich an Bord.
Der Alte war, wie man sich denken kann, nicht sehr begeistert über diesen völlig unnötigen Unfall. Trotzdem wollte er allen Ernstes, dass ich ins Hospital geschafft werde. Wir, der Steuermann und ich, konnten es gerade noch einmal verhindern. Der Steuermann bewies durch Durchrütteln meiner Extremitäten, dass nichts gebrochen war. Ich selbst versicherte möglichst glaubhaft, dass mir gar nichts mehr weh täte. Was nicht stimmte, die Schürfwunden an den Händen waren sicher nicht der Rede wert, aber das Kreuz schmerzte bei jeder unbedachten Bewegung. Nun, es war Wochenende; die Hafenarbeiter wollten erst montags wiederkommen. Also verfügte der Alte, dass ich übers Wochenende das Bett zu hüten hätte, und falls ich am Montag nicht arbeitsfähig sein sollte… Ich war arbeitsfähig!
Bis zum Montagmorgen waren es aber noch viele Stunden. Stunden, die ich lieber, zumindest am Samstagabend, im christlichen Seemannsheim verbracht hätte. Nicht so sehr deshalb, weil uns der freundliche Pastor eingeladen hatte. Ich war da bereits einmal gewesen und wusste, dass man dort, wenn auch „anständige“, so doch sehr hübsche, tanzfreudige Mädchen kennen lernen konnte. Ja, damit war’s nun Essig. Aber es kam noch schlimmer: Heiko und Manfred, die keinen Bock auf „Anständige“ hatten, hatten ein paar Dockschwalben eingefangen. Und Heiko, dieses Kameradenschwein, vergnügte sich mit seiner Schwalbe in der Unterkoje, direkt unter mir während ich mit steifem Rücken, sozusagen hilf- und bewegungslos, in der Oberkoje lag…
Damit wären wir beim „Thema“! Um es kurz zu machen: Auch während meines Gastspiels auf der STADERSAND gelang es mir nicht, meinen „Jungfräulichkeitsstatus“ endlich abzulegen, obwohl es an Gelegenheiten nicht mangelte. Zum einen war ich zu überheblich. Denn obwohl ich scharf wie Lumpi war, war mir so eine, die auch mit einem Heiko und mit einem Manfred schlief, natürlich nicht gut genug. Zum anderen – ich war einfach zu ungeschickt. Hatten wir schon einmal Gelegenheit, an irgendeinem Sonnabend, in irgendeinem schwedischen Hafen, im örtlichen Folkeshuset am Tanze teilzunehmen, so verhinderte meine Unentschlossenheit stets schon im Ansatz einen möglichen Erfolg. In diesen lokalen Vergnügungsschuppen, in denen sich Jung und Alt trafen, waren die Mädchen stets auf der einen Seite und die Jungs auf der anderen Seite des Saales postiert. Dazwischen war die Tanzfläche. Sobald die Musik einsetzte, flitzten die Jungs wie geölte Blitze zu dem Objekt ihrer Begierde auf die andere Seite hinüber, und ich – ich Lahmfuß, hatte immer das Nachsehen… Die hübschen Mädchen aus dem Seemannsheim, die – die waren selten allein. In der Regel waren sie in Begleitung ihrer „christlichen“ Mutter, und das höchste, das man erreichen konnte, war Freundschaft. Daran aber waren die wenigsten von uns interessiert…
Ein Mädchen allerdings, fast wäre es mir entfallen – wie konnte ich nur! – bleibt unvergessen: Yvonne! Yvonne war, auch wenn sie so aussah, beileibe nicht die reine Unschuld. Sie war ein zierlicher, wunderschöner Lockvogel in einer der billigen Kneipen in Antwerpens berüchtigter Schipperstraat…
Innerhalb der wilden Fahrt, in der die STADERSAND sich nun befand, brachten wir häufig Schnittholz aus Skandinavien nach Antwerpen. Diese Ladung hatte für uns den Vorteil, dass sowohl das Be- wie auch das Entladen sehr viel Zeit beanspruchte. Damals wurde noch jedes Brett einzeln, Raum nützend, von Hand gestaut, und das dauerte meist mehrere Tage. Überdies hatten wir immer einen günstigen Liegeplatz in Stadtnähe, sprich: nahe der Vergnügungsmeile…
Auf einem unserer Streifzüge durch das Terrain landeten wir – wir, das waren Fiete, Siggi und ich – in der bewussten Kneipe. Und zwar ganz und gar nicht zufällig, denn durch das nur halbverhangene Schaufenster entdeckten wir eine junge Frau, die aussah wie, wie Schneewittchen! Ihr schlanker, biegsamer Körper war von einem hautengen, blutroten Samtkleid umwickelt, und das ebenmäßige weiße Gesicht war von nachtschwarzen Locken umrahmt. Es zog uns geradezu in die Kneipe hinein, hin zu dem schönen Kinde. Es war nicht einmal eine Frage der Zeit, dass wir ihr ausnahmslos zu Füßen lagen. Das sah in der Praxis dann so aus: Ganz so wie im Märchen die Zwerge für das leibliche Wohl ihrer Prinzessin sorgten, sorgten wir – Reise für Reise – dafür, dass wir nie mit leeren Händen bei ihr auftauchten und unsere Schmuggelkronen nicht etwa woanders, sondern nur mit ihr – vertranken. In der stillen Hoffnung, dass sie sich vielleicht doch einmal für einen von uns Dreien entscheiden könnte. Denn, natürlich gönnte keiner dem anderen diesen Schatz – und so kam denn auch keiner von uns wirklich zum Zuge. Auch nachdem Fiete ausgefallen war – er hatte ihr, wenn auch unabsichtlich, mit seiner Zigarette ein Loch in ihr feines, enges Kleidchen gebrannt – buhlten Siggi und ich unverdrossen weiterhin um ihre Gunst. Mit List und Tücke versuchten wir uns gegenseitig auszutricksen. Siggis Brautgeschenke – seine Heuer gab ja doch etwas mehr her als die meine – wurden von Mal zu Mal umfangreicher. Was ihm aber wenig nützte, weil Yvonne das war, was wir eben nicht waren: nämlich trinkfest! Aber was auch immer man ihr nachsagen konnte, so war sie doch ein anständiges Mädchen: Sie überließ uns nicht der Gosse, nachdem unsere Taschen geleert und wir selbst bezecht waren, sondern schickte uns per Taxi postwendend an Bord zurück. Das wiederholte sich mehrere Reisen lang – und so muss die Gretchenfrage: Ob sie wohl, und wenn ja mit wem, unbeantwortet bleiben…
Man könnte meinen, meine Zeit auf der STADERSAND hätte nur aus Arbeit und Abenteuern bestanden. Dem ist nicht ganz so. Wenn auch wenig Zeit für Muße blieb, so hatte ich doch ein offenes Auge für die Schönheit der sommerlichen Ostsee-Landschaft. Die Fahrten durch die Stockholmer Schären waren jedes Mal ein Erlebnis der besonderen Art. Die auf nackten, rund geschliffenen Steinen sitzenden rostbunten Holzhäuschen; eingerahmt von dunkelgrünen Nadelbäumen; davor die Bootsstege mit den lose angebundenen, in unserem Kielwasser tanzenden Kähnen… Immer wieder unseren Kurs kreuzende, stattliche Segel- und Motorjachten mit freundlich winkenden Menschen. Die hellen Sommernächte auf den Fahrten durch den Bottnischen Meerbusen, durch eine mit Licht verspiegelte oder verspielt gekräuselte Wasserfläche… Mit einer Mischung aus neidvoller Bewunderung und ungestillter Sehnsucht nahm ich diese fremde Welt in mir auf und schwor mir, eines Tages…
Überhaupt und insgesamt fand ich die Ostseeküste viel reizvoller als die Nordseeküste, von der ich ja nur die schier endlose Perlenkette der friesischen Inseln zu sehen bekam – und das aus gehöriger Entfernung. Allerdings, um nicht ungerecht zu sein, die Fahrten auf den Kanälen in Belgien nach Gent und nach Brüssel hatten auch ihren Reiz, den Reiz des Ländlichen, das gemütliche Dahinschippern von Schleuse zu Schleuse, in deren Nähe auch meist eine dazugehörige Kneipe zu finden war, in der man so zwischendurch ein frisches „Stella Artois“ kippen konnte… Ja, in Brüssel hatte ich sogar Gelegenheit, die Weltausstellung 1958 zu besuchen und war sehr beeindruckt von dem 110 m hohen „Atomium“.
Weniger gemütlich als auf den Kanälen ging es auf der Schelde zu. Bei der Ansteuerung von Vlissingen war man, von Norden kommend und dicht unter Land, völlig ungeschützt den Wellen der Nordsee ausgesetzt, die anscheinend nichts anderes im Sinn hatten, als uns in den Sand zu setzen. Ist die untere Schelde auch breit und weit wie das Maul einer Seekuh, so kann man das vom Fahrwasser, das quer über den Fluss hin und her verläuft, nicht sagen. Die von den Gezeiten beeinträchtigte Strömung, der dichte Verkehr verlangen vom Lotsen, vom Kapitän oder dem Steuermann und nicht zuletzt auch vom Rudergänger höchste Konzentration. Die STADERSAND mit ihrer höchst primitiven Ruderanlage unter diesen Voraussetzungen exakt zu steuern, war „Herkulesarbeit“ – für die man aber dennoch viel Gefühl aufbringen musste. Man musste praktisch schon vorausahnen, nach welcher Seite im nächsten Moment diese verdammte Gurke auszubrechen gedachte. Das war immer dann im besonderen Maße gegeben, wenn das Schiff sozusagen „bis über die Ohren“, also fast bis zu den Brückenfenstern, mit Schnittholz beladen war und auf dem Kopf liegend, dazu noch „knieweich“, von einer Seite zur anderen kippte. Zu meinem Glück hatte ich damals noch nicht die leiseste Ahnung von den Gefahren, denen ein instabil beladenes Schiff ausgesetzt ist. Das Steuern aber unter diesen Umständen schulte ungemein, und das war es wohl auch, dass ich auf allen noch folgenden Schiffen sehr schnell zum „Gefechtsrudergänger“ avancierte.
Die Nordsee selbst, ich mochte sie nicht besonders. Entweder lag sie bleiern da, und es schien, als wolle sie das Schiff für immer wie ein Stück Treibholz festhalten. Dann wieder peitschten die aus Nordwesten anstürmenden Brecher über das flache Küstengewässer. Wehe dem Schiff, dessen Maschine diesen Kräften nicht standhält. Entweder landet es auf den „Gründen“ (Sandbänken) oder verheddert sich in einem der zahlreichen Wracks jener Schiffe, die von einer der gefürchteten Grundseen verschlungen wurden, wenn sie nicht aufgrund einer Kollision gesunken waren. Der sonst so schweigsame Steuermann wusste gelegentlich – aus seiner Fischdampferzeit – von haarsträubenden Geschichten zu berichten. Allerdings, was nun die Fischerei betrifft – das ist ein Kapitel für sich, das ich jetzt aber nicht aufschlagen will. So viel nur sei gesagt: Selbst mir fiel auf, dass sich die Fischer nicht einen Deut um die SStO (Seewasserstraßenordnung) kümmerten. Auch nicht auf dem „Zwangsweg“, der amtlich vorgeschriebenen Fahrtroute an der deutsch-holländischen Küste. Aber was ging mich die SStO an? Ich war Moses und ein Seppl noch dazu…
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die märchenhaften Nächte auf der sommerlichen Ostsee: Ein weiter, grandioser Silbersee unter einem zartblauen Firmament, durch das zaghaft, aus ganz weiter Ferne, die Sterne glitzerten. Doch diese Idylle war nur von kurzer Dauer. Der Herbst kam früh und mit ihm die kalte, ungemütliche, unfreundliche „Windsbraut“. Die STADERSAND begann wieder zu hoppeln, zu bocken, zu schlingern. Aber, wie sehr sie sich auch bemühte, mich wieder seekrank zu machen, das schaffte sie nicht mehr. Ich war inzwischen so seefest, wie es nur ein alter Seebär sein kann. Nicht einmal die Nordsee – und Nordsee ist Mordsee, wie man weiß – konnte mich zum Kotzen bringen. Was aber nicht heißt, dass mir nicht oft genug zum Kotzen war – aber das lag mehr an dem unmenschlichen Wachdienst und dem alltäglichen Fraß…
Während der Sommermonate – das muss ich gerechtigkeitshalber erwähnen – hatte die mitfahrende Frau des Kapitäns für ein halbwegs anständiges Menü gesorgt. Das eingeschränkte Lob deswegen, weil ich mich noch immer nicht an die norddeutsche Kost gewöhnt hatte: Kein Schnitzel, keine Semmelknödel, keine Dampfnudel; stattdessen: Sauerbraten, grüne Heringe, Königsberger Klopse und zu allem Kartoffeln, Kartoffeln , Kartoffeln… Aber diese relativ fetten Zeiten waren bald wieder vorbei, und dann gab es hauptsächlich nur noch – Bratkartoffel mit Gasölgeschmack, denn Gasöl-Manfred hatte wieder das Ganze in der Kombüse. Zum Glück gab es da ja noch die Bunkerstation in Rendsburg, ich wäre sonst glatt verhungert. Im niederländischen Delfzijl versuchte Meister Lottl, der gute alte Maschinist, mich mit einer Delikatesse bekannt zu machen. Er reichte mir eine Tüte mit frisch abgebrühten kleinen Garnelen, Granat genannt. Leider verschwieg er mir – wohl weniger aus Absicht, sondern eher aus Vergesslichkeit – dass man die Würmchen vor Genuss auspuhlen muss. Empört spukte ich das Zeug aus und wunderte mich wieder einmal mehr über die Eßgewohnheiten dieser Barbaren…
Wir waren also fest in der Holzfahrt. Nur hin und wieder liefen wir auf der Rückfahrt von Belgien auch Bremen an, um für die Spedition Ahlmann Stückgut nach Schweden zu karren. Bei einer dieser Gelegenheiten schickte mich der Alte zum Röntgen. Der Befund war negativ: Mein Kreuz hatte den unfreiwilligen „Absprung“ anscheinend ohne Schaden überstanden. So weit, so gut. Besser noch: Dass ich letztendlich zum Jahresende das Schiff mit heilen Knochen verlassen konnte – ja, dass es mich nicht vorzeitig in die Tiefe mitgerissen hatte…
Aber nein, ich hab nicht die geringste Ahnung, wie mein erstes Schiff geendet ist. Ob auf dem Abwrackplatz oder ob es auf dem Meeresgrunde liegt – was eher anzunehmen ist. Warum? Während meiner Bord-Zeit gab es einige kritische Situationen, in denen in wenigen Minuten von einer unsichtbaren Instanz über „Sein oder Nichtsein“ entschieden wurde. Dabei denke ich nicht einmal an die „Beinahekollisionen“, sondern mir graut nachträglich noch bei dem Gedanken, mit welcher Unbedarftheit die Kümoschipper an die Schiffsstabilität herangingen. Diese A2-Leute (damals kleinstes Kapitänspatent) hatten bestenfalls so etwas wie eine Ahnung von den Kriterien einer Stabilitätskurve. An den Seefahrtschulen wurden sie innerhalb ihrer Ausbildung darüber nicht belehrt. Also schätzten sie den Umfang der Stabilität – so wie die Altvorderen – nach dem „Beingefühl“, das sie beim Rollen des Schiffes verspürten…
Schnittholz ist vom Gewicht her eine vergleichsweise leichte Ladung. Man packte also, nachdem der Laderaum voll war, noch soviel, wie nur möglich, als Decksladung obenauf. Je mehr Raummeter Ladung, desto besser – für den Reeder. Der Schiffsführer hatte abzuwägen, was noch geht und was nicht. Auf keinen Fall ging es, die Deckslast höher wachsen zu lassen, als es die Brückenfenster zuließen; schließlich musste man ja noch darüber hinweg gucken können. Zuletzt musste das Paket dann auch noch seefest verschnürt werden. Dazu brachten wir Drahtstander in losen Buchten seitlich an den Bordwänden an und holten die dann mittels Taljen über die Oberkanten der Decksladung teid. Davor noch wurden die dicht an dicht liegenden Bretter mit so vielen Persenningen abgedeckt, wie wir nur hatten, um das gefährliche Nasswerden des Holzes nach Möglichkeit zu verhindern. Aber natürlich konnte man die Decksladung niemals so komplett abdecken, dass das Wasser, die stürmische See keine ungeschützte Angriffsfläche gefunden hätte. Da waren die Aussparungen für unsere zwei Masten. Der Zugang zu dem unter der Back liegenden Kabelgatt musste frei bleiben. Die Außenseiten der Decksladung wirksam vor Nässe zu schützen, dazu waren wir sowieso nicht in der Lage, weil sich die Speigatts in der Verschanzung schlecht verstopfen ließen…
Ob nun das Schiff nach Beendigung der Ladungsarbeiten sich noch in einem seetüchtigen Zustand befand, das konnte erst nach dem Ablegen geprüft werden. Wenn es bereits nach kurzer Fahrt und noch im ruhigen Hafengewässer einige Grad zur Seite kippte und nicht mehr zurück schwang, ja dann – dann war was faul im Staate… Dann hätte man sofort wieder an die Pier gemusst, um an Ort und Stelle die Ladung teilweise zu löschen. Dass wir manches Mal wie ein kranker Fisch aus dem Hafen schlichen, daran kann ich mich schon erinnern. Dass wir aber einmal umgekehrt wären, nur weil sich bei der ersten Hartruderlage sogleich auch das Schiff zur Seite neigte und in dieser Lage verharrte, das habe ich nicht erlebt. Aber immerhin: Das Pech einer „VASA“, die nach dem „Leinen los“ noch im Hafenbecken mit Mann, Maus und Musketen kenterte – dieses Pech blieb uns erspart. Einmal allerdings, das Schiff war mir in stürmischer See aus dem Ruder gelaufen, stockte mir der Herzschlag. Aus dem finnischen Meerbusen kommend, war ich bemüht – ich war allein auf der Brücke – das überladene, kopflastige Schiff auf Kurs zu halten. Es war eine stockfinstere Nacht. Die von einem heftigen nordwestlichen Wind gepeitschten Wellen klatschten böse gegen unsere Steuerbordseite. Urplötzlich erfasste eine übergroße Welle, die ich in der Finsternis nicht kommen sah, das Schiff vorn an der Steuerbordseite, hob es hoch und drückte es dabei auf die Backbordseite. Einen Augenblick lang schien mir das Schiff in dieser Stellung verharren zu wollen – wie ein Mensch auf einem Bein, der krampfhaft versucht, das Gleichgewicht zu halten. Im nächsten Augenblick kippte es, noch immer in Backbord-Seitenlage, über den Rücken der Welle nach vorn... Gnädigerweise wurden wir von der nächstfolgenden Welle, die krachend über uns hinwegfegte, nicht verschluckt. Wie dem Alten, der wenig später auf der Brücke stand, zumute war, das weiß ich nicht. Mir aber war trotz aller Unbedarftheit klar: Das war knapp! Und ich tat fürderhin die vielen Geschichten, die man sich von verschwundenen oder kieloben treibenden „Holzfrachtern“ erzählte – die Rede ist von der Nord- und Ostsee und nicht vom Bermuda-Dreieck – nicht länger als „Seemannsgarn“ ab. Und seit dem Unglück – wie ich dieses Wort doch hasse, steht es doch in der Regel für menschliches Versagen, für Schlamperei, für unzumutbare Bedingungen, für nicht erfolgte Ausbildung, für Gewinnmaximierung – also seit dem „Unglück“ der „ESTONIA“ weiß ja nun auch der Rest der Welt, dass die Ostsee nicht bloß ein harmloses Planschbecken ist.
Der Finnische Meerbusen kommt in meinen Erinnerungen nicht sehr gut weg. Entweder hatten wir schlechtes Wetter, oder wir stocherten durch loses Treibeis. Auch an die Häfen wie Helsinki, Kotka, Turku kann ich mich nicht im Einzelnen entsinnen. Alles, woran ich mich erinnere, sind künstlich aufgeschüttete, riesige Schneeberge im grauen, Nebel verhangenen Hafengelände, Schneetreiben, Frost… Die Finnmark, die wir für Schnaps und Zigaretten einnahmen, gaben nicht soviel her, dass man damit hätte auf den Putz hauen können. Außerdem waren die Mädchen, mit denen wir Kontakt hatten, nicht so sehr an uns, als eher am „Sprit“ interessiert und – na ja, der Rest sei Schweigen… An den Finnen imponierte mir am meisten ihre Sprache: Die häufig aufeinander folgenden Vokale, wie z. B. im finnischen Wort für Margarine – gleich drei aaa hintereinander – oder ein Wort wie Kiriiaaakaupa, das ich ungemein klangvoll fand, amüsierten mich. Das allerdings nährte nur den Verdacht meiner Kameraden, dass ich vielleicht doch nicht ganz dicht sei…
Aber wie dem auch war, am 1. Nov. 1958 wurde vom Seemannsamt in Brunsbüttelkoog meine Ernennung zum „Jungmann“ bestätigt. Damit hatte ich die erste Stufe meiner Seemannskarriere erreicht, und ich war nicht wenig stolz darauf. Auch die Heuer hatte sich damit um ein Weniges erhöht, aber es war nicht der Rede wert. Kurz vor Weihnachten wurde das Schiff doch tatsächlich nach seinem Heimathafen, nach dem es ja benannt war, beordert. Irgendwer von der Besatzung kam auf die irrwitzige Idee, dass uns eventuell Weihnachtsgeld zustände. Auch ich war von dem Gedanken angetan und pilgerte hoffnungsvoll zu des Eigners Villa. Müßig zu sagen, dass wir umgehend hinaus komplimentiert wurden. Weil ich aber schon mal da war, und obwohl ich es mir von den Finanzen her eigentlich nicht leisten konnte, kündigte ich. Mein Dienstverhältnis endete am 22. Dezember 1958. Am darauf folgenden Tag entstieg ich in meinem Heimatort der lokalen Bimmelbahn, und meine Mutter, die mir auf der Dorfstraße entgegen geeilt war, schloss mich ungestüm in ihre Arme…